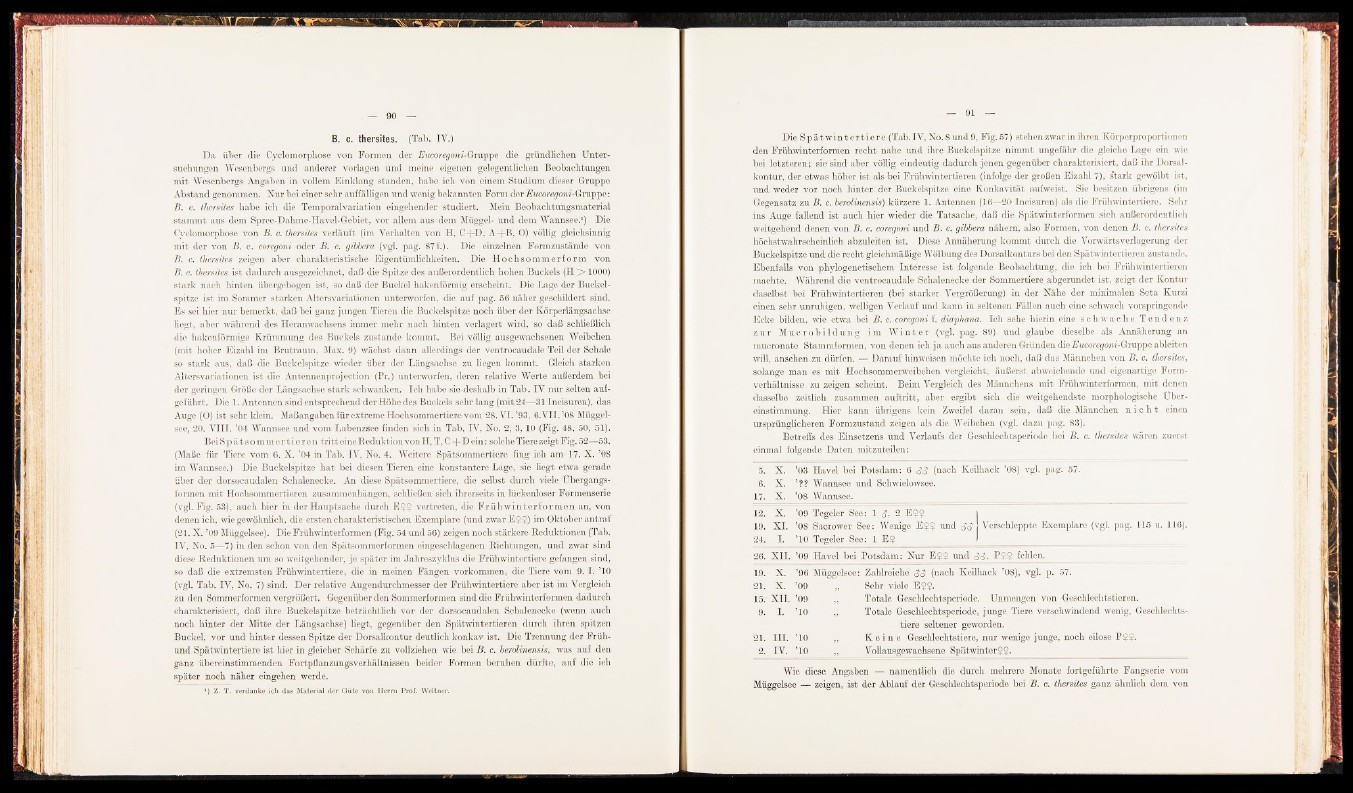
B. c. thersites. (Tab. IV.)
Da über die Cyclomorphose von Formen der Eucoregoni- Gruppe die gründlichen Untersuchungen
Wesenbergs und anderer Vorlagen und meine eigenen gelegentlichen Beobachtungen
mit Wesenbergs Angaben in vollem Einklang standen, habe ich von einem Studium dieser Gruppe
Abstand genommen. Nur bei einer sehr auffälligen und wenig bekannten Form der Eucoregoni- Gruppe:
B. c. thersites habe ich die Temporalvariation eingehender studiert. Mein Beobachtungsmaterial
stammt aus dem Spree-Dahme-Havel-Gebiet, vor allem aus dem Müggel- und dem Wannsee.1) Die
Cyclomorphose von B. c. thersites verläuft (im Verhalten von H, C+D, A+B, 0) völlig gleichsinnig
mit der von B. c. coregoni oder B. c. gibbera (vgl. pag. 87f.). Die einzelnen Formzustände von
B. c. thersites zeigen aber charakteristische Eigentümlichkeiten. Die Hoch somme r f o rm von
B. c. thersites ist dadurch ausgezeichnet, daß die Spitze des außerordentlich hohen Buckels (H > 1000)
stark nach hinten übergebogen ist, so daß der Buckel hakenförmig erscheint. Die Lage der Buckel-
spitze ist im Sommer starken Altersvariationen unterworfen, die auf pag. 56 näher geschildert sind.
Es sei hier nur bemerkt, daß bei ganz jungen Tieren die Buckelspitze noch über der Körperlängsachse
liegt, aber während des Heranwachsens immer mehr nach hinten verlagert wird, so daß schließlich
die hakenförmige Krümmung des Buckels zustande kommt. Bei völlig ausgewachsenen Weibchen
(mit hoher Eizahl im Brutraum, Max. 9) wächst dann allerdings der ventrocaudale Teil der Schale
so stark aus, daß die Buckelspitze wieder über der Längsachse zu liegen kommt. Gleich starken
Altersvariationen ist die Antennenprojection (Pr.) unterworfen, deren relative Werte außerdem bei
der geringen Größe der Längsachse stark schwanken. Ich habe sie deshalb in Tab. IV nur selten auf-
geführt. Die 1. Antennen sind entsprechend der Höhe des Buckels sehr lang (mit 24—31 Incisuren), das
Auge (0) ist sehr klein. Maßangaben für extreme Hochsommertiere vom 28. VI. ’93, 6.V II. ’08 Müggelsee,
20. VIII. ’04 Wannsee und vom Labenzsee finden sich in Tab. IV, No. 2, 3, 10 (Fig. 48, 50, 51).
Bei S p ä t s omme r t i e r e n tritt eine Reduktion von H, T, C -j- D ein: solche Tiere zeigt Fig. 52—53.
(Maße für Tiere vom 6. X. ’04 in Tab. IV, No. 4. Weitere Spätsommertiere fing ich am 17. X. ’08
im Wannsee.) Die Buckelspitze hat bei diesen Tieren eine konstantere Lage, sie liegt etwa gerade
über der dorsocaudalen Schalenecke. An diese Spätsommertiere, die selbst durch viele Übergangsformen
mit Hochsommertieren Zusammenhängen, schließen sich ihrerseits in lückenloser Formenserie
(vgl. Fig. 53), auch hier in der Hauptsache durch E$$ vertreten, die Fr ü hwi n t e r f orm en an, von
denen ich, wie gewöhnlich, die ersten charakteristischen Exemplare (und zwar E$$) im Oktober antraf
(21. X. ’09 Müggelsee). Die Frühwinterformen (Fig. 54 und 56) zeigen noch stärkere Reduktionen (Tab.
IV, No. 5—7) in den schon von den Spätsommerformen eingeschlagenen Richtungen, und zwar sind
diese Reduktionen um so weitgehender, je später im Jahreszyklus die Frühwintertiere gefangen sind,
so daß die extremsten Früh wintertiere, die in meinen Fängen Vorkommen, die Tiere vom 9. I. ’10
(vgl. Tab. IV, No. 7) sind. Der relative Augendurchmesser der Frühwintertiere aber ist im Vergleich
zu den Sommerformen vergrößert. Gegenüber den Sommerformen sind die Frühwinterformen dadurch
charakterisiert, daß ihre Buckelspitze beträchtlich vor der dorsocaudalen Schalenecke (wenn auch
noch hinter der Mitte der Längsachse) liegt, gegenüber den Spätwintertieren durch ihren spitzen
Buckel, vor und hinter dessen Spitze der Dorsalkontur deutlich konkav ist. Die Trennung der Früh-
und Spätwintertiere ist hier in gleicher Schärfe zu vollziehen wie bei B. c. berolinensis, was auf den
ganz übereinstimmenden Fortpflanzungsverhältnissen beider Formen beruhen dürfte, auf die ich
später noch näher eingehen werde.
x) Z. T. verdanke ich das Material der Güte von Herrn Prof. Weltner.
Die Sp ä twi n t e r t i e r e (Tab. IV, No. 8 und 9, Fig. 57) stehen zwar in ihren Körperproportionen
den Frühwinterformen recht nahe und ihre Buckelspitze nimmt ungefähr die gleiche Lage ein wie
bei letzteren; sie sind aber völlig eindeutig dadurch jenen gegenüber charakterisiert, daß ihr Dorsal-
kontur, der etwas höher ist als bei Frühwintertieren (infolge der großen Eizahl 7), stark gewölbt ist,
und weder vor noch hinter der Buckelspitze eine Konkavität aufweist. Sie besitzen übrigens (im
Gegensatz zu B. c. berolinensis) kürzere 1. Antennen (16—20 Incisuren) als die Frühwintertiere. Sehr
ins Auge fallend ist auch hier wieder die Tatsache, daß die Spätwinterformen sich außerordentlich
weitgehend denen von B. c. coregoni und B. c. gibbera nähern, also Formen, von denen B. c. thersites
höchstwahrscheinlich abzuleiten ist. Diese Annäherung kommt durch die Vorwärtsverlagerung der
Buckelspitze und die recht gleichmäßige Wölbung des Dorsalkonturs bei den Spätwintertieren zustande.
Ebenfalls von phylogenetischem Interesse ist folgende Beobachtung, die ich bei Frühwintertieren
machte. Während die ventrocaudale Schalenecke der Sommertiere abgerundet ist, zeigt der Kontur
daselbst bei Frühwintertieren (bei starker Vergrößerung) in der Nähe der minimalen Seta Kurzi
einen sehr unruhigen, welligen Verlauf und kann in seltenen Fällen auch eine schwach vorspringende
Ecke bilden, wie etwa bei B. c. coregoni f. dia'phana. Ich sehe hierin eine s c hw a c h e T e n d e n z
z u r Mu c r o b i l d u n g im Wi n t e r (vgl. pag. 89) und glaube dieselbe als Annäherung an
mucronate Stammformen, von denen ich ja auch aus anderen Gründen die Eucoo'egoni-Giw^'pe ableiten
will, ansehen zu dürfen. —- Darauf hinweisen möchte ich noch, daß das Männchen von B. c. thersites,
solange man es mit Hochsommerweibchen vergleicht, äußerst abweichende und eigenartige Formverhältnisse
zu zeigen scheint. Beim Vergleich des Männchens mit Frühwinterformen, mit denen
dasselbe zeitlich zusammen auftritt, aber ergibt sich die weitgehendste morphologische Übereinstimmung.
Hier kann übrigens kein Zweifel daran sein, daß die Männchen n i c h t einen
ursprünglicheren Formzustand zeigen als die Weibchen (vgl. dazu pag. 83).
Betreffs des Einsetzens und Verlaufs der Geschlechtsperiode bei B. c. thersites wären zuerst
einmal folgende Daten mitzuteilen:
5. X. ’03 Havel bei Potsdam: 6 S S (nach Keilhack ’08) vgl. pag. 57.
6. X. ’?? Wannsee und Schwielowsee.
17. X. ’08 Wannsee.
12. X. ’09 Tegeler See: 1 2 E ?$ j
19. XI. ’08 Sacrower See: Wenige E$$ und S S | Verschleppte Exemplare (vgl. pag. 115 u. 116).
24. I. ’10 Tegeler See: 1 E ? J
26. XII. ’09 Havel bei Potsdam: Nur E$$ und SS, P?$ fehlen.
19. X. ’96 Müggelsee: Zahlreiche S S (nach Keilhack ’08), vgl. p. 57.
21. X. ’09 „ Sehr viele E$$.
15. XII. ’09 „ Totale Geschlechtsperiode. Unmengen von Geschlechtstieren.
9 . I. ’10 „ Totale Geschlechtsperiode, junge Tiere verschwindend wenig, Geschlechtstiere
seltener geworden.
21. III. ’10 „ K e i n e Geschlechtstiere, nur wenige junge, noch eilose P?$.
2. IV. ’10 „ Vollausgewachsene Spätwinter $$._______________________________
Wie diese Angaben — namentlich die durch mehrere Monate fortgeführte Fangserie vom
Müggelsee — zeigen, ist der Ablauf der Geschlechtsperiode bei B. c. thersites ganz ähnlich dem von