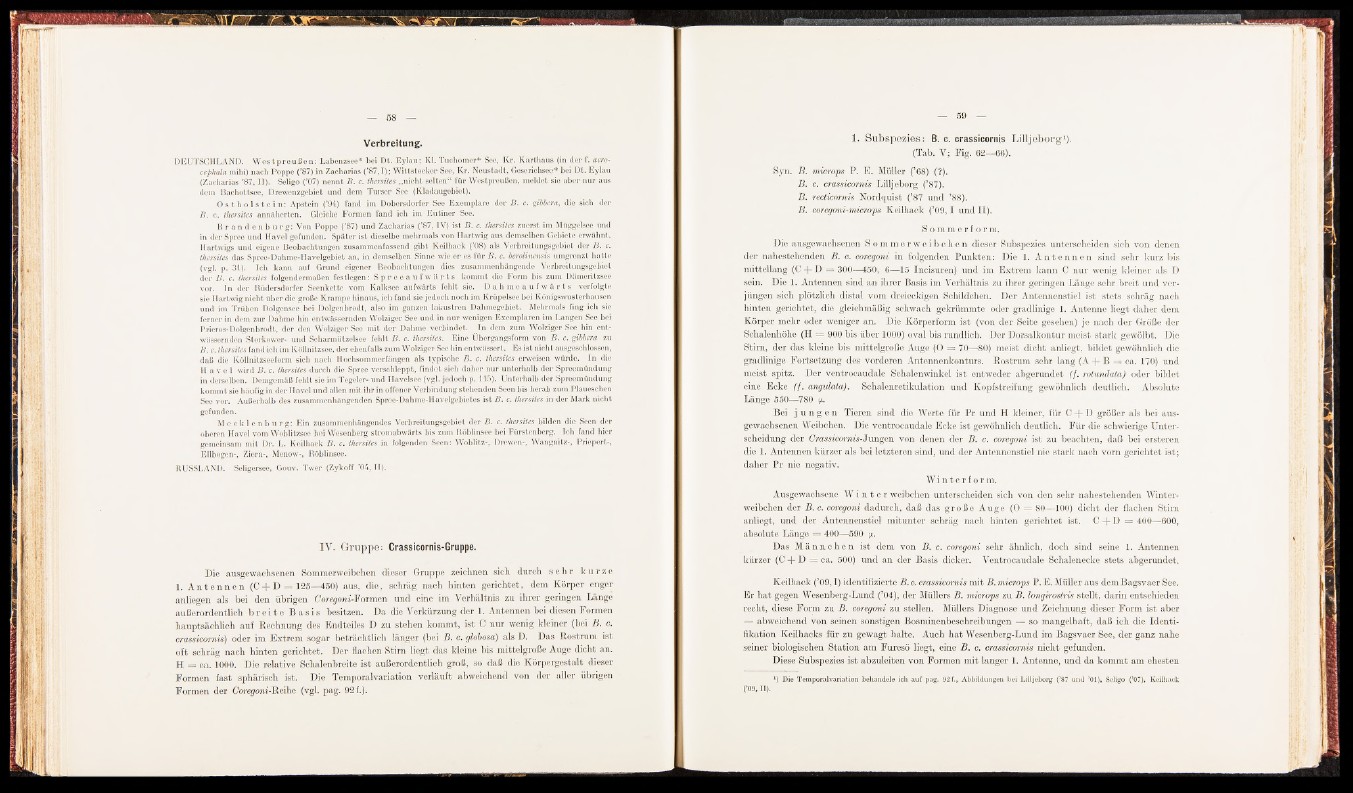
Verbreitung.
DEUTSCHLAND. Westpreußen: Labenzsee* bei Dt. Eylau; Kl. Tuchomer* See, Kr. Karthaus (in der f. acro-
cephala mihi) nach Poppe (’87) in Zacharias (’87,1); Wittstocker See, Kr. Neustadt, Geserichsee* bei Dt. Eylau
(Zacharias ’87, II). Seligo (’07) nennt B . c. thersites „nicht selten“ für Westpreußen, meldet sie aber nur aus
dem Bachottsee, Drewenzgebiet und dem Turser See (Kladaugebiet).
Os t h o l s t e i n : Apstein (’94) fand im Dobersdorfer See Exemplare der B . c. gibbera, die sich der
B . c. thersites annäherten. Gleiche Formen fand ich im Eutiner See.
B r a n d e n b u r g : Von Poppe (’87) und Zacharias (’87, IV) ist B . c. thersites zuerst im Müggelsee und
in der Spree und Havel gefunden. Später ist dieselbe mehrmals von Hartwig aus demselben Gebiete erwähnt.
Hartwigs und eigene Beobachtungen zusammenfassend gibt Keilhack (’08) als Verbreitungsgebiet der B . c.
thersites das Spree-Dalime-Havelgebiet an, in demselben Sinne wie er es für B . c. berolinensis umgrenzt hatte
(vgl. p. 31). Ich kann auf Grund eigener Beobachtungen dies zusammenhängende Verbreitungsgebiet
der B . c. thersites folgendermaßen festlegen: S p r e e a u f w ä r t s kommt die Form bis zum Dämeritzsee
vor. In der Rüdersdorfer Seenkette vom Kalksee aufwärts fehlt sie. D a hm e a u f w ä r t s verfolgte
sie Hartwig nicht über die große Krampe hinaus, ich fand sie jedoch noch im Krüpelsee bei Königswusterhausen
und im Trüben Dolgensee bei Dolgenbrodt, also im ganzen lakustren Dahmegebiet. Mehrmals fing ich sie
ferner in dem zur Dahme hin entwässernden Wolziger See und in nur wenigen Exemplaren im Langen See bei
Prieros-Dolgenbrodt, der den Wolziger See mit der Dahme verbindet. In dem zum Wolziger See hin entwässernden
Storkower- und Scharmützelsee fehlt B . c. thersites. Eine Übergangsform von B . c. gibbera zu
B . c. thersites fand ich im Köllnitzsee, der ebenfalls zum Wolziger See hin entwässert. Es ist nicht ausgeschlossen,
daß die Köllnitzseeform sich nach Hochsommerfängen als typische B . c. thersites erweisen würde. In die
H a v e l wird B . c. thersites durch die Spree verschleppt, findet sich daher nur unterhalb der Spreemündung
in derselben. Demgemäß fehlt sie im Tegeler- und Havelsee (vgl. jedoch p. 115). Unterhalb der Spreemündung
kommt sie häufig in der Havel und allen mit ihr in offener Verbindung stehenden Seen bis herab zum Plaueschen
See vor. Außerhalb des zusammenhängenden Spree-Dahme-Havelgebietes ist B . c. thersites in der Mark nicht
gefunden.
Me c k l e n b u r g : Ein zusammenhängendes Verbreitungsgebiet der B . c. thersites bilden die Seen der
oberen Havel vom Wobützsee bei Wesenberg stromabwärts bis zum Röblinsee bei Fürstenberg. Ich fand hier
gemeinsam mit Dr. L. Keilhack B . c. thersites in folgenden Seen: Woblitz-, Drewen-, Wangnitz-, Priepert-,
Ellbogen-, Ziern-, Menow-, Röblinsee.
RUSSLAND. Seligersee, Gouv. Twer (Zykoff ’04, II).
IV. Gruppe. Crassicornis-Gruppe.
Die ausgewachsenen Sommerweibchen dieser Gruppe zeichnen sich durch s e h r k u r z e
1. A n t e n n e n (C + D 125—450) aus, die, schräg nach hinten gerichtet, dem Körper enger
anliegen als bei den übrigen Coregoni-Formen und eine im Verhältnis zu ihrer geringen Länge
außerordentlich b r e i t e Ba s i s besitzen. Da die Verkürzung der 1. Antennen bei diesen Formen
hauptsächlich auf Rechnung des Endteiles D zu stehen kommt, ist C nur wenig kleiner (bei B. c.
crassicornis) oder im Extrem sogar beträchtlich länger (bei B. c. globosa) als D. Das Rostrum ist
oft schräg nach hinten gerichtet. Der flachen Stirn liegt das kleine bis mittelgroße Auge dicht an.
H = ca. 1000. Die relative Schalenbreite ist außerordentlich groß, so daß die Körpergestalt dieser
Formen fast sphärisch ist. Die Temporalvariation verläuft abweichend von der aller übrigen
Formen der Coregoni-Reihe (vgl. pag. 92 f.).
1. Subspezies: B. c. crassicornis Lilljeborg1)-
(Tab. V; Fig. 62—66).
Syn. B. microps P. E. Müller (’68) (?).
B. c. crassicornis Lilljeborg (’87).
B. recticornis Nordquist (’87 und ’88).
B. coregoni-microps Keilhack (’09,1 und II).
S omme r f o r m .
Die ausgewachsenen S omme r w e i b c h e n dieser Subspezies unterscheiden sich von denen
der nahestehenden B. c. coregoni in folgenden Punkten: Die 1. A n t e n n e n sind sehr kurz bis
mittellang (C + D = 300—450, 6—15 Incisuren) und im Extrem kann C nur wenig kleiner als D
sein. Die 1. Antennen sind an ihrer Basis im Verhältnis zu ihrer geringen Länge sehr breit und verjüngen
sich plötzlich distal vom dreieckigen Schildchen. Der Antennenstiel ist stets schräg nach
hinten gerichtet, die gleichmäßig schwach gekrümmte oder gradlinige 1. Antenne liegt daher dem
Körper mehr oder weniger an. Die Körperform ist (von der Seite gesehen) je nach der Größe der
Schalenhöhe (H == 900 bis über 1000) oval bis rundlich. Der Dorsalkontur meist stark gewölbt. Die
Stirn, der das kleine bis mittelgroße Auge (O =170—80) meist dicht anliegt, bildet gewöhnlich die
gradlinige Fortsetzung des vorderen Antennenkonturs. Rostrum sehr lang (A -+- B = ca. 170) und
meist spitz. Der ventrocaudale Schalenwinkel ist entweder abgerundet (f. rotundata) oder bildet
eine Ecke (f. angulata). Schalenretikulation und Kopfstreifung gewöhnlich deutlich. Absolute
Länge 550—780 p..
Bei j u n g e n Tieren sind die Werte für Pr und H kleiner, für C + D größer als bei ausgewachsenen
Weibchen. Die ventrocaudale Ecke ist gewöhnlich deutlich. Für die schwierige Unterscheidung
der Orasstcorms-Jungen von denen der B. c. coregoni ist zu beachten, daß bei ersteren
die 1. Antennen kürzer als bei letzteren sind, und der Antennenstiel nie stark nach vom gerichtet ist;
daher Pr nie negativ.
Wi n t e r f o r m.
Ausgewachsene W i n t e r weibchen unterscheiden sich von den sehr nahestehenden Winterweibchen
der B. c. coregoni dadurch, daß das große Auge (O = 80—100) dicht der flachen Stirn
anliegt, und der Antennenstiel mitunter schräg nach hinten gerichtet ist. C + D = 400—600,
absolute Länge = 400—590 y..
Das Mä n n c h e n ist dem von B. c. coregoni sehr ähnlich, doch sind seine 1. Antennen
kürzer (C + D = ca. 500) und an der Basis dicker. Ventrocaudale Schalenecke stets abgerundet.
Keilhack (’09,1) identifizierte B. c. crassicornis mit B. microps P. E. Müller aus demBagsvaer See.
Er hat gegen Wesenberg-Lund (’04), der Müllers B. microps zu B. longirostris stellt, darin entschieden
recht, diese Form zu B. coregoni zu stellen. Müllers Diagnose und Zeichnung dieser Form ist aber
— abweichend von seinen sonstigen Bosminenbeschreibungen — so mangelhaft, daß ich die Identifikation
Keilhacks für zu gewagt halte. Auch hat Wesenberg-Lund im Bagsvaer See, der ganz nahe
seiner biologischen Station am Furesö liegt, eine B. c. crassicornis nicht gefunden.
Diese Subspezies ist abzuleiten von Formen mit langer 1. Antenne, und da kommt am ehesten
0 Die Temporalvariation behandele ich auf pag. 92 f., Abbildungen bei Lilljeborg (’87 und ’01), Seligo (’07), Keilhack
(’09, II).