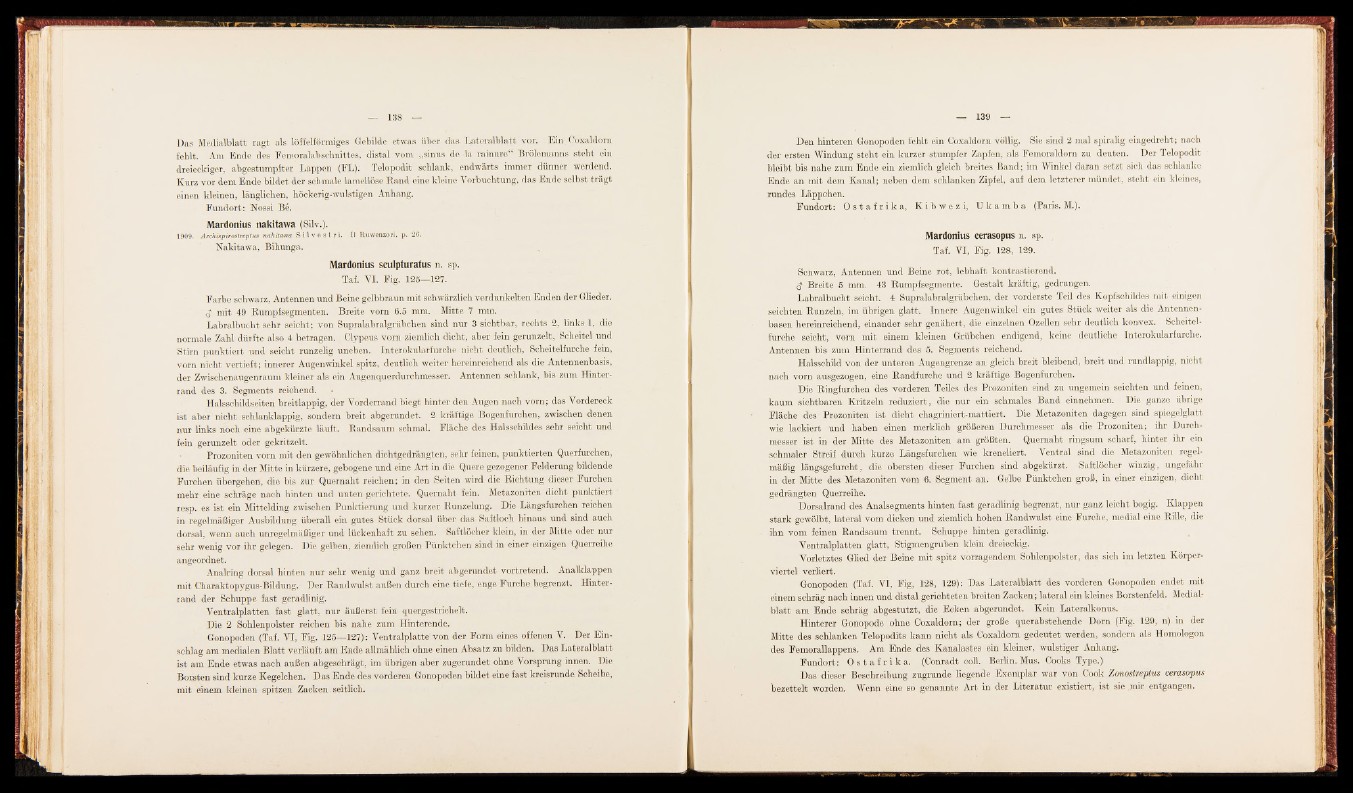
Das Medialblatt ragt als löffelförmiges Gebilde etwas über das-Lateralblatt vor. Ein Coxaldorn
fehlt. Am Ende des Femoralabschnittes, distal vom „sinus de la rainure“ Brölemanns steht ein
dreieckiger, abgestumpfter Lappen (EL): Telopodit schlank, endwärts immer dünner werdend.
Kurz vor dem Ende bildet der schmale lamellöse Rand eine kleine Yorbuchtung, das Ende selbst trägt
einen kleinen, länglichen, höckerig-wulstigen Anhang.
Fundort: Nossi Be.
Mardonius nakitawa (Silv.).
1909. Archispirostreptus nakitawa S i l v e s t r i . II Ruwenzori, p. 26.
Nakitawa, Bihunga.
Mardonius sculpturatus n. sp.
Taf. VI. Fig. 125—127.
Farbe schwarz, Antennen und Beine gelbbraun mit schwärzlich verdunkelten Enden der Glieder.
" $ mit 49 Rumpfsegmenten. Breite vorn 6.5 mm. Mitte 7 mm.
Labralbucht sehr seicht; von Supralabralgrübchen sind nur 3 sichtbar, rechts 2, links 1, die
normale Zahl dürfte also 4 betragen. Clypeus vorn ziemlich dicht, aber fein gerunzelt, Scheitel und
Stirn punktiert und seicht runzelig uneben. Interokularfurche nicht deutlich, Scheitelfurche fein,
vorn nicht vertieft; innerer Augenwinkel spitz, deutlich weiter hereinreichend als die Antennenbasis,
der Zwischenaugenraum kleiner als ein Augenquerdurchmesser. Antennen schlank, bis zum Hinterrand
des 3. Segments reichend.
Halsschildseiten breitlappig, der Vorderrand biegt hinter den Augen nach vorn; das Vordereek
ist aber nicht schlanklappig, sondern breit abgerundet. 2 kräftige Bogenfurchen, zwischen denen
nur links noch eine abgekürzte läuft. Randsaum schmal. Fläche des Halsschildes sehr seicht und
fein gerunzelt oder gekritzelt.
Prozoniten vorn mit den gewöhnlichen dichtgedrängten, sehr feinen, punktierten Querfurchen,
die beiläufig in der Mitte in kürzere, gebogene und eine Art in die Quere gezogener Felderung bildende
Furchen übergehen, die bis zur Quernaht reichen; in den Seiten wird die Richtung dieser Furchen
mehr eine schräge nach hinten und unten gerichtete. Quernaht fein. Metazoniten dicht punktiert
resp. es ist ein Mittelding zwischen Punktierung und kurzer Runzelung. Die Längsfurchen reichen
in regelmäßiger Ausbildung überall ein gutes Stück dorsal über das Saftloch hinaus und sind auch
dorsal, wenn auch unregelmäßiger und lückenhaft zu sehen. Saftlöcher klein, in der Mitte oder nur
sehr wenig vor ihr gelegen. Die gelben, ziemlich großen Pünktchen sind in einer einzigen Querreihe
angeordnet.
Analring dorsal hinten nur sehr wenig und ganz breit abgerundet vortretend. Analklappen
mit Charaktopygus-Bildung. Der Randwulst außen durch eine tiefe, enge Furche begrenzt. Hinterrand
der Schuppe fast geradlinig.
Ventralplatten fast glatt, nur äußerst fein; quergestrichelt.
Die 2 Sohlenpolster reichen bis nahe zum Hinterende.
Gonopoden (Taf. VI, Fig. 125—127): Ventralplatte von der Form eines offenen V. Der Einschlag
am medialen Blatt verläuft am Ende allmählich ohne einen Absatz zu bilden. Das Lateralblatt
ist am Ende etwas nach außen abgeschrägt, im übrigen aber zugerundet ohne Vorsprung innen. Die
Borsten sind kurze Kegelchen. Das Ende des vorderen Gonopoden bildet eine fast kreisrunde Scheibe,
mit einem kleinen spitzen Zacken seitlich.
Den hinteren Gonopoden fehlt ein Coxaldorn völlig. Sie sind 2 mal spiralig eingedreht; nach
der ersten Windung steht ein kurzer stumpfer Zapfen, als Femoraldorn zu deuten. Der Telopodit
bleibt bis nahe zum Ende ein ziemlich gleich breites Band; im Winkel daran setzt sich das schlanke
Ende an mit dem Kanal; neben dem schlanken Zipfel, auf dem letzterer mündet, steht ein kleines,
rundes Läppchen.
Fundort: O s t a f r i k a , K i b w e z i , U k a m b a (Paris. M.).
Mardonius cerasopus n. sp.
Taf. VI, Fig. 128, 129.
Schwarz, Antennen und Beine rot, lebhaft kontrastierend.
S Breite 5 mm. 43 Rumpfsegmente. Gestalt kräftig, gedrungen.
Labralbucht seicht. 4 Supralabralgrübchen, der vorderste Teil des Kopfschildes mit einigen
seichten Runzeln, im übrigen glatt. Innere Augenwinkel ein gutes Stück weiter als die Antennenbasen
hereinreichend, einander sehr genähert, die einzelnen Ozellen sehr deutlich konvex. Scheitel-
furche seicht, vorn mit einem kleinen Grübchen endigend, keine deutliche Interokularfurche.
Antennen bis zum Hinterrand des 5. Segments reichend.
Halsschild von der unteren Augengrenze an gleich breit bleibend, breit und rundlappig, nicht
nach vorn ausgezogen, eine Randfurche und 2 kräftige Bogenfurchen.
Die Ringfurchen des vorderen Teiles des Prozoniten sind zu ungemein seichten und feinen,
kaum sichtbaren Kritzeln reduziert, die nur ein schmales Band einnehmen. Die ganze übrige
Fläche des Prozoniten ist dicht chagriniert-mattiert. Die Metazoniten dagegen sind spiegelglatt
wie lackiert und haben einen merklich größeren Durchmesser als die Prozoniten; ihr Durchmesser
ist in der Mitte des Metazoniten am größten. Quernaht ringsum scharf, hinter ihr ein
schmaler Streif durch kurze Längsfurchen wie kreneliert. Ventral sind die Metazoniten regelmäßig
längsgefurcht, die obersten dieser Furchen sind abgekürzt. Saftlöcher winzig, ungefähr
in der Mitte des Metazoniten vom 6. Segment an. Gelbe Pünktchen groß, in einer einzigen, dicht
gedrängten Querreihe.
Dorsalrand des Analsegments hinten fast geradlinig begrenzt, nur ganz leicht bogig. Klappen
stark gewölbt, lateral vom dicken und ziemlich hohen Randwulst eine Furche, medial eine Rille, die
ihn vom feinen Randsaum trennt. Schuppe hinten geradlinig.
Ventralplatten glatt, Stigmengruben klein dreieckig.
Vorletztes Glied der Beine mit spitz vorragendem Sohlenpölster, das sich im letzten Körperviertel
verliert.
Gonopoden (Taf. VI, Fig, 128, 129): Das Lateralblatt des vorderen Gonopoden endet mit
einem schräg nach innen und distal gerichteten breiten Zacken; lateral ein kleines Borstenfeld. MediaL-
blatt am Ende schräg abgestutzt, die Ecken abgerundet. Kein Lateralkonus.
Hinterer Gonopode ohne Coxaldorn; der große querabstehende Dorn (Fig. 129, n) in der
Mitte des schlanken Telopodits kann nicht als Coxaldorn gedeutet werden, sondern als Homolögon
des Femorallappens. Am Ende des Kanalastes ein kleiner, wulstiger Anhang.
Fundort: O s t a f r i k a . (Conradt coll. Berlin. Mus. Cooks Type.)
Das dieser Beschreibung zugrunde liegende Exemplar war von Cook Zonostreptus cerasopus
bezettelt worden. Wenn eine so genannte Art in der Literatur existiert, ist sie .mir entgangen.