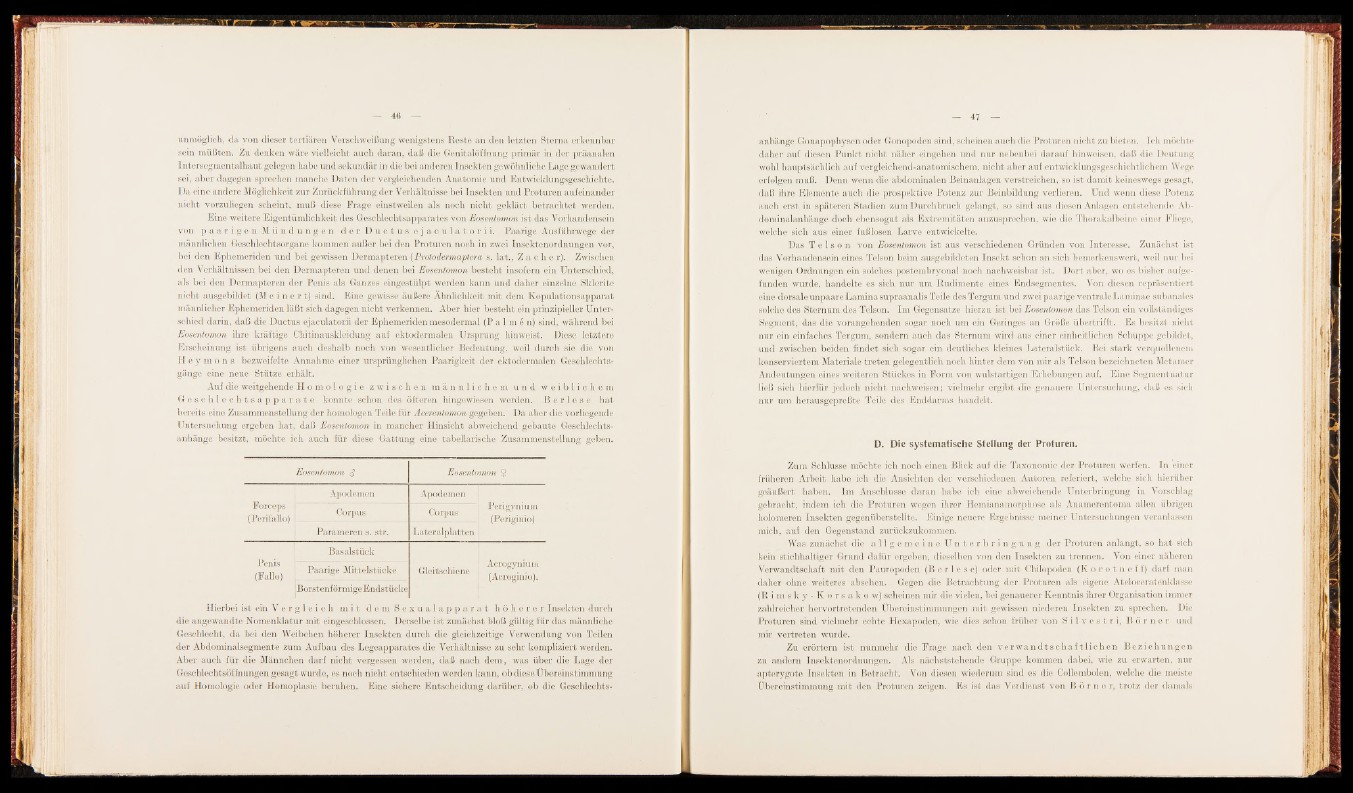
unmöglich, da von dieser tertiären Verschweißung wenigstens Reste an den letzten Sterna erkennbar
sein müßten. Zu denken wäre vielleicht auch daran, daß die Genitalöffnung primär in der präanalen
Intersegmentalhaut gelegen habe und sekundär in die bei anderen Insekten gewöhnliche Lage gewandert
sei, aber dagegen sprechen manche Daten der vergleichenden Anatomie und Entwicklungsgeschichte.
Da eine andere Möglichkeit zur Zurückführung der Verhältnisse bei Insekten und Proturen aufeinander
nicht vorzuliegen scheint, muß diese Frage einstweilen als noch nicht geklärt betrachtet werden.
Eine weitere Eigentümlichkeit des Geschlechtsapparates von Eosentomon ist das Vorhandensein
von p a a r i g e n M ü n d u n g e n d e r D u c t u s e j a c u l a t o r i i . Paarige Ausführwege der
männlichen Geschlechtsorgane kommen außer bei den Proturen noch in zwei Insektenordnungen vor,
bei den Ephemeriden und bei gewissen Dermapteren (Protodermaptera s. lat., Za c h e r ) . Zwischen
den Verhältnissen bei den Dermapteren und denen bei Eosentomon besteht insofern ein Unterschied,
als bei den Dermapteren der Penis als Ganzes eingestülpt werden kann und daher einzelne Sklerite
nicht ausgebildet (M e i n e r t) sind. Eine gewisse äußere Ähnlichkeit mit dem Kopulationsapparat
männlicher Ephemeriden läßt sich dagegen nicht verkennen. Aber hier besteht ein prinzipieller Unterschied
darin, daß die Ductus ejaculatorii der Ephemeriden mesodermal ( Pa l me n ) sind, während bei
Eosentomon ihre kräftige Chitinauskleidung auf ektodermalen Ursprung hinweist. Diese letztere
Erscheinung ist übrigens auch deshalb noch von wesentlicher Bedeutung, weil durch sie die von
H e y m o n s bezweifelte Annahme einer ursprünglichen Paarigkeit der ektodermalen Geschlechtsgänge
eine neue Stütze erhält.
Auf die weitgehende H o m o l o g i e z w i s c h e n m ä n n l i c h e m u n d w e i b l i c h e m
G e s c h l e c h t s a p p a r a t e konnte schon des öfteren hingewiesen werden. B e r 1 e s e hat
bereits eine Zusammenstellung der homologen Teile für Acerentomon gegeben. Da aber die vorliegende
Untersuchung ergeben hat, daß Eosentomon in mancher Hinsicht abweichend gebaute Geschlechtsanhänge
besitzt, möchte ich auch für diese Gattung eine tabellarische Zusammenstellung geben.
Eosentomon $ Eosentomon ?
Forceps
(Perifallo)
Apodemen
Corpus
Parameren s. str.
Apodemen
Corpus
Lateralplatten
Perigynium
(Periginio)
Penis
(Fallo)
Basalstück
Paarige Mittelstücke Gleitschiene
Acrogynium
(Acroginio).
Borstenförmige Endstücke
Hierbei ist ein V e r g l e i c h m i t d em S e x u a l a p p a r a t h ö h e r e r Insekten durch
die angewandte Nomenklatur mit eingeschlossen. Derselbe ist zunächst bloß gültig für das männliche
Geschlecht, da bei den Weibchen höherer Insekten durch die gleichzeitige Verwendung von Teilen
der Abdominalsegmente zum Aufbau des Legeapparates die Verhältnisse zu sehr kompliziert werden.
Aber auch für die Männchen darf nicht vergessen werden, daß nach dem, was über die Lage der
Geschlechtsöffnungen gesagt wurde, es noch nicht entschieden werden kann, ob diese Übereinstimmung
auf Homologie oder Homoplasie beruhen. Eine sichere Entscheidung darüber, ob die Geschlechtsanhänge
Gonapophysen oder Gonopoden sind, scheinen auch die Proturen nicht zu bieten. Ich möchte
daher auf diesen Punkt nicht näher eingehen und nur nebenbei darauf hinweisen, daß die Deutung
wohl hauptsächlich auf vergleichend-anatomischem, nicht aber auf entwicklungsgeschichtlichem Wege
erfolgen muß. Denn wenn die abdominalen Beinanlagen verstreichen, so ist damit keineswegs gesagt,
daß ihre Elemente auch die prospektive Potenz zur Beinbildung verlieren. Und wenn diese Potenz
auch erst in späteren Stadien zum Durchbruch gelangt, so sind aus diesen Anlagen entstehende Abdominalanhänge
doch ebensogut als Extremitäten anzusprechen, wie die Thorakalbeine einer Fliege,
welche sich aus einer fußlosen Larve entwickelte.
Das T e 1 s o n von Eosentomon ist aus verschiedenen Gründen von Interesse. Zunächst ist
das Vorhandensein eines Telson beim ausgebildeten Insekt schon an sich bemerkenswert, weil nur bei
wenigen Ordnungen ein solches postembryonal noch nachweisbar ist. Dort aber, wo es bisher aufgefunden
wurde, handelte es sich nur um Rudimente eines Endsegmentes. Von diesen repräsentiert
eine dorsale unpaare Lamina supraanalis Teile des Tergum und zwei paarige ventrale Laminae subanales
solche des Sternum des Telson. Im Gegensätze hierzu ist bei Eosentomon das Telson ein vollständiges
Segment, das die vorangehenden sogar noch um ein Geringes an Größe übertrifft. Es besitzt nicht
nur ein einfaches Tergum, sondern auch das Sternum wird aus einer einheitlichen Schuppe gebildet,
und zwischen beiden findet sich sogar ein deutliches kleines Lateralstück. Bei stark verquollenem
konserviertem Materiale treten gelegentlich noch hinter dem von mir als Telson bezeichneten Metamer
Andeutungen eines weiteren Stückes in Form von wulstartigen Erhebungen auf. Eine Segmentnatur
ließ sich hierfür jedoch nicht nachweisen; vielmehr ergibt die genauere Untersuchung, daß es sich
nur um herausgepreßte Teile des Enddarms handelt.
D. Die systematische Stellung der Proturen.
Zum Schlüsse möchte ich noch einen Blick auf die Taxonomie der Proturen werfen. In einer
früheren Arbeit habe ich die Ansichten der verschiedenen Autoren referiert, welche sich hierüber
geäußert haben. Im Anschlüsse daran habe ich eine abweichende Unterbringung in Vorschlag
gebracht, indem ich die Proturen wegen ihrer Hemianamorphose als Anamerentoma allen übrigen
holomeren Insekten gegenüberstellte. Einige neuere Ergebnisse meiner Untersuchungen veranlassen
mich, auf den Gegenstand zurückzukommen.
Was zunächst die a l l g e m e i n e U n t e r b r i n g u n g der Proturen anlangt, so hat sich
kein stichhaltiger Grund dafür ergeben, dieselben von den Insekten zu trennen. Von einer näheren
Verwandtschaft mit den Pauropoden (B e r 1 e s e) oder mit Chilopoden (K o r o t n e f f) darf man
daher ohne weiteres absehen. Gegen die Betrachtung der Proturen als eigene Ateloceratenklasse
(R i m s k y - K o r s a k o w) scheinen mir die vielen, bei genauerer Kenntnis ihrer Organisation immer
zahlreicher hervortretenden Übereinstimmungen mit gewissen niederen Insekten zu sprechen. Die
Proturen sind vielmehr echte Hexapoden, wie dies schon früher von S i l v e s t r i , B ö r n e r und
mir vertreten wurde.
Zu erörtern ist nunmehr die Frage nach den ve rwan dt s c ha f t l i chen Bezi ehungen
zu ändern Insektenordnungen. Als nächststehende Gruppe kommen dabei, wie zu erwarten, nur
apterygote Insekten in Betracht. Von diesen wiederum sind es die Collembolen, welche die meiste
Übereinstimmung mit den Proturen zeigen. Es ist das Verdienst von B ö r n e r , trotz der damals