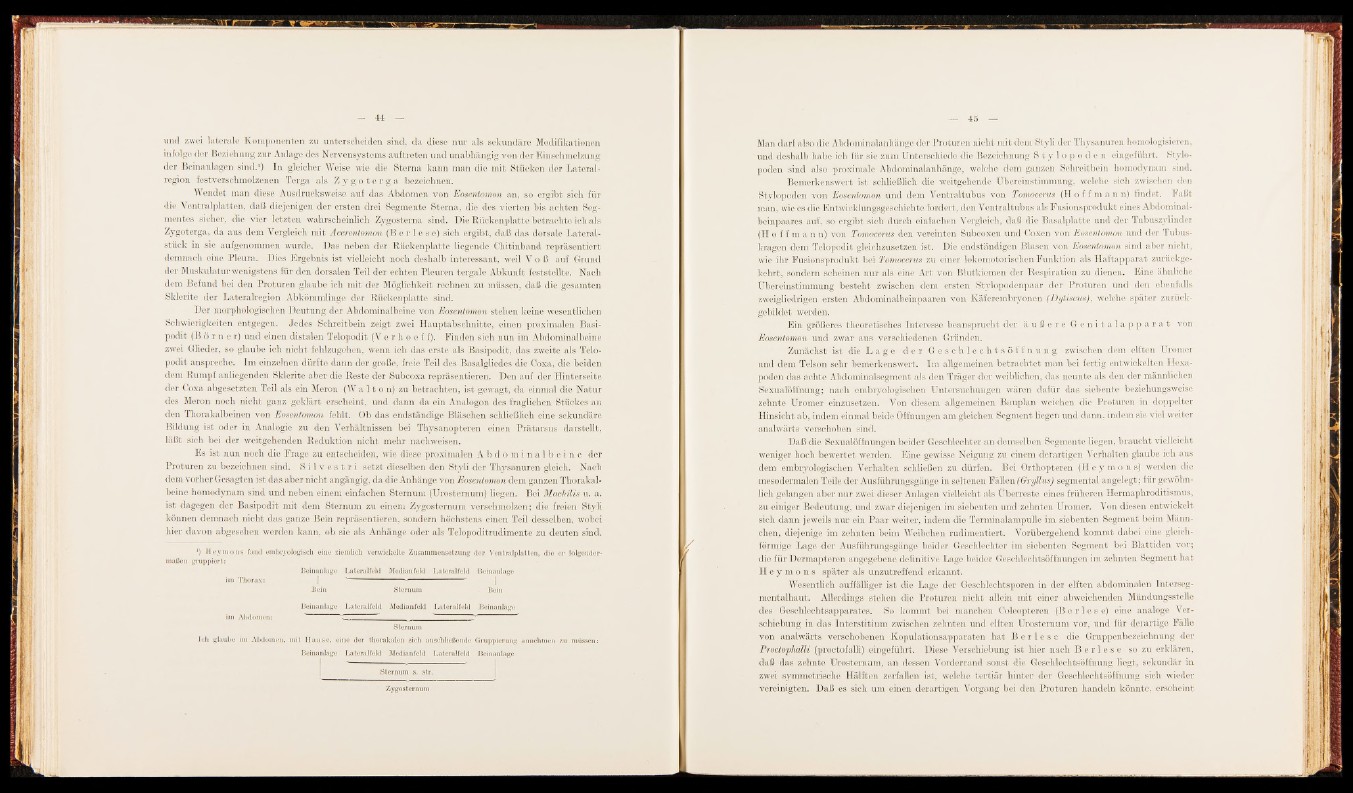
und zwei laterale Komponenten zu unterscheiden sind, da diese nur als sekundäre Modifikationen
infolge der Beziehung zur Anlage des Nervensystems auftreten und unabhängig von der Einschmelzung
der Beinanlagen sind.1) In gleicher Weise wie die Sterna kann man die mit Stücken der Lateralregion
festverschmolzenen Terga als Z y g o t e r g a bezeichnen.
Wendet man diese Ausdrucksweise auf das Abdomen von Eosentomon an, so ergibt sich für
die Ventralplatten, daß diejenigen der ersten drei Segmente Sterna, die des vierten bis achten Segmentes
sicher, die vier letzten wahrscheinlich Zygosterna sind. Die Bückenplatte betrachte ich als
Zygoterga, da aus dem Vergleich mit A c e ren tom o n (B e r 1 e s e) sich ergibt, daß das dorsale Lateralstück
in sie aufgenommen wurde. Das neben der Bückenplatte liegende Chitinband repräsentiert
demnach eine Pleura. Dies Ergebnis ist vielleicht noch deshalb interessant, weil V o ß auf Grund
der Muskulatur wenigstens für den dorsalen Teil der echten Pleuren tergale Abkunft feststellte. Nach
dem Befund bei den Proturen glaube ich mit der Möglichkeit rechnen zu müssen, daß die gesamten
Sklerite der Lateralregion Abkömmlinge der Rückenplatte sind.
Der morphologischen Deutung der Abdominalbeine von Eosentomon stehen keine wesentlichen
Schwierigkeiten entgegen. Jedes Schreitbein zeigt zwei Hauptabschnitte, einen proximalen Basi-
podit ( Bö r n e r ) und einen distalen Telopodit (V e r h o e f f). Finden sich nun im Abdominalbeine
zwei Glieder, so glaube ich nicht fehlzugehen, wenn ich das erste als Basipodit, das zweite als Telopodit
anspreche. Im einzelnen dürfte dann der große, freie Teil des Basalgliedes die Coxa, die beiden
dem Rumpf anliegenden Sklerite aber die Reste der Subcoxa repräsentieren. Den auf der Hinterseite
der Coxa abgesetzten Teil als ein Meron (W a 11 o n) zu betrachten, ist gewagt, da einmal die Natur
des Meron noch nicht ganz geklärt erscheint, und dann da ein Analogon des fraglichen Stückes an
den Thorakalbeinen von Eosentomon fehlt. Ob das endständige Bläschen schließlich eine sekundäre
Bildung ist oder in Analogie zu den Verhältnissen bei Thysanopteren einen Prätarsus darstellt,
läßt sich bei der weitgehenden Reduktion nicht mehr nachweisen.
Es ist nun noch die Frage zu entscheiden, wie diese proximalen A b d o m i n a l b e i n e der
Proturen zu bezeichnen sind. S i l v e s t r i setzt dieselben den Styli der Thysänuren gleich. Nach
dem vorher Gesagten ist das aber nicht angängig, da die Anhänge von Eosentomon dem ganzen Thorakalbeine
homodynam sind und neben einem einfachen Sternum (Urostemum) liegen. Bei M a cJn lis u. a.
ist dagegen der Basipodit mit dem Sternum zu einem Zygosternum verschmolzen; die freien Styli
können demnach nicht das ganze Bein repräsentieren, sondern höchstens einen Teil desselben, wobei
hier davon abgesehen werden kann, ob sie als Anhänge oder als Telopoditrudimente zu deuten sind.
J) H e y m o n s fand embryologisch eine ziemlich verwickelte Zusammensetzung der Ventralplatten, die er folgendermaßen
gruppiert:
Beinanlage Lateralfeld Medianfeld Lateralfeld Beinanlage
im Thorax: |: ' ------------------------------------- j |
Bein Sternum . Bein
Beinanlage Lateralfeld Medianfeld Lateralfeld Beinanlage
im Abdomen: " ^__ .v
Sternum
Ich glaube im Abdomen, m it PI a a s e , eine der thorakalen sich anschließende Gruppierung annehmen zu müssen:
Beinanlage Lateralfeld Medianfeld Lateralfeld Beinanlage
. ■
Sternum &. str.
Zygoster:
Man darf also die Abdominalanhänge der Proturen nicht mit dem Styli der Thysänuren homologisieren,
und deshalb habe ich für sie zum Unterschiede die Bezeichnung S t y l o p o d e n eingeführt. Stylopoden
sind also proximale Abdominalanhänge, welche dem ganzen Schreitbein homodynam sind.
Bemerkenswert ist schließlich die weitgehende Übereinstimmung, welche sich zwischen den
Stylopoden von Eosentomon und dem Ventraltubus von Tomocerus (H o f f m a n n) findet. Faßt
man, wie es die Entwicklungsgeschichte fordert, den Ventraltubus als Fusionsprodukt eines Abdominalbeinpaares
auf, so ergibt sich durch, einfachen Vergleich, daß die Basalplatte und der Tubuszylinder
(H o f f m a n n) von Tomocerus den vereinten Subcoxen und Coxen von Eosentomon und der Tubuskragen
dem Telopodit gleichzusetzen ist. Die endständigen Blasen von Eosentomon sind aber nicht,
wie ihr Fusionsprodukt bei Tomocerus zu einer lokomotorischen Funktion als Haftapparat zurückger
kehrt, sondern scheinen nur als eine Art von Blutkiemen der Respiration zu dienen. Eine ähnliche
Übereinstimmung besteht zwischen dem ersten Stylopodenpaar der Proturen und den ebenfalls
zweigliedrigen ersten Abdominalbeinpaaren von Käferembryonen (Dytiscus), welche später zurückgebildet
werden.
Ein größeres theoretisches Interesse beansprucht der ä u ß e r e G e n i t a l a p p a r a t von
Eosentomon und zwar aus verschiedenen Gründen.
Zunächst ist die L a g e d e r G e s c h l e c h t s ö f f n u n g zwischen dem elften Uromer
und dem Telson sehr bemerkenswert. Im allgemeinen betrachtet man bei fertig entwickelten Hexa-
poden das achte Abdominalsegment als den Träger der weiblichen, das neunte als den der männlichen
Sexualöffnung; nach embryologischen Untersuchungen wären dafür das siebente beziehungsweise
zehnte Uromer einzusetzen. Von diesem allgemeinen Bauplan weichen die Proturen in doppelter
Hinsicht ab, indem einmal beide Öffnungen am gleichen Segment liegen und dann, indem sie viel weiter
analwärts verschoben sind.
Daß die Sexualöffnungen beider Geschlechter an demselben Segmente liegen, braucht vielleicht
weniger hoch bewertet werden. Eine gewisse Neigung zu einem derartigen Verhalten glaube ich aus
dem embryologischen Verhalten schließen zu dürfen. Bei Orthopteren ( H ey mo n s ) werden die
mesodermalen Teile der Ausführungsgänge in seltenen Fällen (Gryllus) segmental angelegt; für gewöhnlich
gelangen aber nur zwei dieser Anlagen vielleicht als Überreste eines früheren Hermaphroditismus,
zu einiger Bedeutung, und zwar diejenigen im siebenten und zehnten Uromer. Von diesen entwickelt
sich dann jeweils nur ein Paar weiter, indem die Terminalampulle im siebenten Segment beim Männchen,
diejenige im zehnten beim Weibchen rudimentiert. Vorübergehend kommt dabei eine gleichförmige
Lage der Ausführungsgänge beider Geschlechter im siebenten Segment bei Blattiden vor;
die für Dermapteren angegebene definitive Lage beider Geschlechtsöffnungen im zehnten Segment hat
H e y m o n s später als unzutreffend erkannt.
Wesentlich auffälliger ist die Lage der Geschlechtsporen in der elften abdominalen Interseg-
mentalhaut. Allerdings stehen die Proturen nicht allein mit einer abweichenden Mündungsstelle
des Geschlechtsapparates. So kommt bei manchen Coleopteren (B e r 1 e s e) eine analoge Verschiebung
in das Interstitium zwischen zehnten und elften Urosternum vor, und für derartige Fälle
von analwärts verschobenen Kopulationsapparaten hat B e r 1 e s e die Gruppenbezeichnung der
Proctophalli (proctofalli) eingeführt. Diese Verschiebung ist hier nach B e r l e s e so zu erklären,
daß das zehnte Urosternum, an dessen Vorderrand sonst die Geschlechtsöffnung liegt, sekundär in
zwei symmetrische Hälften zerfallen ist, welche tertiär hinter der Geschlechtsöffnung sich wieder
vereinigten. Daß es sich um einen derartigen Vorgang bei den Proturen handeln könnte, erscheint