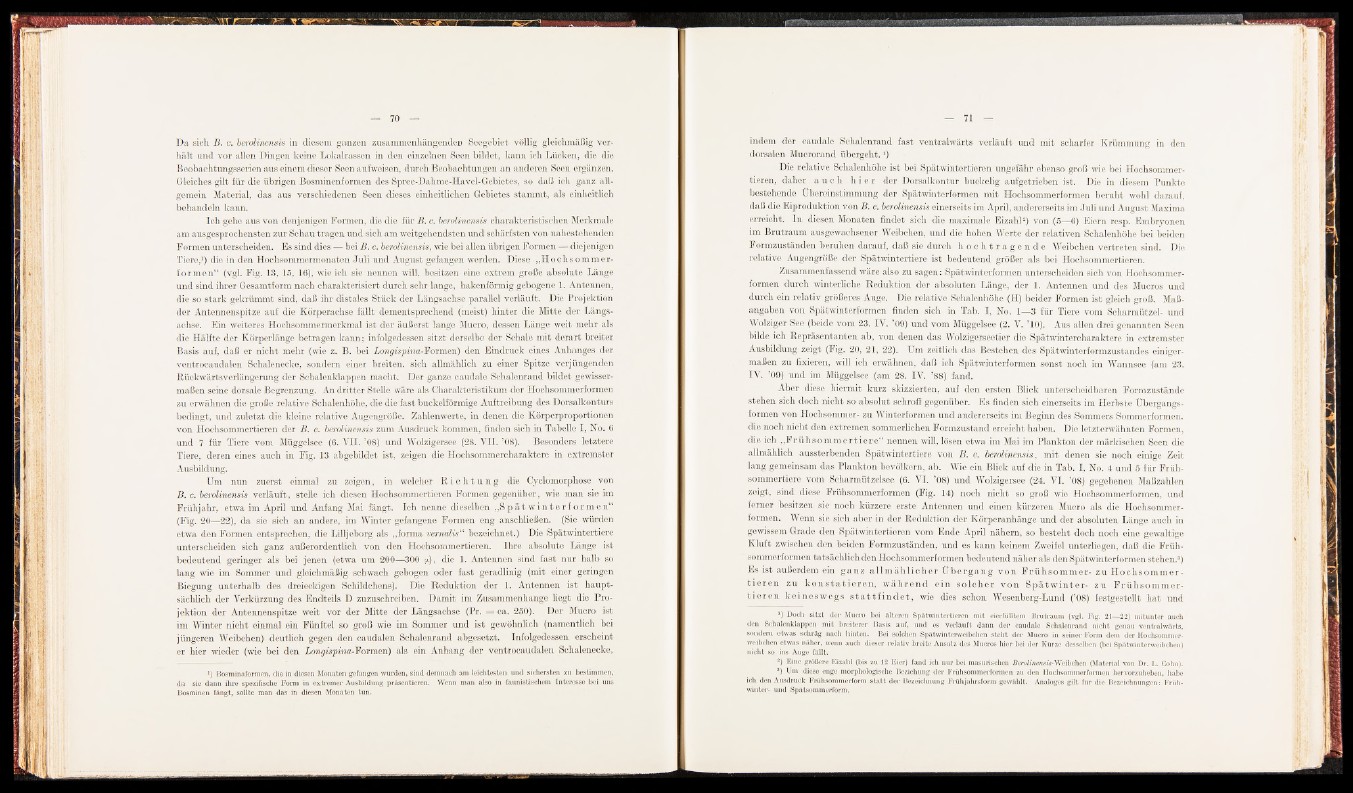
Da sich B. c. berolinensis in diesem ganzen zusammenhängenden Seegebiet völlig gleichmäßig verhält
und vor allen Dingen keine Lokalrassen in den einzelnen Seen bildet, kann ich Lücken, die die
Beobachtungsserien aus einem dieser Seen aufweisen, durch Beobachtungen an anderen Seen ergänzen.
Gleiches gilt für die übrigen Bosminenformen des Spree-Dahme-Havel-Gebietes, so daß ich ganz allgemein
Material, das aus verschiedenen Seen dieses einheitlichen Gebietes stammt, als einheitlich
behandeln kann.
Ich gehe aus von denjenigen Formen, die die für B. c. berolinensis charakteristischen Merkmale
am ausgesprochensten zur Schau tragen und sich am weitgehendsten und schärfsten von nahestehenden
Formen unterscheiden. Es sind dies — bei B. c. berolinensis, wie bei allen übrigen Formen — diejenigen
Tiere,1) die in den Hochsommermonaten Juli und August gefangen werden. Diese „H o c h som m e rfo
rm e n “ (vgl. Fig. 13, 15, 16), wie ich sie nennen will, besitzen eine extrem große absolute Länge
und sind ihrer Gesamtform nach charakterisiert durch sehr lange, hakenförmig gebogene 1. Antennen,
die so stark gekrümmt sind, daß ihr distales Stück der Längsachse parallel verläuft. Die Projektion
der Antennenspitze auf die Körperachse fällt dementsprechend (meist) hinter die Mitte der Längsachse.
Ein weiteres Hochsommermerkmal ist der äußerst lange Mucro, dessen Länge weit mehr als
die Hälfte der Körperlänge betragen kann; infolgedessen sitzt derselbe der Schale mit derart breiter
Basis auf, daß er nicht mehr (wie z. B. bei Longispina-’Foimen) den Eindruck eines Anhanges der
ventrocaudalen Schalenecke, sondern einer breiten, sich allmählich zu einer Spitze verjüngenden
Rückwärtsverlängerung der Schalenklappen macht. Der ganze caudale Schalenrand bildet gewissermaßen
seine dorsale Begrenzung. An dritter Stelle wäre als Charakteristikum der Hochsommerformen
zu erwähnen die große relative Schalenhöhe, die die fast buckelförmige Auftreibung des Dorsalkonturs
bedingt, und zuletzt die kleine relative Augengröße. Zahlenwerte, in denen die Körperproportionen
von Hochsommertieren der B. c. berolinensis zum Ausdruck kommen, finden sich in Tabelle I, No. 6
und 7 für Tiere vom Müggelsee (6. VII. ’08) und Wolzigersee (28. VII. ’08). Besonders letztere
Tiere, deren eines auch in Fig. 13 abgebildet ist, zeigen die Hochsommercharaktere in extremster
Ausbildung.
Um nun zuerst einmal zu zeigen, in welcher R i c h t u n g die Cyclomorphose von
B. c. berolinensis verläuft, stelle ich diesen Hochsommertieren Formen gegenüber, wie man sie im
Frühjahr, etwa im April und Anfang Mai fängt. Ich nenne dieselben „ S p ä tw i n t e r f o rm e n “
(Fig. 20—22), da sie sich an andere, im Winter gefangene Formen eng anschließen. (Sie würden
etwa den Formen entsprechen, die Lilljeborg als „forma vernalisu bezeichnet.) Die Spätwintertiere
unterscheiden sich ganz außerordentlich von den Hochsommertieren. Ihre absolute Länge ist
bedeutend geringer als bei jenen (etwa um 200—300 ¡j.) , die 1. Antennen sind fast nur halb so
lang wie im Sommer und gleichmäßig schwach gebogen oder fast geradlinig (mit einer geringen
Biegung unterhalb des dreieckigen Schildchens). Die Reduktion der 1. Antennen ist hauptsächlich
der Verkürzung des Endteils D zuzuschreiben. Damit im Zusammenhänge liegt die Projektion
der Antennenspitze weit vor der Mitte der Längsachse (Pr. = ca. 250). Der Mucro ist
im Winter nicht einmal ein Fünftel so groß wie im Sommer und ist gewöhnlich (namentlich bei
jüngeren Weibchen) deutlich gegen den caudalen Schalenrand abgesetzt. Infolgedessen erscheint
er hier wieder (wie bei den Longispina-¥ormen) als ein Anhang der ventrocaudalen Schalenecke,
*) Bosminaformen, die in diesen Monaten gefangen wurden, sind demnach am leichtesten und sichersten zu bestimmen,
d a sie dann ihre spezifische Form in extremer Ausbildung präsentieren. Wenn man also in faunistischem Interesse bei uns
Bosminen fängt, sollte man das in diesen Monaten tun.
indem der caudale Schalenrand fast ventralwärts verläuft und mit scharfer Krümmung in den
dorsalen Mucrorand übergeht.x)
Die relative Schalenhöhe ist bei Spätwintertieren ungefähr ebenso groß wie bei Hochsommertieren,
daher a u c h h i e r der Dorsalkontur buckelig aufgetrieben ist. Die in diesem Punkte
bestehende Übereinstimmung der Spätwinterformen mit Hochsommerformen beruht wohl darauf,
daß die Eiproduktion von B. c. berolinensis einerseits im April, andererseits im Juli und August Maxima
erreicht. In diesen Monaten findet sich die maximale Eizahl2) von (5—6) Eiern resp. Embryonen
im Brutraum ausgewachsener Weibchen, und die hohen Werte der relativen Schalenhöhe bei beiden
Formzuständen beruhen darauf, daß sie durch h o c h t r a g e n d e Weibchen vertreten sind. Die
relative Augengröße der Spätwintertiere ist bedeutend größer als bei Hochsommertieren.
Zusammenfasaend wäre also zu sagen: Spätwinterformen unterscheiden sich von Hochsommerformen
durch winterliche Reduktion der absoluten Länge, der 1. Antennen und des Mucros und
durch ein relativ größeres Auge. Die relative Schalenhöhe (H) beider Formen ist gleich groß. Maßangaben
von Spätwinterformen finden sich in Tab. I, No. 1—3 für Tiere vom Scharmützel- und
Wolziger See (beide vom 23. IV. ’09) und vom Müggelsee (2. V. ’10). Aus allen drei genannten Seen
bilde ich Repräsentanten ab, von denen das Wolzigerseetier die Spätwintercharaktere in extremster
Ausbildung zeigt (Fig. 20, 21, 22). Um zeitlich das Bestehen des Spätwinterformzustandes einigermaßen
zu fixieren, will ich erwähnen, daß ich Spätwinterformen sonst noch im Wannsee (am 23.
IV. ’09) und im Müggelsee (am 28. IV. ’88) fand.
Aber diese hiermit kurz skizzierten, auf den ersten Blick unterscheidbaren Formzustände
stehen sich doch nicht so absolut schroff gegenüber. Es finden sich einerseits im Herbste Übergangsformen
von Hochsommer- zu Winterformen und andererseits im Beginn des Sommers Sommerformen,
die noch nicht den extremen sommerlichen Formzustand erreicht haben. Die letzterwähnten Formen,
die ich „Fr ü h s omme r t i e r e “ nennen will, lösen etwa im Mai im Plankton der märkischen Seen die
allmählich aussterbenden • Spätwintertiere von B. c. berolinensis, mit denen sie noch einige Zeit
lang gemeinsam das Plankton bevölkern, ab. Wie ein Blick auf die in Tab. I, No. 4 und 5 für Frühsommertiere
vom Scharmützelsee (6. VI. ’08) und Wolzigersee (24. VI. ’08) gegebenen Maßzahlen
zeigt, sind diese Frühsommerformen (Fig. 14) noch nicht so groß wie Hochsommerformen, und
ferner besitzen sie noch kürzere erste Antennen und einen kürzeren Mucro als die Hochsommerformen.
Wenn sie sich aber in der Reduktion der Körperanhänge und der absoluten Länge auch in
gewissem Grade den Spätwintertieren vom Ende April nähern, so besteht doch noch eine gewaltige
Kluft zwischen den beiden Formzuständen, und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Früh-
sömmerformen tatsächlich den Hochsommerformen bedeutend näher als den Spätwinterformen stehen.3)
Es ist außerdem ein ganz a llm ä h l i c h e r Übe rgan g von Frühsommer- zu Ho c h s omme r t
i e r en zu k o n s t a t i e r e n , wä h r e n d ein so lcher von Spätwin t e r - zu Frü h s omme r t
i e r e n keineswegs s t a t t f i n d e t , wie dies schon Wesenberg-Lund (’08) festgestellt hat und
0 Doch s itz t der Mucro bei älteren Spätwintertieren m it eierfülltem Brutraum (vgl. Fig. 21—22) mitunter auch
den Schalenklappen m it breiterer Basis auf, und es verläuft dann der caudale Schalenrand nich t genau ventralwärts,
sondern etwas schräg nach hinten. Bei solchen Spätwinterweibchen s te h t der Mucro in seiner Form dem der Hochsommerweibchen
etwas näher, wenn auch dieser relativ breite Ansatz des Mucros hier bei d er Kürze desselben (bei Spätwinterweibchen)
nich t so ins Auge fällt.
*) Eine größere Eizahl (bis zu 12 Eier) fand ich n u r bei masurischen .Beroh’nens fs-Weibchen (Material von Dr. L. Cohn).
3) Um diese enge morphologische Beziehung der Frühsommerformen zu den Hochsommerformen hervorzuheben, habe
ich den Ausdruck Frühsommerform s ta t t der Bezeichnung Frühjahrsform gewählt. Analoges gilt für die Bezeichnungen: F rü h winter
und Spätsommerform.