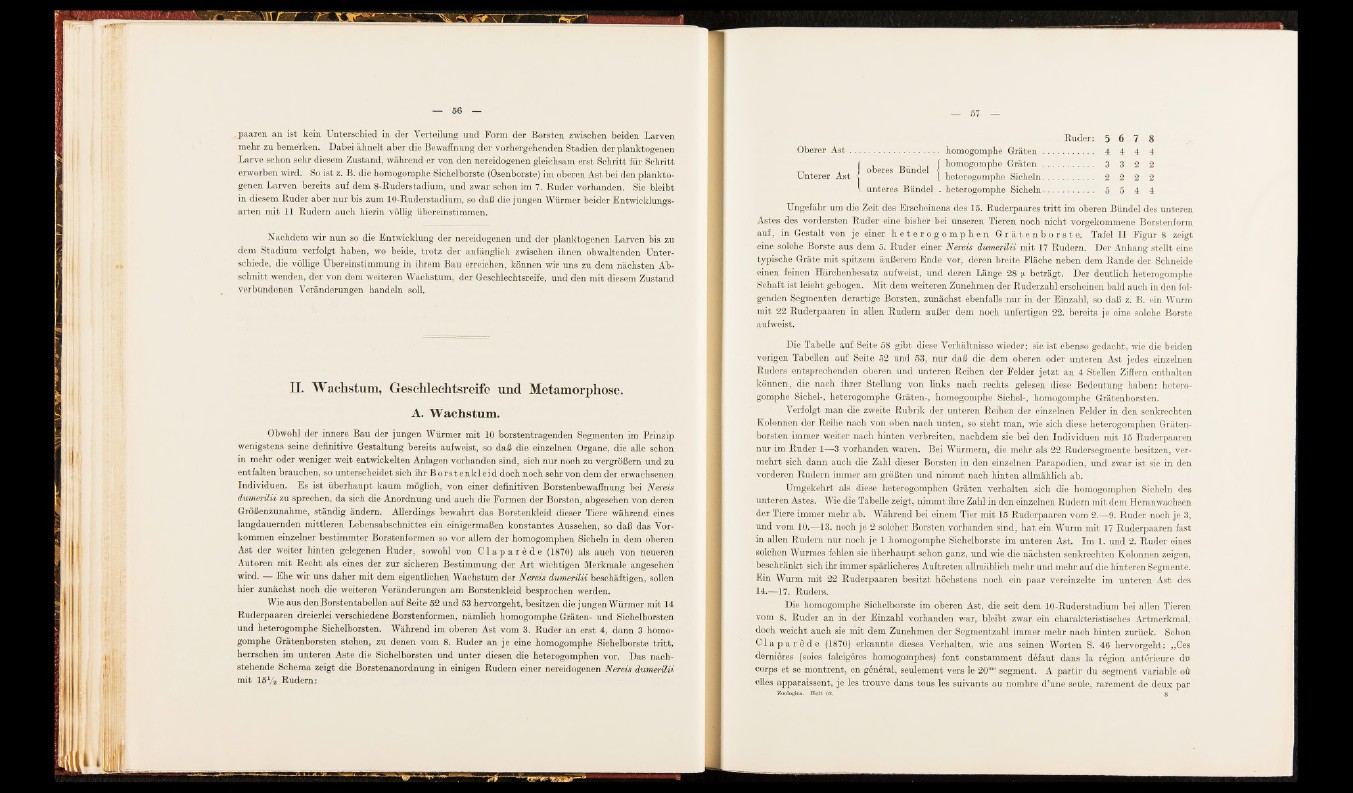
.paaren an ist kein Unterschied in der Verteilung und Form der Borsten zwischen beiden Larven
mehr zu bemerken. Dabei ähnelt aber die Bewaffnung der vorhergehenden Stadien der planktogenen.
Larve schon sehr diesem Zustand, während er von den nereidogenen gleichsam erst Schritt für Schritt;
erworben wird. So ist z. B. die homogomphe Sichelborste (Ösenborste) im oberen Ast bei den planktogenen
Larven bereits auf dem 8-Buderstadium, und zwar schon im 7. Euder vorhanden. Sie bleibt
in diesem Ruder aber nur bis zum 10-Ruderstadium, so daß die jungen Würmer beider Entwicklungsarten
mit 11 Rudern auch hierin völlig übereinstimmen.
Nachdem wir nun so die Entwicklung der nereidogenen und der planktogenen Larven bis zu
dem Stadium verfolgt haben, wo beide, trotz der anfänglich zwischen ihnen obwaltenden Unterschiede,
die völlige Übereinstimmung in ihrem Bau erreichen, können wir uns zu dem nächsten Abschnitt
wenden, der von dem weiteren Wachstum, der Geschlechtsreife, und den mit diesem Zustanjä
verbundenen Veränderungen handeln soll.
II. Wachstum, Geschlechtsreife und Metamorphose.
A. Wachstum.
Obwohl der innere Bau der jungen Würmer mit 10 borstentragenden Segmenten im Prinzip
wenigstens seine definitive Gestaltung bereits aufweist, so daß die einzelnen Organe, die alle schon
in mehr oder weniger weit entwickelten Anlagen vorhanden sind, sich nur noch zu vergrößern und zu
entfalten brauchen, so unterscheidet sich ihr Borst en k l e i d doch noch sehr von dem der erwachsenen
Individuen. Es ist überhaupt kaum möglich, von einer definitiven Borstenbewaffnung bei Nereis
dumerüii zu sprechen, da sich die Anordnung und auch die Formen der Borsten, abgesehen von deren
Größenzunahme, ständig ändern. Allerdings bewahrt das Borstenkleid dieser Tiere während eines
langdauernden mittleren Lebensabschnittes ein einigermaßen konstantes Aussehen, so daß das Vorkommen
einzelner bestimmter Borstenformen so vor allem der homogomphen Sicheln in dem oberen
Ast der weiter hinten gelegenen Ruder, sowohl von C l a p a r e d e (1870) als auch von neueren
Autoren mit Recht als eines der zur sicheren Bestimmung der Art wichtigen Merkmale angesehen
wird. — Ehe wir uns daher mit dem eigentlichen Wachstum der Nereis dumerüii beschäftigen, sollen
hier zunächst noch die weiteren Veränderungen am Borstenkleid besprochen werden.
Wie aus den Borstentabellen auf Seite 52 und 53 hervorgeht, besitzen die jungen Würmer mit 14
Ruderpaaren dreierlei verschiedene Borstenformen, nämlich homogomphe Gräten- und Sichelborsten
und heterogomphe Sichelborsten. Während im oberen Ast vom 3. Ruder an erst 4, dann 3 homogomphe
Grätenborsten stehen, zu denen vom 8. Ruder an je eine homogomphe Sichelborste tritt,
herrschen im unteren Aste die Sichelborsten und unter diesen die heterogomphen vor. Das nachstehende
Schema zeigt die Borstenanordnung in einigen Rudern einer nereidogenen Nereis dumerilii
mit I5V2 Rudern:
Ruder: 5 6 7 8
Oberer A s t.................................... homogomphe G rä te n ...................... 4 4 4 4
( -l t» i i i homogomphe Gräten t t j. * . I oberes Bündel ■ ■ r _ HÊÊÊSÊ ............. 3 3 2 2 unterer Ast ( heterogomphe Sicheln....................... 2 2 2 2
v unteres Bündel . heterogomphe Sicheln....................... 5 5 4 4
Ungefähr um die Zeit des Erscheinens des 15. Ruderpaares tritt im oberen Bündel des unteren
Astes des vordersten Ruder eine bisher bei unseren Tieren noch nicht vorgekommene Borstenform
auf, in Gestalt von je einer h e t e r o g o m p h e n G r ä t e n b o r s t e . Tafel I I Figur 8 zeigt
eine solche Borste aus dem 5. Ruder einer Nereis dumerüii mit 17 Rudern. Der Anhang stellt eine
typische Gräte mit spitzem äußerem Ende vor, deren breite Fläche neben dem Rande der Schneide
einen feinen Härchenbesatz auf weist, und deren Länge 28 beträgt. Der deutlich heterogomphe
Schaft ist leicht gebogen. Mit dem weiteren Zunehmen der Ruderzahl erscheinen bald auch in den folgenden
Segmenten derartige Borsten, zunächst ebenfalls nur in der Einzahl, so daß z. B. ein Wurm
mit 22 Ruderpaaren in allen Rudern außer dem noch unfertigen 22. bereits je eine solche Borste
aufweist.
Die Tabelle auf Seite 58 gibt diese Verhältnisse wieder; sie ist ebenso gedacht, wie die beiden
vorigen Tabellen auf Seite 52 und 53, nur daß die dem oberen oder unteren Ast jedes einzelnen
Ruders entsprechenden oberen und unteren Reihen der Felder jetzt an 4 Stellen Ziffern enthalten
können, die. nach ihrer Stellung von links nach rechts gelesen diese Bedeutung haben: heterogomphe
Sichel-, heterogomphe Gräten-, homogomphe Sichel-, homogomphe Grätenborsten.
Verfolgt man die zweite Rubrik der unteren Reihen der einzelnen Felder in den senkrechten
Kolonnen der Reihe nach von oben nach unten, so sieht man, wie sich diese heterogomphen Grätenborsten
immer weiter nach hinten verbreiten, nachdem sie bei den Individuen mit 15 Ruderpaaren
nur im Ruder 1—3 vorhanden waren. Bei Würmern, die mehr als 22 Rudersegmente besitzen, vermehrt
sich dann auch die Zahl dieser Borsten in den einzelnen Parapodien, und zwar ist sie in den
vorderen Rudern immer am größten und nimmt nach hinten allmählich ab.
Umgekehrt als diese heterogomphen Gräten verhalten sich die homogompheu Sicheln des
unteren Astes. Wie die Tabelle zeigt, nimmt ihre Zahl in den einzelnen Rudern mit dem Heranwachsen
der Tiere immer mehr ab. Während bei einem Tier mit 15 Ruderpaaren vom 2 .-9 . Ruder noch je 3,
und vorn 10.—13. noch je 2 solcher Borsten vorhanden sind, hat ein Wurm mit 17 Ruderpaaren fast
in allen Rudern nur noch je 1 homogomphe Sichelbörste im unteren Ast. Im 1. und 2. Ruder eines
solchen Wurmes fehlen sie überhaupt schon ganz, und wie die nächsten senkrechten Kolonnen zeigen,
beschränkt sich ihr immer spärlicheres Auftreten allmählich mehr und mehr auf die hinteren Segmente.
Ein Wurm mit 22 Ruderpaaren besitzt höchstens noch ein paar vereinzelte im unteren Ast des
14.—17. Ruders.
Die homogomphe Sichelborste im oberen Ast, die seit dem 10-Ruderstadium bei allen Tieren
vom 8. Ruder an in der Einzahl vorhanden war, bleibt zwar ein charakteristisches Artmerkmal,
doch weicht auch sie mit dem Zunehmen der Segmentzahl immer mehr nach hinten zurück. Schon
C l a p a r è d e (1870) erkannte dieses Verhalten, wie aus seinen Worten S. 46 hervorgeht: „Ces
dernières (soies falcigères homogomphes) font constamment défaut dans la région antérieure du
corps et se montrent, en général, seulement vers le 20me segment. A partir du segment variable où
elles apparaissent, je les trouve dans tous les suivants au nombre d’une seule, rarement de deux par
Zoologica. H e ft 62. g