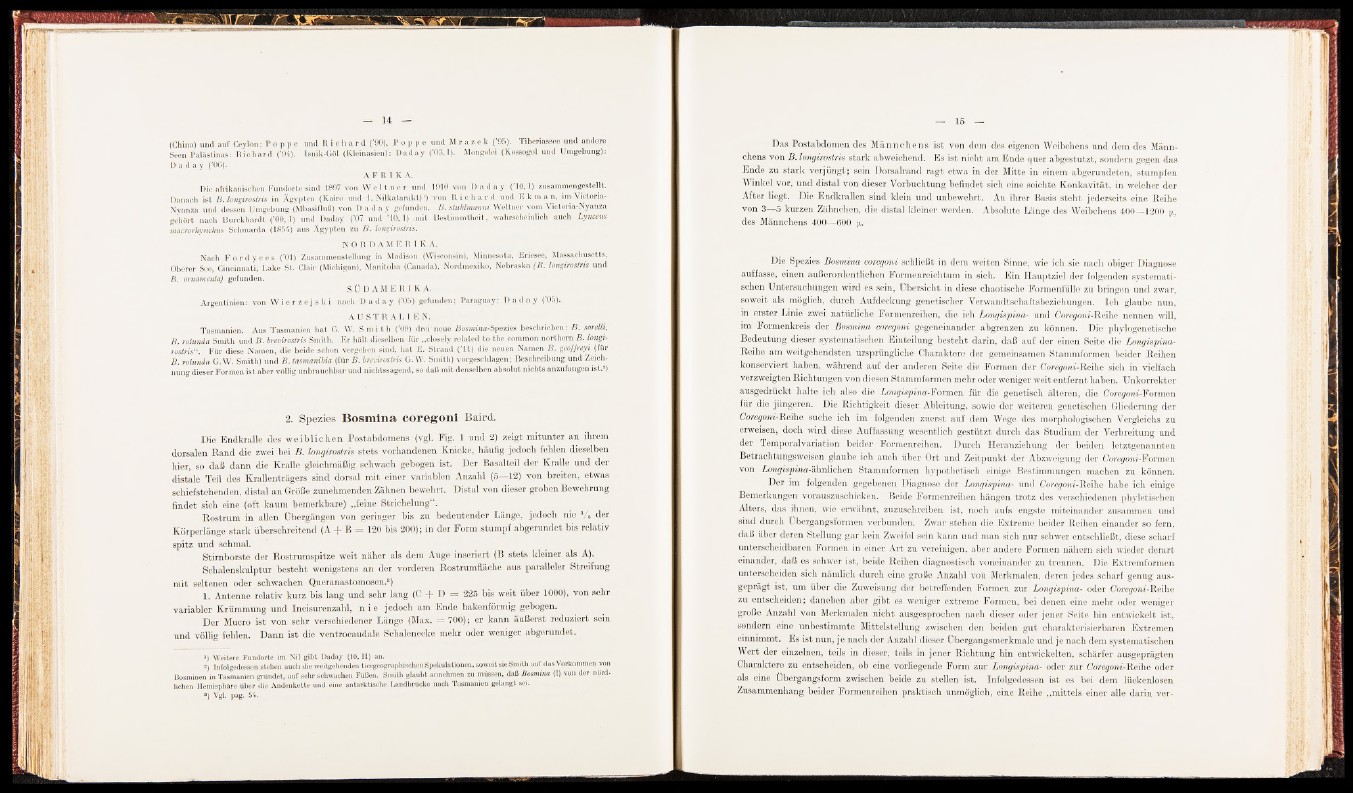
(China) und auf Ceylon: P o p p c und R i c li a r d ('90), P o p p e tmd Mr a x e k ('95). Tiberiassee und andere
Seen Palästinas: Richard ('94). Tsnik-Gül (Kleinasien): Daday (’03,1). Mongolei (Kossogol und Umgebung):
D a d a y (’OB).
A F R I K A .
Die afrikanischen Fundorte sind 1897 von W e l t n e r und 1910 von D a d a y ['10,1) zusammengestellt.
Danach ist B . longirostris in Ägypten (Kairo und 1. Nilkatarakt)1) ’von Ri c h a r d und E kma n , im Victoria-
Nyanza und dessen Umgebung (Mbasifluß) von D a d a j gefunden. B . stulilmmmi Weltner vom Victoria-Nyanza
gehört nach Burokhardt ('ÖQ: I) und Daday ('07 und '10,1) .mit Bestimmtheit, wahrscheinlich auch Lynccus
macrorhynchus Schrnarda (1854) aus Ägypten zu B . longirostris.
N O R D AME R I K A .
Nach F o r d y c e s (’01) Zusammenstellung in Madison (Wisconsin), Minnesota, Eriesee, Massachusetts,
Oberer See, Cincinnati, Lake St. Clair (Michigan), Manitoba (Canada), Nordmexiko, Nebraska (B . longirostris und
B. ornamenta) gefunden.
S ÜDAMERIKA.
Argentinien: von W i e r z e j s lc i nach D a d a y (’05) gefunden; Paraguay: D a d a y (’05).
AUSTRALIEN. . .
Tasmanien. Aus Tasmanien hat G. W. Smi t h (’09) drei neue Bosmina-Spezies beschrieben: B . sorelli,
B . rotunda Smith und B . brevirostris Smith. Er hält dieselben für „closely related to the common northern B . longirostris“.
Für diese Namen, die beide schon vergeben sind, hat E. Strand (’11) die neuen Namen B . geoffreyi (für
B . rotunda G. W. Smith) und B . tasmanibia (für B . brevirostris G. W. Smith) vorgeschlagen; Beschreibung und Zeichnung
dieser Formen ist aber völlig unbrauchbar und nichtssagend, so daß mit denselben absolut nichts anzufangen ist.*)
2. Spezies Bosmina coregoni Baird.
Die Endkralle des weibl ichen Postabdomens (vgl. Fig. 1 und 2) zeigt mitunter an ihrem
dorsalen Rand die zwei bei B. longirostris stets vorhandenen Knicke, häufig jedoch fehlen dieselben
hier, so daß dann die Kralle gleichmäßig schwach gebogen ist. Der Basalteil der Kralle und der
distale Teil des Krallenträgers sind dorsal mit einer variablen Anzahl (5—12) von breiten, etwas
schiefstehenden, distal an Größe zunehmenden Zähnen bewehrt. Distal von dieser groben Bewehrung
findet sich eine (oft kaum bemerkbare) „feine Strichelung“.
Rostrum in allen Übergängen von geringer bis zu bedeutender Länge, jedoch nie 1/ 6 der
Körperlänge stark überschreitend (A + B = 120 bis 200); in der Form stumpf abgerundet bis relativ
spitz und schmal.
Stirnborste der Rostrumspitze weit näher als dem Auge inseriert (B stets kleiner als A).
Schalenskulptur besteht wenigstens an der vorderen Rostrumfläche aus paralleler Streifung
mit seltenen oder schwachen Queranastomosen.3)
1. Antenne relativ kurz bis lang und sehr lang (C -f- D = 225 bis weit über 1000), von sehr
variabler Krümmung und Incisurenzahl, n i e jedoch am Ende hakenförmig gebogen.
Der Mucro ist von sehr verschiedener Länge (Max. = 700); er kann äußerst reduziert sein
und völlig fehlen. Dann ist die ventrocaudale Schalenecke mehr oder weniger abgerundet.
*) Weitere Fundorte im Nil g ib t Daday (10, II) an.
*) Infolgedessen stehen auch die weitgehenden tiergeographischen Spekulationen, soweit sie Smith auf das Vorkommen von
Bosminen in Tasmanien gründet, auf sehr schwachen Füßen. Smith glaubt annehmen zu müssen, daß Bosmina (I) von der nördlichen
Hemisphäre ü ber die Andenkette und eine antarktische Landbrücke nach Tasmanien gelangt sei.
*) Vgl. pag. 54.
Das Postabdomen des Männchens ist von dem des eigenen Weibchens und dem des Männchens
von B. longirostris stark abweichend. Es ist nicht am Ende quer abgestutzt, sondern gegen das
Ende zu stark verjüngt; sein Dorsalrand ragt etwa in der Mitte in einem abgerundeten, stumpfen
Winkel vor, und distal von dieser Vorbuchtung befindet sich eine seichte Konkavität, in welcher der
After liegt. Die Endkrallen sind klein und unbewehrt. An ihrer Basis steht jederseits eine Reihe
von 3—5 kurzen Zähnchen, die distal kleiner werden. Absolute Länge des Weibchens 400—1200 p.,
des Männchens 400—600 p..
Die Spezies Bosminci coregoni schließt in dem weiten Sinne, wie ich sie nach obiger Diagnose
auffasse, einen außerordentlichen Formenreichtum in sich. Ein Hauptziel der folgenden systematischen
Untersuchungen wird es sein, Übersicht in diese chaotische Formenfülle zu bringen und zwar,
soweit als möglich, durch Aufdeckung genetischer Verwandtschaftsbeziehungen. Ich glaube nun,
in erster Linie zwei natürliche Formenreihen, die ich Longispina- und Coregoni-Beihe. nennen will,
im Formenkreis der Bosmina coregoni gegeneinander abgrenzen zu können. Die phylogenetische
Bedeutung dieser systematischen Einteilung besteht darin, daß auf der einen Seite die Longispina-
Reihe am weitgehendsten ursprüngliche Charaktere der gemeinsamen Stammformen beider Reihen
konserviert haben, während auf der anderen Seite die Formen der Oorayom-Reihe sich in vielfach
verzweigten Richtungen von diesen Stammformen mehr oder weniger weit entfernt haben. Unkorrekter
ausgedrückt halte ich also die Longispina-^ormen für die genetisch älteren, die Coregoni-Formen
für die jüngeren. Die Richtigkeit dieser Ableitung, sowie der weiteren genetischen Gliederung der
Coregoni-Reihe suche ich im folgenden zuerst auf dem Wege des morphologischen Vergleichs zu
erweisen, doch wird diese Auffassung wesentlich gestützt durch das Studium der Verbreitung und
der Temporalvariation beider Formenreihen. Durch Heranziehung der beiden letztgenannten
Betrachtungsweisen glaube ich auch über Ort und Zeitpunkt der Abzweigung der Coregoni-Formen
von Longispina-ähnlichen Stammformen hypothetisch einige Bestimmungen machen zu können.
Der im folgenden gegebenen Diagnose der Longispina- und Coregoni-Beihe habe ich einige
Bemerkungen vorauszuschicken. Beide Formenreihen hängen trotz des verschiedenen phyletischen
Alters, das ihnen, wie erwähnt, zuzuschreiben ist, noch aufs engste miteinander zusammen und
sind durch Übergangsformen verbunden. Zwar stehen die Extreme beider Reihen einander so fern,
daß über deren Stellung gar kein Zweifel sein kann und man sich nur schwer entschließt, diese scharf
unterscheidbaren Formen in einer Art zu vereinigen, aber andere Formen nähern sich wieder derart
einander, daß es schwer ist, beide Reihen diagnostisch voneinander zu trennen. Die Extremformen
unterscheiden sich nämlich durch eine große Anzahl von Merkmalen, deren jedes scharf genug ausgeprägt
ist, um über die Zuweisung der betreffenden Formen zur Longispina- oder Coregoni-Reihe
zu entscheiden; daneben aber gibt es weniger extreme Formen, bei denen eine mehr oder weniger
große Anzahl von Merkmalen nicht ausgesprochen nach dieser oder jener Seite hin entwickelt ist,
sondern eine unbestimmte Mittelstellung zwischen den beiden gut charakterisierbaren Extremen
einnimmt. Es ist nun, je nach der Anzahl dieser Übergangsmerkmale und je nach dem systematischen
Wert der einzelnen, teils in dieser, teils in jener Richtung hin entwickelten, schärfer ausgeprägten
Charaktere zu entscheiden, ob eine, vorliegende Form zur Longispina- oder zur Goreg'OfU-Reihe oder
als eine Übergangsform zwischen beide zu stellen ist. Infolgedessen ist es bei dem lückenlosen
Zusammenhang beider Formenreihen praktisch unmöglich, eine Reihe „mittels einer alle darin ver