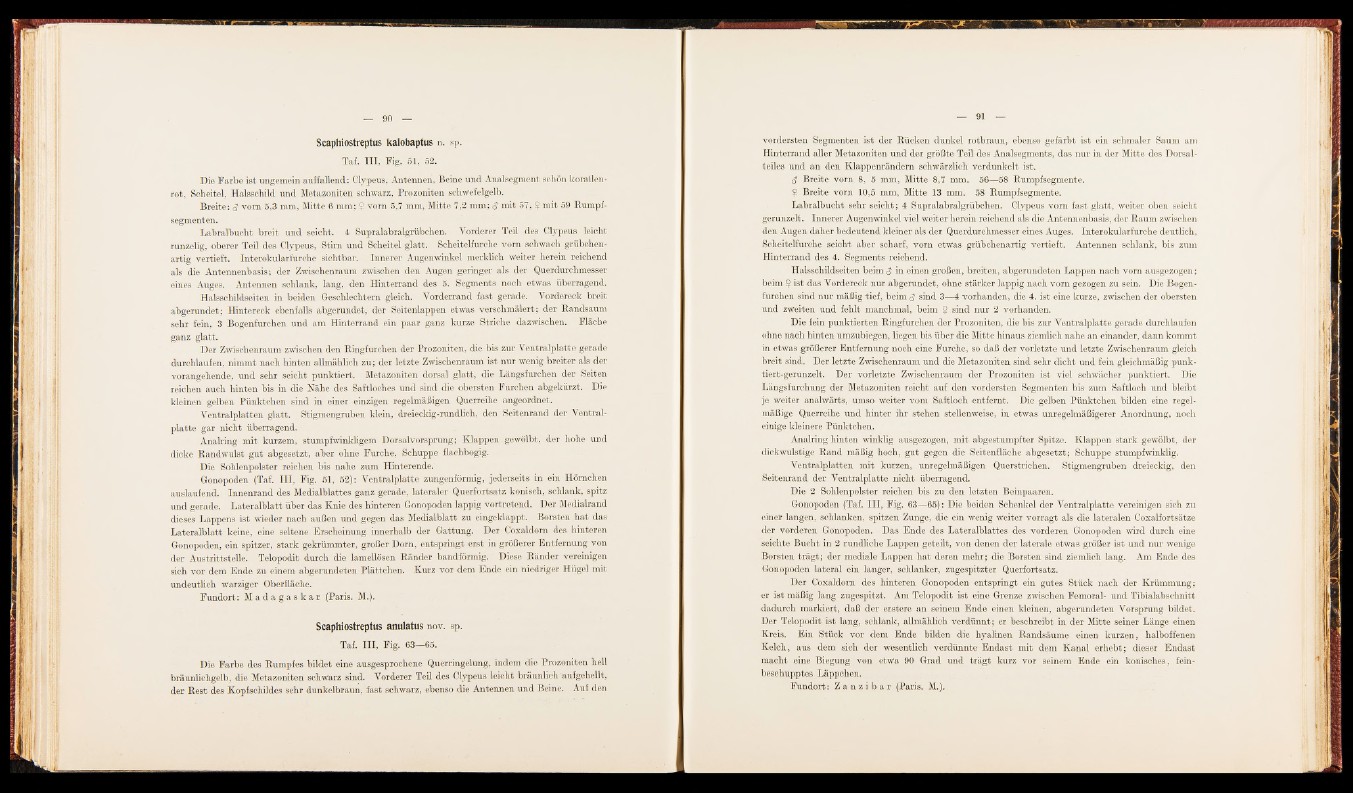
Scaphiostreptus kalobaptus n. sp.
Taf. III, Fig. 51, 52.
Die Farbe ist ungemein auffallend: Clypeus, Antennen, Beine und Analsegment schön korallenrot,
Scheitel, Halsschild und Metazoniten schwarz, Prozoniten schwefelgelb.
Breite: vorn 5,3 mm, Mitte 6 mm; $ vorn 5,7 mm, Mitte 7,2 mm; <$ mit 57, $ mit 59 Rumpfsegmenten.
Labralbucht breit und seicht. 4 Supralabralgrübchen. Vorderer Teil des Clypeus leicht
runzelig, oberer Teil des Clypeus, Stirn und Scheitel glatt. Scheitelfurche vorn schwach grübchen-
artig vertieft. Interokularfurche sichtbar. Innerer Augenwinkel merklich weiter herein reichend
als die Antennenbasis; der Zwischenraum zwischen den Augen geringer als der Querdurchmesser
eines Auges. Antennen schlank, lang, den Hinterrand des 5. Segments noch etwas überragend.
Halsschildseiten in beiden Geschlechtern gleich. Vorderrand fast gerade. Vordereck breit
abgerundet; Hintereck ebenfalls abgerundet, der Seitenlappen etwas verschmälert; der Randsaum
sehr fein, 3 Bogenfurchen und am Hinterrand ein paar ganz kurze Striche dazwischen. Fläche
ganz glatt.
Der Zwischenraum zwischen den Ringfurchen der Prozoniten, die bis zur Venträlplatte gerade
durchlaufen, nimmt nach hinten allmählich zu; der letzte Zwischenraum ist nur wenig breiter als der
vorangehende, und sehr seicht punktiert. Metazoniten dorsal glatt, die Längsfurchen der Seiten
reichen auch hinten bis in die Nähe des Saftloches und sind die obersten Furchen abgekürzt. Die
kleinen gelben Pünktchen sind in einer einzigen regelmäßigen Querreihe angeordnet.
Ventralplatten glatt. Stigmengruben klein, dreieckig-rundlich, den Seitenrand der Ventralplatte
gar nicht überragend.
Analring mit kurzem, stumpfwinkligem Dorsalvorsprung; Klappen gewölbt, der hohe und
dicke Randwulst gut abgesetzt, aber ohne Furche, Schuppe flachbogig.
Die Sohlenpolster reichen bis nahe zum Hinterende.'
Gonopoden (Taf. III, Fig. 51, 52): Ventralplatte zungenförmig, jederseits in ein Hörnchen
auslaufend. Innenrand des Medialblattes ganz gerade, lateraler Querfortsatz konisch, schlank, spitz
und gerade. Lateralblatt über das Knie des hinteren Gonopoden lappig vortretend. Der Medialrand
dieses Lappens ist wieder nach außen und gegen das Medialblatt zü eingeklappt. Borsten hat das
Lateralblatt keine, eine seltene Erscheinung innerhalb der Gattung. Der Coxaldorn des hinteren
Gonopoden, ein spitzer, stark gekrümmter, großer Dorn, entspringt erst in größerer Entfernung von
der Austrittstelle. Telopodit durch die lamellösen Ränder bandförmig. Diese Ränder vereinigen
sich vor dem Ende zu einem abgerundeten Plättchen. Kurz vor dem Ende ein niedriger Hügel mit
undeutlich warziger Oberfläche.
Fundort: M a d a g a s k a r (Paris. M.).
Scaphiostreptus anulatus nov. sp.
Taf. III, Fig. 63—65.
Die Farbe des Rumpfes bildet eine ausgesprochene Querringelung, indem die Prozoniten hell
bräunlichgelb, die Metazoniten schwarz sind. Vorderer Teil des Clypeus leicht bräunlich aufgehellt,
der Rest des Kopfschildes sehr dunkelbraun, fast schwarz, ebenso die Antennen und Beine. Auf den
vordersten Segmenten ist der Rücken dunkel rotbraun, ebenso gefärbt ist ein schmaler Saum am
Hinterrand aller Metazoniten und der größte Teil des Analsegments, das nur in der Mitte des Dorsalteiles
und an den Klappenrändern schwärzlich verdunkelt ist.
S Breite vorn 8, 5 mm, Mitte 8,7 mm. 56—58 Rumpfsegmente.
$ Breite vorn 10,5 mm, Mitte 13 mm. 58 Rumpfsegmente.
Labralbucht sehr seicht; 4 Supralabralgrübchen. Clypeus vom fast glatt, weiter oben seicht
gerunzelt. Innerer Augenwinkel viel weiter herein reichend als die Antennenbasis, der Raum zwischen
den Augen daher bedeutend kleiner als der Querdurchmesser eines Auges. Interokularfurche deutlich,
Scheitelfurche seicht aber scharf, vorn etwas grübchenartig vertieft. Antennen schlank, bis zum
Hinterrand des 4. Segments reichend.
Halsschildseiten beim $ in einen großen, breiten, abgerundeten Lappen nach vorn ausgezogen;
beim $ ist das Vordereck nur abgerundet, ohne stärker lappig nach vorn gezogen zu sein. Die Bogenfurchen
sind nur mäßig tief, beim $ sind 3—4 vorhanden, die 4. ist eine kurze, zwischen der obersten
und zweiten und fehlt manchmal, beim $. sind nur 2 vorhanden.
Die fein punktierten Ringfurchen der Prozoniten, die bis zur Ventralplatte gerade durchlaufen
ohne nach hinten umzubiegen, liegen bis über die Mitte hinaus ziemlich nahe an einander, dann kommt
in etwas größerer Entfernung noch eine Furche, so daß der vorletzte und letzte Zwischenraum gleich
breit sind. Der letzte Zwischenraum und die Metazoniten sind sehr dicht und fein gleichmäßig punk-
tiert-gerunzelt. Der vorletzte Zwischenraum der Prozoniten ist viel schwächer punktiert. Die
Längsfurchung der Metazoniten reicht auf den vordersten Segmenten bis zum Saftloch und bleibt
je weiter analwärts, umso weiter vom Saftloch entfernt. Die gelben Pünktchen bilden eine regelmäßige
Querreihe und hinter ihr stehen stellenweise, in etwas unregelmäßigerer Anordnung, noch
einige kleinere Pünktchen.
Analring hinten winklig ausgezogen, mit abgestumpfter Spitze. Klappen stark gewölbt, der
dickwulstige Rand mäßig hoch, gut gegen die Seitenfläche abgesetzt; Schuppe stumpfwinklig.
Ventralplatten mit kurzen, unregelmäßigen Querstrichen. Stigmengruben dreieckig, den
Seitenrand der Ventralplatte nicht überragend.
Die 2 Sohlenpolster reichen bis zu den letzten Beinpaaren.
Gonopoden (Taf. III, Fig. 63—65): Die beiden Schenkel der Ventralplatte vereinigen sich zu
einer langen, schlanken, spitzen Zunge, die ein wenig weiter vorragt als die lateralen Coxalfortsätze
der vorderen Gonopoden. Das Ende des Lateralblattes des vorderen Gonopoden wird durch eine
seichte Bucht in 2 rundliche Lappen geteilt, von denen der laterale etwas größer ist und nur wenige
Borsten trägt; der mediale Lappen hat deren mehr; die Borsten sind ziemlich lang. Am Ende des
Gonopoden lateral ein langer, schlanker, zugespitzter Querfortsatz.
Der Coxaldorn des hinteren Gonopoden entspringt ein gutes Stück nach der Krümmung;
er ist mäßig lang zugespitzt. Am Telopodit ist eine Grenze zwischen Femoral- und Tibialabschnitt
dadurch markiert, daß der erstere an seinem Ende einen kleinen, abgerundeten Vorsprung bildet.
Der Telopodit ist lang, schlank, allmählich verdünnt; er beschreibt in der Mitte seiner Länge einen
Kreis. Ein Stück vor dem Ende bilden die hyalinen Randsäume einen kurzen, halboffenen
Kelch, aus dem sich der wesentlich verdünnte Endast mit dem Kanal erhebt; dieser Endast
macht eine Biegung von etwa 90 Grad und trägt kurz vor seinem Ende ein konisches, feinbeschupptes
Läppchen.
Fundort: Z a n z i b a r (Paris. M.).