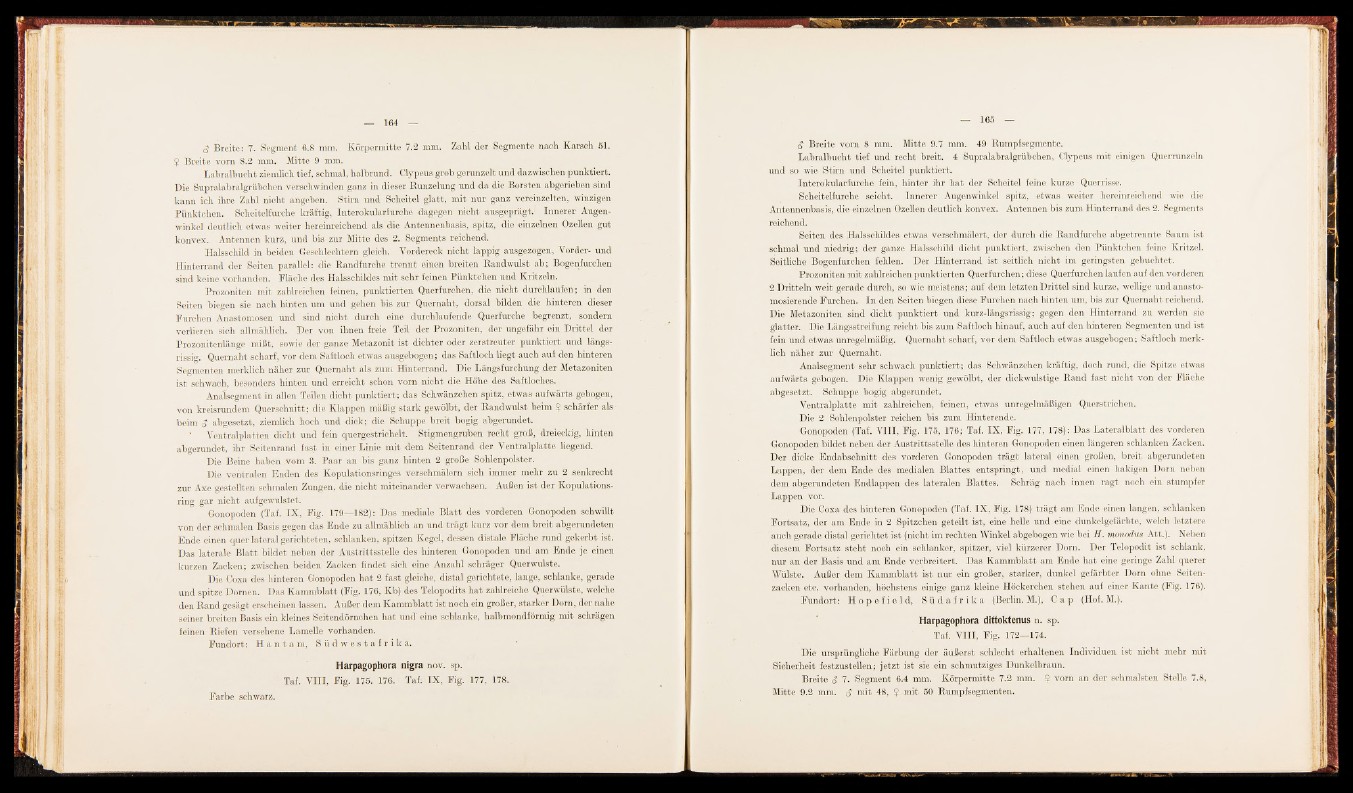
<J Breite: 7. Segment 6.8 mm. Körpermitte 7.2 mm. Zahl der Segmente nach Karsch 51.
Q Breite vorn 8.2 mm. Mitte 9 mm.
Labralbucht ziemlich tief, schmal, halbrund. Clypeus grob gerunzelt und dazwischen punktiert.
Die Supralabralgrübchen verschwinden ganz in dieser Runzelung und da die Borsten abgerieben sind
kann ich ihre Zahl nicht angeben. Stirn und Scheitel glatt, mit nur ganz vereinzelten, winzigen
Pünktchen. Scheitelfurche kräftig, Interokularfurche dagegen nicht ausgeprägt.1 Innerer Augenwinkel
deutlich etwas weiter hereinreichend als die Antennenbasis, spitz, die einzelnen Ozellen gut
konvex. Antennen kurz, und bis zur Mitte des 2. Segments reichend.
Halsschild in beiden Geschlechtern gleich. Vordereck nicht lappig ausgezogen, Vorder- und
Hinterrand der Seiten parallel: die Randfurche trennt einen breiten Randwulst ab; Bogenfurchen
sind keine vorhanden. Fläche des Halsschildes mit sehr feinen Pünktchen und Kritzeln.
Prozoniten mit zahlreichen feinen, punktierten Querfurchen, die nicht durchlaufen; in den
Seiten biegen sie nach hinten um und gehen bis zur Quernaht, dorsal bilden die hinteren dieser
Furchen Anastomosen und sind nicht durch eine durchlaufende Querfurche begrenzt, sondern
verlieren sich allmählich. Der von ihnen freie Teil der Prozoniten, der ungefähr ein Drittel der
Prozonitenlänge mißt, sowie der ganze Metazonit ist dichter oder zerstreuter punktiert und längsrissig.
Quernaht scharf, vor dem Saftloch etwas ausgebogen; das Saftloch liegt auch auf den hinteren
Segmenten merklich näher zur Quernaht als zum Hinterrand. Die Längsfurchung der Metazoniten
ist schwach, besonders hinten und erreicht schon vorn nicht die Höhe des Saftloches.
Analsegment in allen Teilen dicht punktiert; das Schwänzchen spitz, etwas aufwärts gebogen,
von kreisrundem Querschnitt; die Klappen mäßig stark gewölbt, der Randwulst beim $ schärfer als •
beim <J abgesetzt, ziemlich hoch und dick; die Schuppe breit bogig abgerundet.
Ventralplatten dicht und fein quergestrichelt. Stigmengruben recht groß, dreieckig, hinten
abgerundet, ihr Seitenrand fast in einer Linie mit dem Seitenrand der Ventralplatte liegend.
Die Beine haben vom 3. Paar an bis ganz hinten 2 große Sohlenpolster.
Die ventralen Enden des Kopulationsringes verschmälern sich immer mehr zu 2 senkrecht
zur Axe gestellten schmalen Zungen, die nicht miteinander verwachsen. Außen ist der Kopulationsring
gar nicht aufgewulstet.
Gonopoden (Taf. IX, Fig. 179—182): Das mediale Blatt des vorderen Gonopoden schwillt
von der schmalen Basis gegen das Ende zu allmählich an und trägt kurz vor dem breit abgerundeten
Ende einen quer lateral gerichteten, schlanken, spitzen Kegel, dessen distale Fläche rund gekerbt ist.
Das laterale Blatt bildet neben der Austrittsstelle des hinteren Gonopoden und am Ende je einen
kurzen Zacken; zwischen beiden Zacken findet sich eine Anzahl schräger Querwulste.
Die Coxa des hinteren Gonopoden hat 2 fast gleiche, distal gerichtete, lange, schlanke, gerade
und spitze Dornen. Das Kammblatt (Fig. 176, Kb) des Telopodits hat zahlreiche Querwülste, welche
den Rand gesägt erscheinen lassen. Außer dem Kammblatt ist noch ein großer, starker Dorn, der nahe
seiner breiten Basis ein kleines Seitendörnchen hat und' eine schlanke, halbmondförmig mit schrägen
feinen Riefen versehene Lamelle vorhanden.
Fundort: H a n t a m, S ü d w e s t a f r i k a .
Harpagophora nigra nov. sp.
Taf. VIII, Fig. 175. 176. Taf. IX, Fig. 177, 178.
Farbe schwarz.
d Breite vorn 8 mm. Mitte 9.7 mm. 49 Rumpfsegmente.
Labralbucht tief und recht breit. 4 Supralabralgrübchen, Clypeus mit einigen Querrunzeln
und so wie Stirn und Scheitel punktiert.
Interokularfurche fein, hinter ihr hat der Scheitel feine kurze Querrisse.
Scheitelfurche seicht. Innerer Augenwinkel spitz, etwas weiter hereinreichend wie die
Antennenbasis, die einzelnen Ozellen deutlich konvex. Antennen bis zum Hinterrand des 2. Segments
reichend.
Seiten des Halsschildes etwas verschmälert, der durch die Randfurche abgetrennte Saum ist
schmal und niedrig; der ganze Halsschild dicht punktiert, zwischen den Pünktchen feine Kritzel.
Seitliche Bogenfurchen fehlen. Der Hinterrand ist seitlich nicht im geringsten gebuchtet.
Prozoniten mit zahlreichen punktierten Querfurchen; diese Querfurchen laufen auf den vorderen
2 Dritteln weit gerade durch, so wie meistens; auf dem letzten Drittel sind kurze, wellige undanasto-
mosierende Furchen. In den Seiten biegen diese Furchen nach hinten um, bis zur Quernaht reichend.
Die Metazoniten sind dicht punktiert und kurz-längsrissig; gegen den Hinterrand zu werden sie
glatter. Die Längsstreifung reicht bis zum Saftloch hinauf, auch auf den hinteren Segmenten und ist
fein und etwas unregelmäßig. Quernaht scharf, vor dem Saftloch etwas ausgebogen; Saftloch merklich
näher zur Quernaht.
Analsegment sehr schwach punktiert; das Schwänzchen kräftig, doch rund, die Spitze etwas
aufwärts gebogen. Die Klappen wenig gewölbt, der dickwulstige Rand fast nicht von der Fläche
abgesetzt. Schuppe bogig abgerundet.
Ventralplatte mit zahlreichen, feinen, etwas unregelmäßigen Querstrichen.
Die 2 Sohlenpolster reichen bis zum Hinterende.
Gonopoden (Taf. VIII, Fig. 175, 176; Taf. IX, Fig. 177, 178): Das Lateralblatt des vorderen
Gonopoden bildet neben der Austrittsstelle des hinteren Gonopoden einen längeren schlanken Zacken.
Der dicke Endabschnitt des vorderen Gonopoden trägt lateral einen großen, breit abgerundeten
Lappen, der dem Ende des medialen Blattes entspringt, und medial einen hakigen Dorn neben
dem abgerundeten Endlappen des lateralen Blattes. Schräg nach innen ragt noch ein stumpfer
Lappen vor.
Die Coxa des hinteren Gonopoden (Taf. IX, Fig. 178) trägt am Ende einen langen, schlanken
Fortsatz, der am Ende in 2 Spitzchen geteilt ist, eine helle und eine dunkelgefärbte, welch letztere
auch gerade distal gerichtet ist (nicht im rechten Winkel abgebogen wie bei H. monodus Att.). Neben
diesem Fortsatz steht noch ein schlanker, spitzer, viel kürzerer Dorn. Der Telopodit ist schlank,
nur an der Basis und am Ende verbreitert. Das Kammblatt am Ende hat eine geringe Zahl querer
Wülste. Außer dem Kammblatt ist nur ein großer, starker, dunkel gefärbter Dorn ohne Seitenzacken
etc. vorhanden, höchstens einige ganz kleine Höckerchen stehen auf einer Kante (Fig. 176).
Fundort: H o p e f i e l d , S ü d a f r i k a (Berlin. M.), C a p (Hof. M.).
Harpagophora dittoktenus n. sp.
Taf. VIII, Fig. 172—174.
Die ursprüngliche Färbung der äußerst schlecht erhaltenen Individuen ist nicht mehr mit
Sicherheit festzustellen; jetzt ist sie ein schmutziges Dunkelbraun.
Breite <? 7. Segment 6.4 mm. Körpermitte 7.2 mm. $ vorn an der schmälsten Stelle 7.8,
Mitte 9.2 mm. d mit 48, $ mit 50 Rumpfsegmenten.