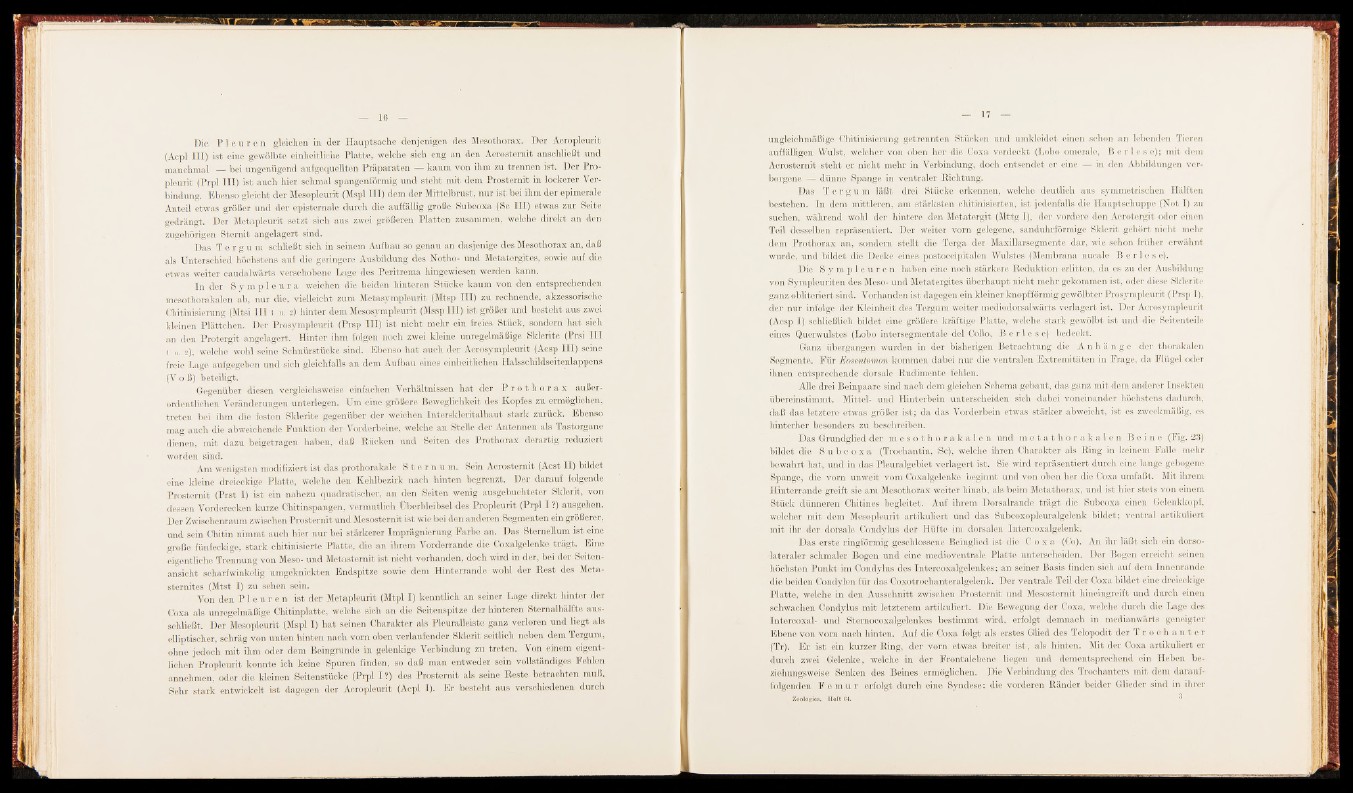
Die P l e u r e n gleichen in der Hauptsache denjenigen des Mesothorax. Der Acropleurit
(Acpl III) ist eine gewölbte einheitliche Platte, welche sich eng an den Acrosternit anschließt .und.
manchmal — bei ungenügend aufgequellten PräparatenH- kaum von ihm zu trennen ist. Der Propleurit
(Prpl III) ist auch hier schmal spangenförmig und steht mit dem Prosternit in lockerer Verbindung.
Ebenso gleicht der Mesopleurit (Mspl III) dem der Mittelbrust, nur ist bei ihm der epimerale
Anteil etwas größer und der epistemale durch die auffällig große Subcoxa (Sc III), etwas zur Seite
gedrängt. Der Metapleurit setzt sich aus zwei größeren Platten zusammen, welche direkt an den
zugehörigen Stemit angelagert sind.
Das T e r g u m schließt sich in seinem Aufbau so genau an dasjenige des Mesothorax an, daß
als Unterschied höchstens auf die geringere Ausbildung des Notho- und Metatergites, sowie auf die
etwas weiter caudalwärts verschobene Lage des Peritrema hingewiesen werden kann.
In der S y m p 1 e u r a weichen die beiden hinteren Stücke kaum von den entsprechenden
mesothorakalen ab, nur die. vielleicht zum Metasympleurit (Mtsp III) zu rechnende, akzessorische
Chitinisierung (Mtsi I II 1 u. 2) hinter dem Mesosympleurit (Mssp III) ist größer und besteht aus zwei
kleinen Plättchen. Der Prosympleurit (Prsp III) ist nicht mehr ein freies Stück, sondern hat Bidh
an den Protergit angelagert. Hinter ihm folgen noch zwei Heine unregelmäßige SHerite (Prsi III
1 >1. 2), welche wohl seine SchnürstüCke sind. Ebenso hat auch der Acrösympleurit (itesp III) seine
freie Lage aufgegeben und sich gleichfalls an dem Aufbau eines einheitlichen Halsschildseitenlappens
(V 0 ß) beteiligt.
Gegenüber diesen vergleichsweise einfachen Verhältnissen hat der P r o t h o r a x außerordentlichen
Veränderungen unterlegen. Um eine größere Beweglichkeit des Kopfes ZU ermöglichen,
treten bei ihm die festen Sklerite gegenüber der weichen Interskleritalhaut stark zurück. Ebenso
mag auch die abweichende Punktion der Vorderbeine, welche an Stelle der Antennen als Tastorgane
dienen, mit dazu beigetragen haben, daß Rücken und Seiten des Prothorax derartig reduziert
worden sind.
Am wenigsten modifiziert ist das prothorakale S t e r n u m . Sein Acrosternit (Acst II) bildet
eine kleine dreieckige Platte, Welche den Kehlbezirk nach hinten begrenzt. Der darauf folgende
Prosternit (Prst I) ist ein nahezu quadratischer, an den Seiten wenig ausgebuehteter SHerit, von
dessen Vorderecken kurze Chitinspangen, vermutlich Überbleibsel des Propleurit (Prpl I ?) ausgehen.
Der Zwischenraum zwischen Prosternit und Mesosternit ist wie bei den anderen Segmenten ein größerer,
und sein Chitin nimmt auch hier nur bei stärkerer Imprägnierung Parbe an. Das StemeUum ist eine
große fünfeckige, stark chitinisierte Platte, die an ihrem Vorderrande die Coxalgelenke trägt. Eine
eigentliche Trennung von Meso- und Metasternit ist nicht vorhanden, doch wird in der, bei der Seitenansicht
scharfwinkelig umgeknickten Endspitze sowie dem Hinterrande wohl der Rest des Meta-
stemites (Mtst I) zu sehen sein.
Von den P l e u r e n ist der Metapleurit (Mtpl I) kenntlich an seiner Lage direkt hinter der
Coxa als unregelmäßige Chitinplatte, welche sich an die Seitenspitze der hinteren Stemalhälfte ausschließt.
Der Mesopleurit (Mspl I) hat seinen Charakter als Pleuralleiste ganz verloren und liegt als
elliptischer, sehräg von unten hinten nach vorn oben verlaufender Sklerit seitlich neben dem Tergum,
ohne jedoch mit ihm oder dem Beingrunde in gelenkige Verbindung zu treten. Von einem eigentlichen
Propleurit konnte ich keine Spuren finden, so daß man entweder sein vollständiges Pehlen
annehmen, oder die kleinen Seitenstücke (Prpl I ?) des Prosternit als seine Reste betrachten muß.
Sehr stark entwickelt ist dagegen der Acropleurit (Acpl I). Er besteht aus verschiedenen durch
ungleichmäßige Chitinisierung getrennten Stücken und umkleidet einen schon an lebenden Tieren
auffälligen Wulst, welcher von oben her die Coxa verdeckt (Lobo omerale, B e r l e s e ) ; mit dem
Acrosternit steht er nicht mehr in Verbindung, doch entsendet er eine — in den Abbildungen verborgene
— dünne Spange in ventraler Richtung.
Das T e r g u m läßt drei Stücke erkennen, welche deutlich aus symmetrischen Hälften
bestehen. In dem mittleren, am stärksten chitinisierten, ist jedenfalls die Hauptschuppe (Not I) zu
suchen, während wohl der hintere den Metatergit (Mttg I), der vordere den Acrotergit oder einen
Teil desselben repräsentiert. Der weiter vorn gelegene, sanduhrförmige Sklerit gehört nicht mehr
dem Prothorax an, sondern stellt die Terga der Maxillarsegmente dar, wie schon früher erwähnt
wurde, und bildet die Decke eines postoccipitalen Wulstes (Membrana nucale B e r l e s e ) .
Die S y m p l e u r e n haben eine noch stärkere Reduktion erlitten, da es zu der Ausbildung
von Sympleuriten des Meso- und Metatergites überhaupt nicht mehr gekommen ist, oder diese Sklerite
ganz obliteriert sind. Vorhanden ist dagegen ein kleiner knopfförmig gewölbter Prosympleurit (Prsp I),
der nur infolge der Kleinheit des Tergum weiter mediodorsalwärts verlagert ist. Der Acrösympleurit
(Acsp I) schließlich bildet eine größere kräftige Platte, welche stark gewölbt ist und die Seitenteile
eines Querwulstes (Lobo intersegmentale del Collo, B e r l e s e ) bedeckt.
Ganz übergangen wurden in der bisherigen Betrachtung die A n h ä n g e der thorakalen
Segmente. Für Eosentomon kommen dabei nur die ventralen Extremitäten in Frage, da Flügel oder
ihnen entsprechende dorsale Rudimente fehlen.
Alle drei Beinpaare sind nach dem gleichen Schema gebaut, das ganz mit dem anderer Insekten
übereinstimmt. Mittel- und Hinterbein unterscheiden sich -dabei voneinander höchstens dadurch,
daß das letztere etwas größer ist; da das Vorderbein etwas stärker abweicht, ist es zweckmäßig, es
hinterher besonders zu beschreiben.
Das Grundglied der m e s o t h o r a k a l e n und m e t a t h o r a k a l e n B e i n e (Fig. 23)
bildet die S u b c o x a (Trochantin, Sc), welche ihren Charakter als Ring in keinem Falle mehr
bewahrt hat, und in das Pleuralgebiet verlagert ist. Sie wird repräsentiert durch eine lange gebogene
Spange, die vorn unweit vom Coxalgelenke beginnt und von oben her die Coxa umfaßt. Mit ihrem
Hinterrande greift sie am Mesothorax weiter hinab, als beim Metathorax, und ist hier stets von einem
Stück dünneren Chitines begleitet. Auf ihrem Dorsalrande trägt die Subcoxa einen Gelenkkopf,
welcher mit dem Mesopleurit artikuliert und das Subcoxopleuralgelenk bildet; ventral artikuliert
mit ihr der dorsale Condylus der Hüfte im dorsalen Intercoxalgelenk.
Das erste ringförmig geschlossene Beinglied ist die C o x a (Co). An ihr läßt sich ein dorso-
lateraler schmaler Bogen und eine medioventrale Platte unterscheiden. Der Bogen erreicht seinen
höchsten Punkt im Condylus des Intercoxalgelenkes; an seiner Basis finden sich auf dem Innenrande
die beiden Condylen für das Coxotrochanteralgelenk. Der ventrale Teil der Coxa bildet eine dreieckige
Platte, welche in den Ausschnitt zwischen Prosternit und Mesosternit hineingreift und durch einen
schwachen Condylus mit letzterem artikuliert. Die Bewegung der Coxa, welche durch die Lage des
Intercoxal- und Sternocoxalgelenkes bestimmt wird, erfolgt demnach in medianwärts geneigter
Ebene von vorn nach hinten. Auf die Coxa folgt als erstes Glied des Telopodit der T r o c h a n t e r
(Tr). Er ist ein kurzer Ring, der vorn etwas breiter ist , als hinten. Mit der Coxa artikuliert er
durch zwei Gelenke, welche in der Frontalebene liegen und dementsprechend ein Heben beziehungsweise
Senken des Beines ermöglichen. Die Verbindung des Trochanters mit dem darauffolgenden
F e m u r erfolgt durch eine Syndese: die vorderen Ränder beider Glieder sind in ihrer
Zoologien. H e f t C4. 3