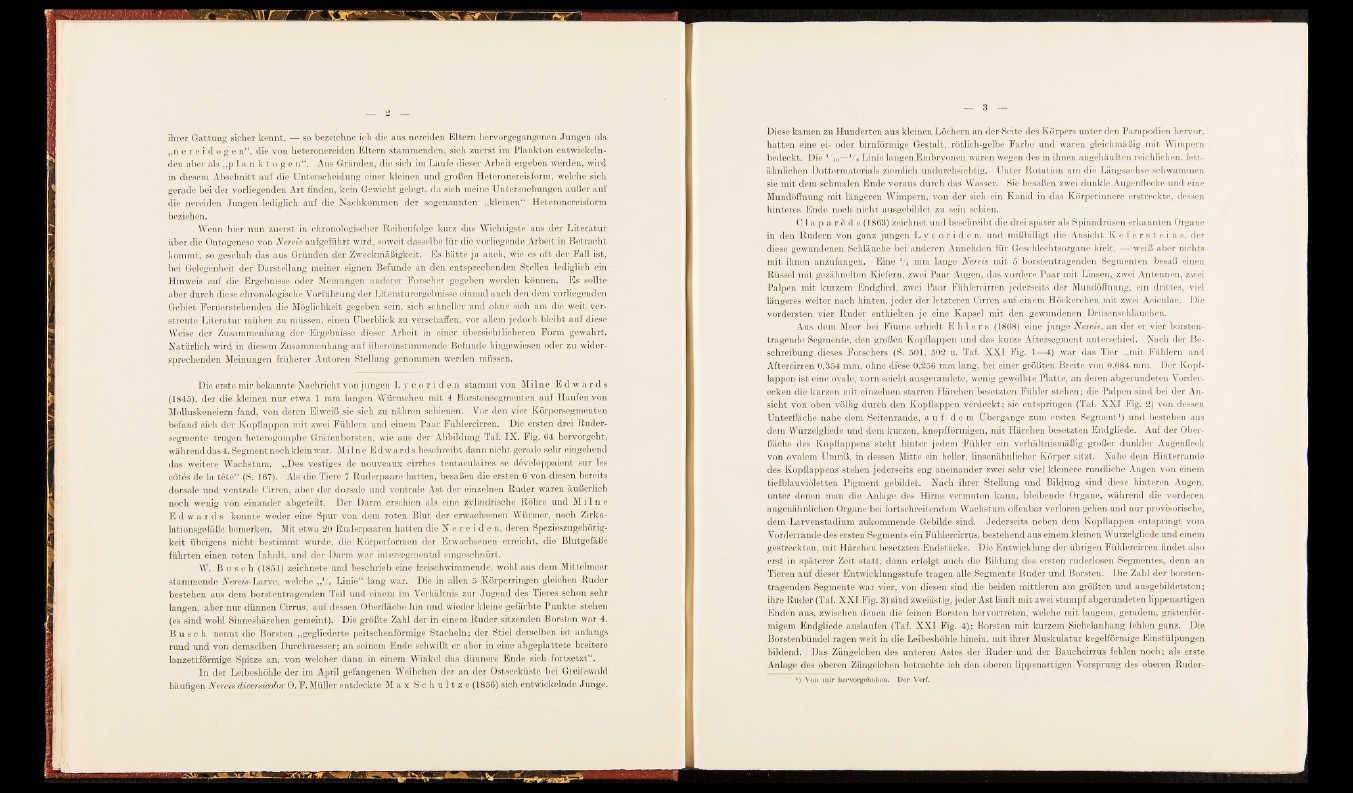
ihrer Gattung sicher kennt, — so bezeichne ich die aus nereiden Eltern hervorgegangenen Jungen als
„ n e r e i d o g e n “, die von heteronereiden Eltern stammenden, sich zuerst im Plankton entwickelnden
aber als „p l a n k t o g e n“. Aus Gründen, die sich im Laufe dieser Arbeit ergeben werden, wird
in diesem Abschnitt auf die Unterscheidung einer kleinen und großen Heteronereisform, welche sich
gerade bei der vorliegenden Art finden, kein Gewicht gelegt, da sich meine Untersuchungen außer auf
die nereiden Jungen lediglich auf die Nachkommen der sogenannten „kleinen“ Heteronereisform
beziehen.W
enn hier nun zuerst in chronologischer Reihenfolge kurz das Wichtigste aus der Literatur
über die Ontogenese von Nereis aufgeführt wird, soweit dasselbe für die vorliegende Arbeit in Betracht
kommt, so geschah das aus Gründen der Zweckmäßigkeit. Es hätte ja auch, wie es oft der Fall ist,
bei Gelegenheit der Darstellung meiner eignen Befunde an den entsprechenden Stellen lediglich ein
Hinweis auf die Ergebnisse oder Meinungen anderer Forscher gegeben werden können. Es sollte
aber durch diese chronologische Vorführung der Literaturergebnisse einmal auch den dem vorliegenden
Gebiet Fernerstehenden die Möglichkeit gegeben sein, sich schneller und ohne sich um die weit verstreute
Literatur mühen zu müssen, einen Überblick zu verschaffen, vor allem jedoch bleibt auf diese
Weise der Zusammenhang der Ergebnisse dieser Arbeit in einer übersichtlicheren Form gewahrt.
Natürlich wird in diesem Zusammenhang auf übereinstimmende Befunde hingewiesen oder zu widersprechenden
Meinungen früherer Autoren Stellung genommen werden müssen.
Die erste mir bekannte Nachricht von jungen L y c o r i d e n stammt von Milne E d w a r d s
(1845), der die kleinen nur etwa 1 mm langen Würmchen mit 4 Borstensegmenten auf Haufen von
Molluskeneiern fand, von deren Eiweiß sie sich zu nähren schienen. Vor den vier Körpersegmenten
befand sich der Kopflappen mit zwei Fühlern und einem Paar Fühlercirren. Die ersten drei Rudersegmente
trugen heterogomphe Grätenborsten, wie aus der Abbildung Taf. IX. Fig. 64 hervorgeht,
während das 4. Segment noch klein war. Mi ln eEdwa r d s beschreibt dann nicht gerade sehr eingehend
das weitere Wachstum. „Des vestiges de nouveaux cirrhes tentaculaires se développaient sur les
côtés de la tête“ (S. 167). Als die Tiere 7 Ruderpaare hatten, besaßen die ersten 6 von diesen bereits
dorsale und ventrale Cirren, aber der dorsale und ventrale Ast der einzelnen Ruder waren äußerlich
noch wenig von einander abgeteilt. Der Darm erschien als eine zylindrische Röhre und M i l n e
E d w a r d s konnte weder eine Spur von dem roten Blut der erwachsenen Würmer, noch Zirkulationsgefäße
bemerken. Mit etwa 20 Ruderpaaren hatten die N e r e i d e n , deren Spezieszugehörigkeit
übrigens nicht bestimmt wurde, die Körperformen der Erwachsenen erreicht, die Blutgefäße
führten einen roten Inhalt, und der Darm war intersegmental eingeschnürt.
W. B u s c h (1851) zeichnete und beschrieb eine freischwimmende, wohl aus dem Mittelmeer
stammende Werns-Larve, welche „Vs Linie“ lang war. Die in allen 5 Körperringen gleichen Ruder
bestehen aus dem borstentragenden Teil und einem im Verhältnis zur Jugend des Tieres schon sehr
langen, aber nur dünnen Cirrus, auf dessen Oberfläche hin und wieder kleine gefärbte Punkte stehen
(es sind wohl Sinneshärchen gemeint). Die größte Zahl der in einem Ruder sitzenden Borsten war 4.
B u s c h nennt die Borsten „gegliederte peitschenförmige Stacheln; der Stiel derselben ist anfangs
rund und von demselben Durchmesser; an seinem Ende schwillt er aber in eine abgeplattete breitere
lanzettförmige Spitze an, von welcher dann in einem Winkel das dünnere Ende sich fortsetzt“.
In der Leibeshöhle der im April gefangenen Weibchen der an der Ostseeküste bei Greifswald
häufigen Nereis diversicolor 0. F. Müller entdeckte M a x S c h u l t z e (1856) sich entwickelnde Junge.
Diese kamen zu Hunderten aus kleinen Löchern an der Seite des Körpers unter den Parapodien hervor,
hatten eine ei- oder bimförmige Gestalt, rötlich-gelbe Farbe und waren gleichmäßig mit Wimpern
bedeckt. Die Vio- "d/s Linie langen Embryonen waren wegen des in ihnen angehäuften reichlichen, fettähnlichen
Dottermaterials ziemlich undurchsichtig. Unter Rotation um die Längsachse schwammen
sie mit dem schmalen Ende voraus durch das Wasser. Sie besaßen zwei dunkle Augenflecke und eine
Mundöffnung mit längeren Wimpern, von der sich ein Kanal in das Körperinnere erstreckte, dessen
hinteres Ende noch nicht ausgebildet zu sein schien.
C l a p a r e d e (1863) zeichnet und beschreibt die drei später als Spinndrüsen erkannten Organe
in den Rudern von ganz jungen L y c o r i d e n , und mißbilligt die Ansicht K e f e r s t e i n s , der
diese gewundenen Schläuche bei anderen Anneliden für Geschlechtsorgane hielt, -|||weiß aber nichts
mit ihnen anzufangen. Eine % mm lange Nereis mit 5 borstentragenden Segmenten besaß einen
Rüssel mit gezähnelten Kiefern, zwei Paar Augen, das vordere Paar mit Linsen, zwei Antennen, zwei
Palpen mit kurzem Endglied, zwei Paar Fühlercirren jederseits der Mundöffnung, ein drittes, viel
längeres weiter nach hinten, jeder der letzteren Cirren auf einem Höckerchen mit zwei Aciculae. Die
vordersten vier Ruder enthielten je eine Kapsel mit den gewundenen Drüsenschläuchen.
Aus dem Meer bei Fiume erhielt E h l e r s (1868) eine junge Nereis, an der er vier borstentragende
Segmente, den großen Kopflappen und das kurze Aftersegment unterschied. Nach der Beschreibung
dieses Forschers (S. 501, 502 u. Taf. XXI Fig. 1—4) war das Tier „mit Fühlern und
Aftercirren 0,354 mm, ohne diese 0,256 mm lang, bei einer größten Breite von 0,084 mm. Der Kopflappen
ist eine ovale, vorn seicht ausgerandete, wenig gewölbte Platte, an deren abgerundeten Vorderecken
die kurzen mit einzelnen starren Härchen besetzten Fühler stehen; die Palpen sind bei der Ansicht
von oben völlig durch den Kopflappen verdeckt; sie entspringen (Taf. XXI Fig. 2) von dessen
Unterfläche nahe dem Seitenrande, a u f d em Übergange zum ersten Segment1) und bestehen aus
dem Wurzelgliede und dem kurzen, knopfförmigen, mit Härchen besetzten Endgliede. Auf der Oberfläche
des Kopflappens steht hinter jedem Fühler ein verhältnismäßig großer dunkler Augenfleck
von ovalem Umriß, in dessen Mitte ein heller, linsenähnlicher Körper sitzt. Nahe dem Hinterrande
des Kopflappens stehen jederseits eng aneinander zwei sehr viel kleinere rundliche Augen von einem
tiefblauvioletten Pigment gebildet. Nach ihrer Stellung und Bildung sind diese hinteren Augen,
unter denen man die Anlage des Hirns vermuten kann, bleibende Organe, während die vorderen
augenähnlichen Organe bei fortschreitendem Wachstum offenbar verloren gehen und nur provisorische,
dem Larvenstadium zukommende Gebilde sind. Jederseits neben dem Kopf lappen entspringt vom
Vorderrande des ersten Segments ein Fühlercirrus, bestehend aus einem kleinen Wurzelgliede und einem
gestreckten, mit Härchen besetzten Endstücke. Die Entwicklung der übrigen Fühlercirren findet also
erst in späterer Zeit statt, dann erfolgt auch die Bildung des ersten ruderlosen Segmentes, denn an
Tieren auf dieser Entwicklungsstufe tragen alle Segmente Ruder und Borsten. Die Zahl der borstentragenden
Segmente war vier, von diesen sind die beiden mittleren am größten und ausgebildetsten;
ihre Ruder (Taf. XXI Fig. 3) sind zweiästig, jeder Ast läuft mit zwei stumpf abgerundeten lippenartigen
Enden aus, zwischen denen die feinen Borsten hervortreten, welche mit langem, geradem, grätenförmigem
Endgliede auslaufen (Taf. XXI Fig. 4); Borsten mit kurzem Sichelanhang fehlen ganz. Die
Borstenbündel ragen weit in die Leibeshöhle hinein, mit ihrer Muskulatur kegelförmige Einstülpungen
bildend. Das Züngelchen des unteren Astes der Ruder und der Bauchcirrus fehlen noch; als erste
Anlage des oberen Züngelchen betrachte ich den oberen lippenartigen Vorsprung des oberen Ruder-
*) Von mir hervorgehoben. Der Verf.