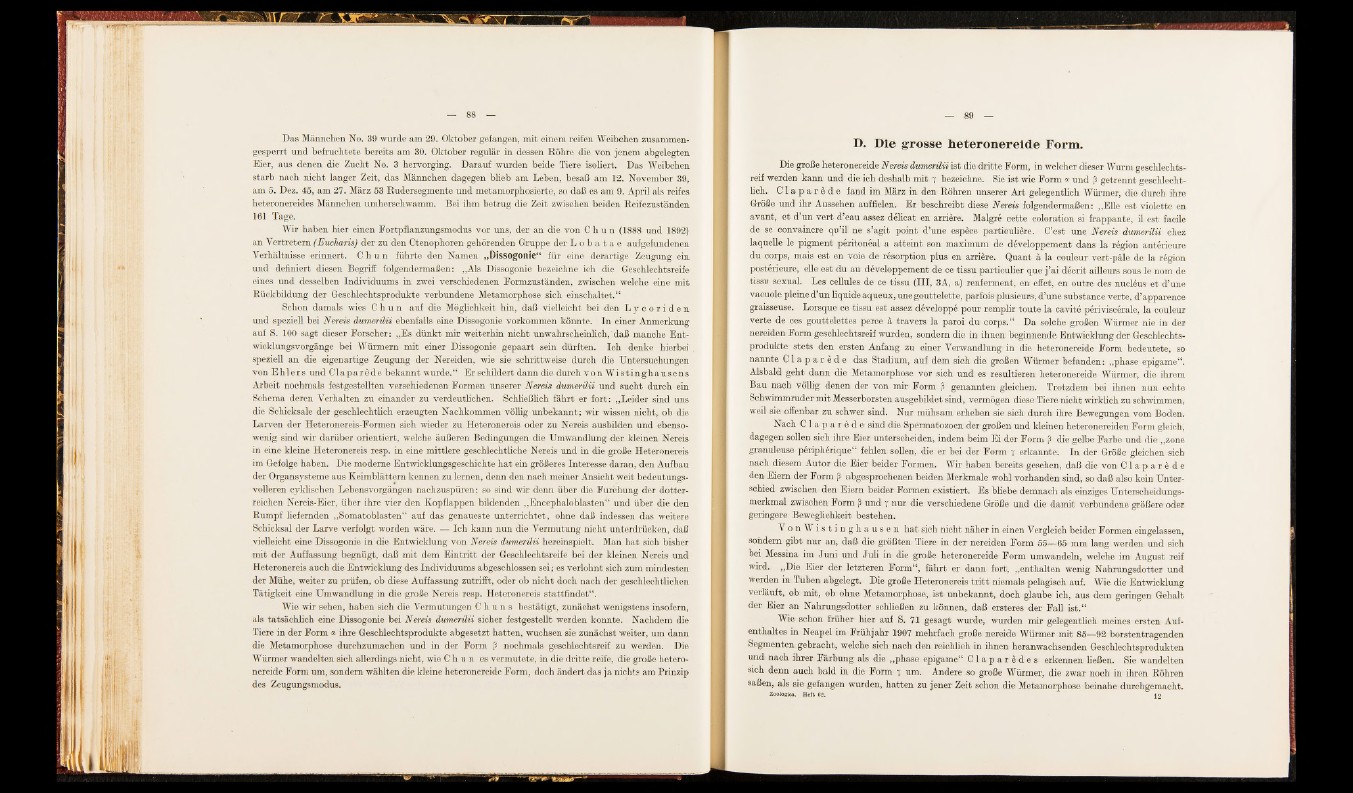
Das Männchen No. 39 wurde am 29. Oktober gefangen, mit einem reifen Weibchen zusammen-
gesperrt und befruchtete bereits am 30. Oktober regulär in dessen Röhre die von jenem abgelegten
Eier, aus denen die Zucht No. 3 hervorging. Darauf wurden beide Tiere isoliert. Das Weibchen
starb nach nicht langer Zeit, das Männchen dagegen blieb am Leben, besaß am 12. November 39,
am 5. Dez. 45, am 27. März 53 Rudersegmente und metamorphosierte, so daß es am 9. April als reifes
heteronereides Männchen umherschwamm. Bei ihm betrug die Zeit zwischen beiden Reifezuständen
161 Tage.
Wir haben hier einen Fortpflanzungsmodus vor uns, der an die von C h u n (1888 und 1892}
an Vertretern (Eucharis) der zu den Ctenophoren gehörenden Gruppe der L o b a t a e auf gefundenen
Verhältnisse erinnert. C h u n führte den Namen „Dissogonie“ für eine derartige Zeugung ein
und definiert diesen Begriff folgendermaßen: „Als Dissogonie bezeichne ich die Geschlechtsreife
eines und desselben Individuums in zwei verschiedenen Formzuständen, zwischen welche eine mit
Rückbildung der Geschlechtsprodukte verbundene Metamorphose sich einschaltet.“
Schon damals wies C h u n auf die Möglichkeit hin, daß vielleicht bei den L y c o r i d e n
und speziell bei Nereis dumerilii ebenfalls eine Dissogonie Vorkommen könnte. In einer Anmerkung
auf S. 100 sagt dieser Forscher: „Es dünkt mir weiterhin nicht unwahrscheinlich, daß manche Entwicklungsvorgänge
bei Würmern mit einer Dissogonie gepaart sein dürften. Ich denke hierbei
speziell an die eigenartige Zeugung der Nereiden, wie sie schrittweise durch die Untersuchungen
von Eh l e r s und Clapa r e d e bekannt wurde.“ Er schildert dann die durch v o n Wi s t i n ghau s en s
Arbeit nochmals festgestellten verschiedenen Formen unserer Nereis dumerilii und sucht durch ein
Schema deren Verhalten zu einander zu verdeutlichen. Schließlich fährt er fort: „Leider sind uns
die Schicksale der geschlechtlich erzeugten Nachkommen völlig unbekannt; wir wissen nicht,, ob die
Larven der Heteronereis-Formen sich wieder zu Heteronereis oder zu Nereis ausbilden und ebensowenig
sind wir darüber orientiert, welche äußeren Bedingungen die Umwandlung der kleinen Nereis
in eine kleine Heteronereis resp. in eine mittlere geschlechtliche Nereis und in die große Heteronereis
im Gefolge haben. Die moderne Entwicklungsgeschichte hat ein größeres Interesse daran, den Aufbau
der Organsysteme aus Keimblättern kennen zu lernen, denn den nach meiner Ansicht weit bedeutungsvolleren
cyklischen Lebensvorgängen nachzuspüren: so sind wir denn über die Furchung der dotterreichen
Nereis-Eier, über ihre vier den Kopflappen bildenden „Encephaloblasteh“ und über die den
Rumpf liefernden „Somatoblasten“ auf das genaueste unterrichtet, ohne daß indessen das weitere
Schicksal der Larve verfolgt worden wäre. — Ich kann nun die Vermutung nicht unterdrücken, daß
vielleicht eine Dissogonie in die Entwicklung von Nereis dumerilii hereinspielt. Man hat sich bisher
mit der Auffassung begnügt, daß mit dem Eintritt der Geschlechtsreife bei der kleinen Nereis nnd
Heteronereis auch die Entwicklung des Individuums abgeschlossen sei; es verlohnt sich zum mindesten
der Mühe, weiter zu prüfen, ob diese Auffassung zutrifft, oder ob nicht doch nach der geschlechtlichen
Tätigkeit eine Umwandlung in die große Nereis resp. Heteronereis stattfindet“.
Wie wir sehen, haben sich die Vermutungen C h u n s bestätigt, zunächst wenigstens insofern,
als tatsächlich eine Dissogonie bei Nereis dumerilii sicher festgestellt werden konnte. Nachdem die
Tiere in der Form a ihre Geschlechtsprodukte abgesetzt hatten, wuchsen sie zunächst weiter, um dann
die Metamorphose durchzumachen und in der Form ß nochmals geschlechtsreif zu werden. Die
Würmer wandelten sich allerdings nicht, wie C h u n es vermutete, in die dritte reife, die große hetero-
nereide Form um, sondern wählten die kleine heteronereide Form, doch ändert das ja nichts am Prinzip
des Zeugungsmodus.
D. Die grosse heteronereide Form.
Die große heteronereide Nereis dumerilii ist die dritte Form, in welcher dieser Wurm geschlechtsreif
werden kann und die ich deshalb mit r bezeichne. Sie ist wie Form a und ß getrennt geschlechtlich.
C1 a p a r è d e fand im März in den Röhren unserer Art gelegentlich Würmer, die durch ihre
Größe und ihr Aussehen auffielen. Er beschreibt diese Nereis folgendermaßen: „Elle est violette en
avant, et d’un vert d’eau assez délicat en arrière. Malgré cette coloration si frappante, il est facile
de se convaincre qu’il ne s’agit point d’une espèce particulière. C’est une Nereis dumerilii chez
laquelle le pigment péritonéal a atteint son maximum de développement dans la région antérieure
du corps, mais est en voie de résorption plus en arrière. Quant à la couleur vert-pâle de la région
postérieure, elle est du au développement de ce tissu particulier que j ’ai décrit ailleurs sous le nom de
tissu sexual. Les cellules de ce tissu (III, 3A, a) renferment, en effet, en outre des nucléus et d’une
vacuole pleine d’un liquide aqueux, une gouttelette, parfois plusieurs, d’une substance verte, d’apparence
graisseuse. Lorsque ce tissu est assez développé pour remplir toute la cavité périviscérale, la couleur
verte de ces gouttelettes perce à travers la paroi du- corps.“ Da solche großen Würmer nie in der
nereiden Form geschlechtsreif wurden, sondern die in ihneni beginnende Entwicklung der Geschlechtsprodukte
stets den ersten Anfang zu einer Verwandlung in die heteronereide Form bedeutete, so
nannte C l a p a r e d e das Stadium, auf dem sich die großen Würmer befanden: „phase epigame“.
Alsbald geht dann die Metamorphose vor sich und es resultieren heteronereide Würmer, die ihrem
Bau nach völlig denen der von mir Form ß genannten- gleichen. Trotzdem bei ihnen nun echte
Schwimmruder mit Messerborsten ausgebildet sind, vermögen diese Tiere nicht wirklich zu schwimmen,
weil sie offenbar zu schwer sind. Nur mühsam erheben sie. sich durch ihre Bewegungen vom Boden.
Nach C1 a p a r è d e sind die Spérmatozoen der großen und kleinen heteronereiden Form gleich,
dagegen sollen sich ihre Eier unterscheiden, indem beim Ei der Form ß die gelbe Farbe und die „zone
granuleuse périphérique“ fehlen, sollen, die er bei der Form x erkannte: In der Größe gleichen sich
nach diesem Autor die Eier beider Formen. Wir haben bereits gesehen, daß die von G l a p a r è d e
den Eiern der Form ß abgesprochenen beiden Merkmale wohl vorhandën sind, so daß also kein Unterschied
zwischen den Eiern beider Formen existiert. Es bliebe demnach als einziges Unterscheidungsmerkmal
zwischen Form ß und y n u r die verschiedene Größe und die damit verbundene größere oder
geringere Beweglichkeit bestehen;
V o n W i s t i n g h a u s e n hat sich nicht näher in einen Vergleich beider Formen eingelassen,
sondern gibt nur an, daß die größten Tiere in der nereiden Form 55—65 mm lang werden und sich
bei Messina im Juni und Juli in die große heteronereide Form um wandeln, welche im August reif
wird. „Die Eier der letzteren Form“, fährt er dann fort, „enthalten wenig Nahrungsdotter und
werden in Tuben abgelegt. Die große Heteronereis tritt niemals pelagisch auf. Wie die Entwicklung
verläuft, ob mit, ob ohne Metamorphose, ist unbekannt, doch glaube; ich, aus dem geringen Gehalt
der Eier an Nahrungsdotter schließen zu können, daß ersteres der Fall ist.“
Wie schon früher hier auf S. 71 gesagt wurde, wurden mir gelegentlich meines ersten Auf*
enthaltes in Neapel im Frühjahr 1907 mehrfach große nereide Würmer mit 85—92 borstentragenden
Segmenten gebracht, welche sich nach den reichlich in ihnen heranwachsenden Geschlechtsprodukten
und nach ihrer Färbung als die „phase epigame“ G l a p a r è d e s erkennen ließen. Sie wandelten
sich denn auch bald in die Form x um. Andere so große Würmer, die zwar noch in ihren Röhren
saßen, als sie gefangen wurden, hatten zu jener Zeit schon die Metamorphose beinahe durchgemacht.
Zoologica. H e ft 62. £ 2