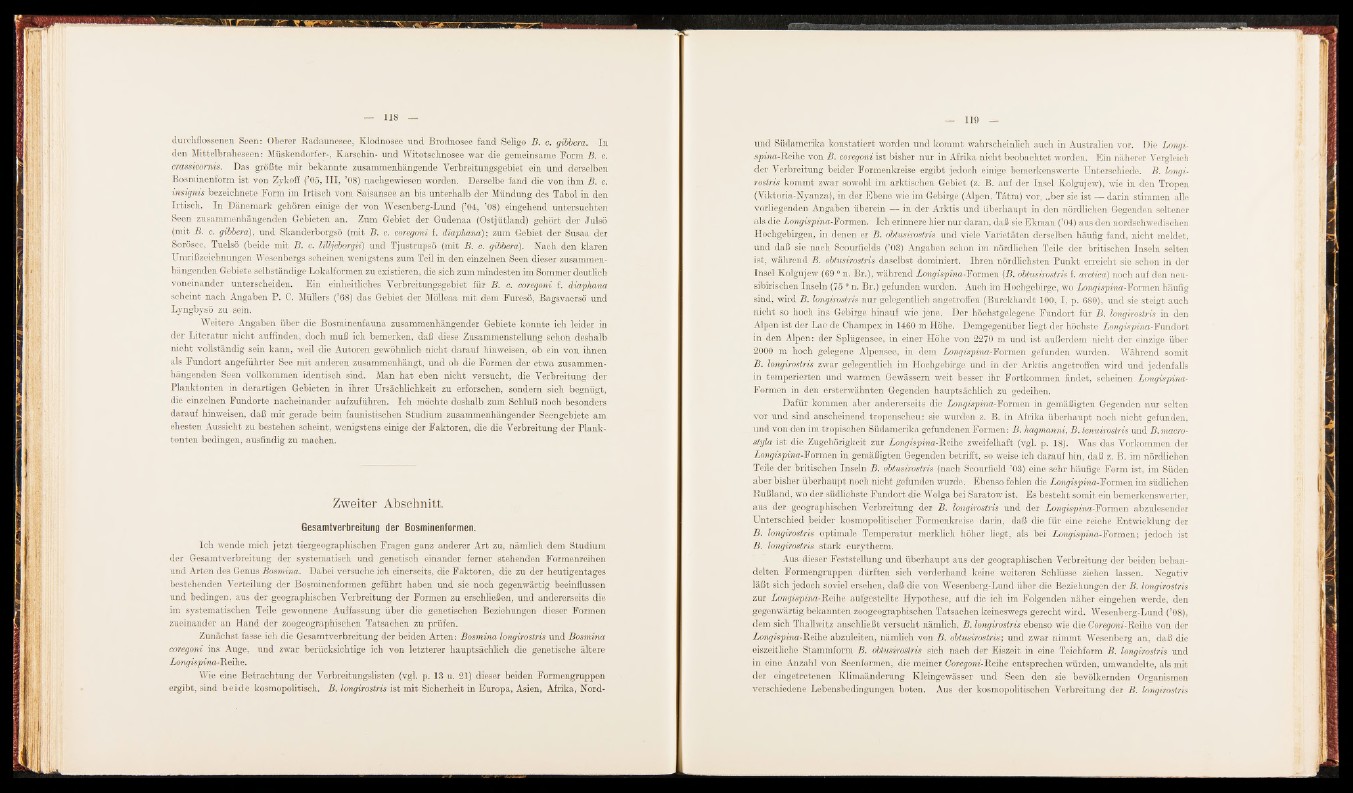
durchflossenen Seen: Oberer Radaunesee, Klodnosee und Brodnosee fand Seligo B. c. gibbera. In
den Mittelbraheseen: Müskendorfer-, Karschin- und Witotschnosee war die gemeinsame Form B. c.
crassicornis. Das größte mir bekannte zusammenhängende Verbreitungsgebiet ein und derselben
Bosminenform ist von Zykoff (’05, III, ’08) nachgewiesen worden. Derselbe fand die von ihm B. c.
insignis bezeichnete Form im Irtisch vom Saisansee an bis unterhalb der Mündung des Tabol in den
Irtisch. In Dänemark gehören einige der von Wesenberg-Lund (’04, ’08) eingehend untersuchten
Seen zusammenhängenden Gebieten an. Zum Gebiet der Gudenaa (Ostjütland) gehört der Julsö
(mit B. c. gibbera), und Skanderborgsö (mit B. c. coregoni f. diaphana); zum Gebiet der Susaa der
Sorösee, Tuelsö (beide mit B. c. liUjeborgii) und Tjustrupsö (mit B.c. gibbera). Nach den klaren
Umrißzeichnungen Wesenbergs scheinen wenigstens zum Teil in den einzelnen Seen dieser zusammenhängenden
Gebiete selbständige Lokalformen zu existieren, die sich zum mindesten im Sommer deutlich
voneinander unterscheiden. Ein einheitliches Verbreitungsgebiet für B. c. coregoni f. diaphana
scheint nach Angaben P. C. Müllers (’68) das Gebiet der Mölleaa mit dem Furesö, Bagsvaersö und
Lyngbysö zu sein.
Weitere Angaben über die Bosminenfauna zusammenhängender Gebiete konnte ich leider in
der Literatur nicht auffinden, doch muß ich bemerken, daß diese Zusammenstellung schon deshalb
nicht vollständig sein kann, weil die Autoren gewöhnlich nicht darauf hinweisen, ob ein von ihnen
als Fundort angeführter See mit anderen zusammenhängt, und ob die Formen der etwa zusammenhängenden
Seen vollkommen identisch sind. Man hat eben nicht versucht, die Verbreitung der
Planktonten in derartigen Gebieten in ihrer Ursächlichkeit zu erforschen, sondern sich begnügt,
die einzelnen Fundorte nacheinander aufzuführen. Ich möchte deshalb zum Schluß noch besonders
darauf hinweisen, daß mir gerade beim faunistischen Studium zusammenhängender Seengebiete am
ehesten Aussicht zu bestehen scheint, wenigstens einige der Faktoren, die die Verbreitung der Planktonten
bedingen, ausfindig zu machen.
Zweiter Abschnitt.
Gesamtverbreitung der Bosminenformen.
Ich wende mich jetzt tiergeographischen Fragen ganz anderer Art zu, nämlich dem Studium
der Gesamtverbreitung der systematisch und genetisch einander ferner stehenden Formenreihen
und Arten des Genus Bosmina. Dabei versuche ich einerseits, die Faktoren, die zu der heutigentages
bestehenden Verteilung der Bosminenformen geführt haben und sie noch gegenwärtig beeinflussen
und bedingen, aus der geographischen Verbreitung der Formen zu erschließen, und andererseits die
im systematischen Teile gewonnene Auffassung über die genetischen Beziehungen dieser Formen
zueinander an Hand der zoogeographischen Tatsachen zu prüfen.
Zunächst fasse ich die Gesamtverbreitung der beiden Arten: Bosmina longirostris und Bosmina
coregoni ins Auge, und zwar berücksichtige ich von letzterer hauptsächlich die genetische ältere
Longispina-Beihe.
Wie eine Betrachtung der Verbreitungslisten (vgl. p. 13 u. 21) dieser beiden Formengruppen
ergibt, sind b e id e kosmopolitisch. B. longirostris ist mit Sicherheit in Europa, Asien, Afrika, Nordund
Südamerika konstatiert worden und kommt wahrscheinlich auch in Australien vor. Die Longi-
spwm-Reihe von B. coregoni ist bisher nur in Afrika nicht beobachtet worden. Ein näherer Vergleich
der Verbreitung beider Formenkreise ergibt jedoch einige bemerkenswerte Unterschiede. B. longirostris
kommt zwar sowohl im arktischen Gebiet (z. B. auf der Insel Kolgujew), wie in den Tropen
(Viktoria-Nyanza), in der Ebene wie im Gebirge (Alpen, Tatra) vor, „ber sie ist — darin stimmen alle
vorliegenden Angaben überein — in der Arktis und überhaupt in den nördlichen Gegenden seltener
als die Longispina-Formen. Ich erinnere hier nur daran, daß sie Ekman (’04) aus den nordschwedischen
Hochgebirgen, in denen er B. obtusirostris und viele Varietäten derselben häufig fand, nicht meldet,
und daß sie nach Scourfields (’03) Angaben schon im nördlichen Teile der britischen Inseln selten
ist, während B. obtusirostris daselbst dominiert. Ihren nördlichsten Punkt erreicht sie schon in der
Insel Kolgujew (69 0 n. Br.), während Longispina-Formen (B. obtusirostris f. arcticd) noch auf den neusibirischen
Inseln (750 n. Br.) gefunden wurden. Auch im Hochgebirge, wo Longispina-¥oimen häufig
sind, wird B. longirostris nur gelegentlich angetroffen (Burckhardt 100, I, p. 680), und sie steigt auch
nicht so hoch ins Gebirge hinauf wie jene. Der höchstgelegene Fundort für B. longirostris in den
Alpen ist der Lac de Champex in 1460 m Höhe. Demgegenüber liegt der höchste Longispina-¥undoTt
in den Alpen: der Splügensee, in einer Höhe von 2270 m und ist außerdem nicht der einzige über
2000 m hoch gelegene Alpensee, in dem Longispina-Formen gefunden wurden. Während somit
B. longirostris zwar gelegentlich im Hochgebirge und in der Arktis angetroffen wird und jedenfalls
in temperierten und warmen Gewässern weit besser ihr Fortkommen findet, scheinen Longispina-
Formen in den ersterwähnten Gegenden hauptsächlich zu gedeihen.
Dafür kommen aber andererseits die Longispina-’Foimva. in gemäßigten Gegenden nur selten
vor und sind anscheinend tropenscheu: sie wurden z. B. in Afrika überhaupt noch nicht gefunden,
und von den im tropischen Südamerika gefundenen Formen: B. hagmanni, B. tenuirostris und B. macro-
styla ist die Zugehörigkeit zur Longispina-Beihe zweifelhaft (vgl. p. 18). Was das Vorkommen der
Longispina-Formen in gemäßigten Gegenden betrifft, so weise ich darauf hin, daß z. B. im nördlichen
Teile der britischen Inseln B. obtusirostris (nach Scourfield ’03) eine sehr häufige Form ist, im Süden
aber bisher überhaupt noch nicht gefunden wurde. Ebenso fehlen die Longispina-'Foimen im südlichen
Rußland, wo der südlichste Fundort die Wolga bei Saratow ist. Es besteht somit ein bemerkenswerter,
aus der geographischen Verbreitung der B. longirostris und der Longispina-Formen abzulesender
Unterschied beider kosmopolitischer Formenkreise darin, daß die für eine reiche Entwicklung der
B. longirostris optimale Temperatur merklich höher liegt, als bei Longispina-Formen; jedoch ist
B. longirostris stark eurytherm.
Aus dieser Feststellung und überhaupt aus der geographischen Verbreitung der beiden behandelten
Formengruppen dürften sich vorderhand keine weiteren Schlüsse ziehen lassen. Negativ
läßt sich jedoch soviel ersehen, daß die von Wesenberg-Lund über die Beziehungen der B. longirostris
zur Longispina-Beihe aufgestellte Hypothese, auf die ich im Folgenden näher eingehen werde, den
gegenwärtig bekannten zoogeographischen Tatsachen keineswegs gerecht wird. Wesenberg-Lund (’08),
dem sich Thallwitz anschließt versucht nämlich, B. longirostris ebenso wie die Oore^om'-Reihe von der
Longispina-Bfähe, abzuleiten, nämlich von B. obtusirostris; und zwar nimmt Wesenberg an, daß die
eiszeitliche Stammform B. obtusirostris sich nach der Eiszeit in eine Teichform B. longirostris und
in eine Anzahl von Seenformen, die meiner Oore^om-Reihe entsprechen würden, umwandelte, als mit
der eingetretenen Klimaänderung Kleingewässer und Seen den sie bevölkernden Organismen
verschiedene Lebensbedingungen boten. Aus der kosmopolitischen Verbreitung der B. longirostris