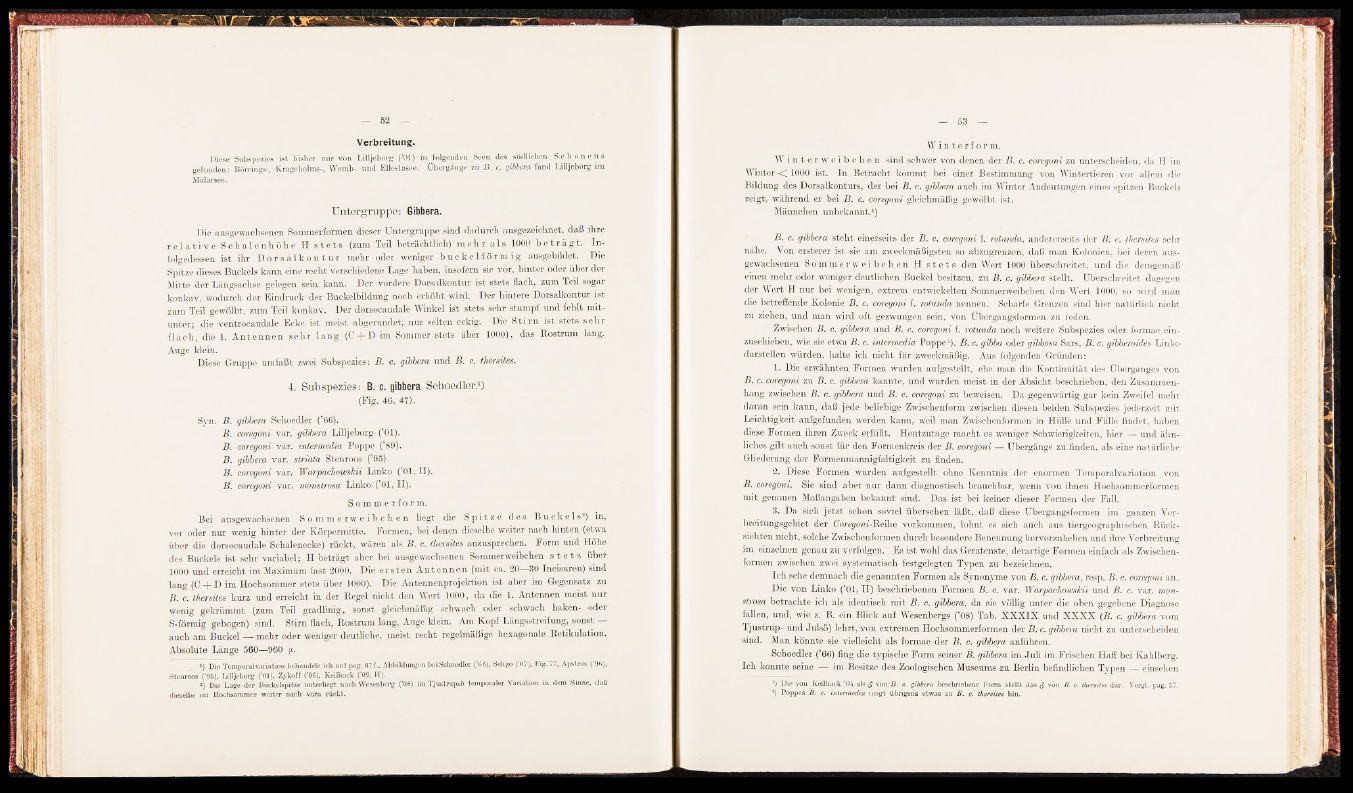
Verbreitung.
Diese Subspezies ist bisher nur von Lilljeborg (’01) in folgenden Seen des südlichen So h o n e n s
gefunden: Börrings-, Krageholms-, Womb- und Ellestasee. Übergänge zu B.^c. gibbera fand Lilljeborg im
Mälarsee.
Untergruppe: Gibbera.
Die ausgewachsenen Sommerformen dieser Untergruppe sind dadurch ausgezeichnet, daß ihre
r e l a t i v e S o h a l e n h ö h e H' s t e t s (zum Teil beträchtlich) me h r al s 1000 b e t r ä g t . In folgedessen
ist ihr D o r s a l k o n t u r mehr oder weniger b u c k e l f ö rm i g ausgebildet. Die
Spitze dieses Buckels kann eine recht verschiedene Lage haben, insofern sie vor, hinter oder über der
Mitte der Längsachse gelegen sein kann. Der vordere Dorsalkontur ist stets flach, zum Teil sogar
konkav, wodurch der Eindruck der Buckelbildung noch erhöht wird. Der hintere Dorsalkontur ist
zum Teil gewölbt, zum Teil konkav. Der dorsocaudale Winkel ist stets sehr stumpf und fehlt mitunter;
die ventrocaudale Ecke ist meist abgerundet, nur selten eckig. Die St i rn ist stets sehr
f lach, die 1. Ant ennen sehr lang (C + ü im Sommer stets über 1000), das Rostrum lang.
Auge klein.
Diese Gruppe umfaßt zwei Subspezies: B. c. gibbera und B. c. thersites.
4. Subspezies: B. c. gibbera Schoedler.1)
(Fig. 46, 47).
Syn. B. gibbera Schoedler (’66).
B. coregoni var. gibbera Lilljeborg (’01).
B. coregoni var. inlermedia Poppe (’89).
B. gibbera var. striata Stenroos (’95).
B. coregoni var. Warpachowskii Linko (’01, II).
B. coregoni var. monstrosa Linko (’01, II).
S o m m e r f o r m .
Bei ausgewachsenen S o m m e r w e i b c h e n liegt die S p i t z e des B u c k e l s 2) in,
vor oder nur wenig hinter der Körpermitte. Formen, bei denen dieselbe weiter nach hinten (etwa
über die dorsocaudale Schalenecke) rückt, wären als B. c. thersites anzusprechen. Form und Höhe
des Buckels ist sehr variabel; II beträgt aber bei ausgewachsenen Sommerweibchen s t e t s über
1000 und erreicht im Maximum fast 2000. Die er s t en Ant ennen (mit ca. 20 30 Incisuren) sind
lang (C -j- D im Hochsommer stets über 1000). Die Antennenprojektion ist aber im Gegensatz zu
B. c. thersites kurz und erreicht in der Regel nicht den Wert 1000, da die 1. Antennen meist nur
wenig gekrümmt (zum Teil gradlinig, sonst gleichmäßig schwach oder schwach haken- oder
S-förmig gebogen) sind. Stirn flach, Rostrum lang, Auge klein. Am Kopf Längsstreifung, sonst
auch am Buckel — mehr oder weniger deutliche, meist recht regelmäßige hexagonale Retikulation.
Absolute Länge 560—960 p..
i) Die Temporalvariation behandele ich auf pag. 87 f., Abbildungen bei Schoedler (’66), Seligo (’07), Fig. 77, Apstein (’96),
Stenroos (’95), Lilljeborg (’01), Zykoff (’06), Keilhack (’09, II).
*) Die Lage der Buckelspitze unterliegt nach Wesenberg (’08) im Tjustrupsö temporaler Variation in dem Sinne, daß
dieselbe im Hochsommer weiter nach vorn rückt.
Wi n t e r f o r m .
W i n t e r w e i b c h e n sind schwer von denen der B. c. coregoni zu unterscheiden, da H im
Winter <C 1000 ist. In Betracht kommt bei einer Bestimmung von Wintertieren vor allem die
Bildung des Dorsalkonturs, der bei B. c. gibbera auch im Winter Andeutungen eines spitzen Buckels
zeigt, während er bei B. c. coregoni gleichmäßig gewölbt ist.
Männchen unbekannt.1)
B. c. gibbera steht einerseits der B. c. coregoni f. rotunda, andererseits der B. c. thersites sehr
nahe. Von ersterer ist sie am zweckmäßigsten so abzugrenzen, daß man Kolonien, bei deren ausgewachsenen
S om m e rw e i b c h e n II s t e t s den Wert 1000 überschreitet, und die demgemäß
einen mehr oder weniger deutlichen Buckel besitzen, zu B. c. gibbera stellt. Überschreitet dagegen
der Wert H nur bei wenigen, extrem entwickelten Sommerweibchen den Wert 1000, so wird man
die betreffende Kolonie B. c. coregoni f. rotunda nennen. Scharfe Grenzen sind hier natürlich nicht
zu ziehen, und man wird oft gezwungen sein, von Übergangsformen zu reden.
Zwischen B. c. gibbera und B. % coregoni f. rotunda noch weitere Subspezies oder formae einzuschieben,
wie sie etwa B. c. intermedia Poppe2), B. c. gibba oder gibbosa Sars, B. c. gibberoides Linko
darstellen würden, halte ich nicht für zweckmäßig. Aus folgenden Gründen:
1. Die erwähnten Formen wurden auf gestellt, ehe man die Kontinuität des Überganges von
B. c. coregoni zu B. c. gibbera kannte, und wurden meist in der Absicht beschrieben, den Zusammenhang
zwischen B. c. gibbera und B. c. coregoni zu beweisen. Da gegenwärtig gar kein Zweifel mehr
daran sein kann, daß jede beliebige Zwischenform zwischen diesen beiden Subspezies jederzeit mit
Leichtigkeit aufgefunden werden kann, weil man Zwischenformen in Hülle und Fülle findet, haben
diese Formen ihren Zweck erfüllt. Heutzutage macht es weniger Schwierigkeiten, hier — und ähnliches
gilt auch sonst für den Formenkreis der B. coregoni — Übergänge zu finden, als eine natürliche
Gliederung der Formenmannigfaltigkeit zu finden.
2. Diese Formen wurden auf gestellt ohne Kenntnis der enormen Temporalvariation von
B. coregoni. Sie sind aber nur dann diagnostisch brauchbar, wenn von ihnen Hochsommerformen
mit genauen Maßangaben bekannt sind. Das ist bei keiner dieser Formen der Fall.
3. Da sich jetzt schon soviel übersehen läßt, daß diese Übergangsformen im ganzen Verbreitungsgebiet
der Coregoni-Reihe Vorkommen, lohnt es sich auch aus tiergeographischen Rücksichten
nicht, solche Zwischenformen durch besondere Benennung hervorzuheben und ihre Verbreitung
im einzelnen genau zu verfolgen. Es ist wohl das Geratenste, derartige Formen einfach als Zwischenformen
zwischen zwei systematisch festgelegten Typen zu bezeichnen.
Ich sehe demnach die genannten Formen als Synonyme von B. c. gibbera, resp. B. c. coregoni an.
Die von Linko (’01, II) beschriebenen Formen B. c. var. Warpachowskii und B. c. var. monstrosa
betrachte ich als identisch mit B. c. gibbera, da sie völlig unter die oben gegebene Diagnose
fallen, und, wie z. B. ein Blick auf Wesenbergs (’08) Tab. XXXIX und XXXX (B. c. gibbera vom
Tjustrup- und Julsö) lehrt, von extremen Hochsommerformen der B. c. gibbera nicht zu unterscheiden
sind. Man könnte sie vielleicht als formae der B. c. gibbera anführen.
Schoedler (’66) fing die typische Form seiner B. gibbera im Juli im Frischen Haff bei Kahlberg.
Ich konnte seine — im Besitze des Zoologischen Museums zu Berlin befindlichen Typen — einsehen
l) Die von Keilhack ’04 als von B. c. gibbera beschriebene Form stellt das <J von B. c. thersites dar. Vergl. pag. 57.
*) Poppes B. c. intermedia neigt übrigens etwas zu B. c. thersites hin.