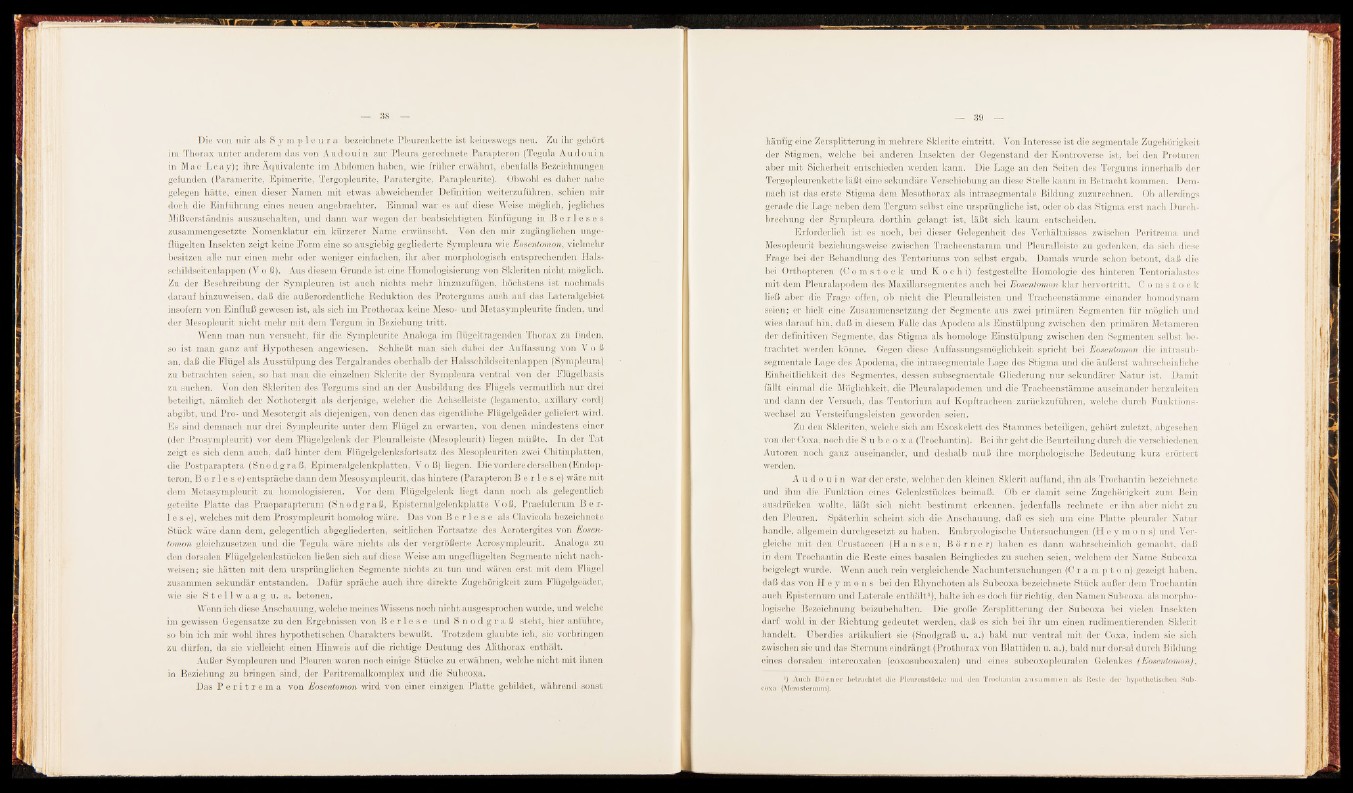
Die von mir als S y m p l e u r a bezeichnete Pleurenkette ist keineswegs neu. Zu ihr gehört
im Thorax unter anderem das von Audoui n zur Pleura gerechnete Parapteron (Tegula Audouin
in Mac L e a y); ihre Äquivalente im Abdomen haben, wie früher erwähnt, ebenfalls Bezeichnungen
gefunden (Paramerite, Epimerite, Tergopleurite, Paratergite, Parapleurite). Obwohl es daher nahe
gelegen hätte, einen dieser Namen mit etwas abweichender Definition weiterzuführen, schien mir
doch die Einführung eines neuen angebrachter. Einmal war es auf diese Weise möglich, jegliches
Mißverständnis auszuschalten, und dann war wegen der beabsichtigten Einfügung in B e r l e s e s
zusammengesetzte Nomenklatur ein kürzerer Name erwünscht. Von den mir zugänglichen ungeflügelten
Insekten zeigt keine Form eine so ausgiebig gegliederte Sympleura wie Eosentomon, vielmehr
besitzen alle nur einen mehr oder weniger einfachen, ihr aber morphologisch entsprechenden Halsschildseitenlappen
(V o ß). Aus diesem Grunde ist eine Homologisierung von Skleriten nicht möglich.
Zu der Beschreibung der Sympleuren ist auch nichts mehr hinzuzufügen, höchstens ist nochmals
darauf hinzuweisen, daß die außerordentliche Reduktion des Protergums auch auf das Lateralgebiet
insofern von Einfluß gewesen ist, als sich im Prothorax keine Meso- und Metasympleurite finden, und
der Mesopleurit nicht mehr mit dem Tergum in Beziehung tritt.
Wenn man nun versucht, für die Sympleurite Analoga im flügeltragenden Thorax zu finden,
so ist man ganz auf Hypothesen angewiesen. Schließt man sich dabei der Auffassung von V o ß
an, daß die Flügel als Ausstülpung des Tergalrandes oberhalb der Halsschildseitenlappen (Sympleura)
zu betrachten seien, so hat man die einzelnen Sklerite der Sympleura ventral von der Flügelbasis
zu suchen. Von den Skleriten des Tergums sind an der Ausbildung des Flügels vermutlich nur drei
beteiligt, nämlich der Nothotergit als derjenige, welcher die Achselleiste (legamento, axillary cord)
abgibt, und Pro- und Mesotergit als diejenigen, von denen das eigentliche Flügelgeäder geliefert wird.
Es sind demnach nur drei Sympleurite unter dem Flügel zu erwarten, von denen mindestens einer
(der Prosympleurit) vor dem Flügelgelenk der Pleuralleiste (Mesopleurit) liegen müßte. In der Tat
zeigt es sich denn auch, daß hinter dem Flügelgelenksfortsatz des Mesopleuriten zwei Chitinplatten,
die Postparaptera (Snodgraß, Epimeralgelenkplatten, V o ß) liegen. Die vordere derselben (Endop-
teron, B e r 1 e s e) entspräche dann dem Mesosympleurit, das hintere (Parapteron B e r 1 e s e) wäre mit
dem Metasympleurit zu homologisieren. Vor dem Flügelgelenk liegt dann noch als gelegentlich
geteilte Platte das Praeparapterum (Snodgraß, Episternalgelenkplatte Voß, Praefulcrum Ber -
1 e s e), welches mit dem Prosympleurit homolog wäre. Das von B e r l e s e als Clavicola bezeichnete
Stück wäre dann dem, gelegentlich abgegliederten, seitlichen Fortsatze des Acrotergites von Eosentomon
gleichzusetzen und die Tegula wäre nichts als der vergrößerte Acrosympleurit. Analoga zu
den dorsalen Flügelgelenkstücken ließen sich auf diese Weise am ungeflügelten Segmente nicht nach-
weisen; sie hätten mit dem ursprünglichen Segmente nichts zu tun und wären erst mit dem Flügel
zusammen sekundär entstanden. Dafür spräche auch ihre direkte Zugehörigkeit zum Flügelgeäder,
wie sie S t e 11 w a a g u. a. betonen.
Wenn ich diese Anschauung, welche meines Wissens noch nicht ausgesprochen wurde, und welche
im gewissen Gegensätze zu den Ergebnissen von B e r l e s e und S n o d g r a ß steht, hier anführe,
so bin ich mir wohl ihres hypothetischen Charakters bewußt. Trotzdem glaubte ich, sie Vorbringen
zu dürfen, da sie vielleicht einen Hinweis auf die richtige Deutung des Alithorax enthält.
Außer Sympleuren und Pleuren waren noch einige Stücke zu erwähnen, welche nicht mit ihnen
in Beziehung zu bringen sind, der Peritremalkomplex und die Subcoxa.
Das P e r i t r e m a von Eosentomon wird von einer einzigen Platte gebildet, während sonst
häufig eine Zersplitterung in mehrere Sklerite eintritt. Von Interesse ist die segméntale Zugehörigkeit
der Stigmen, welche bei anderen Insekten der Gegenstand der Kontroverse ist, bei den Proturen
aber mit Sicherheit entschieden werden kann. Die Lage an den Seiten des Tergums innerhalb der
Tergopleurenkette läßt eine sekundäre Verschiebung an diese Stelle kaum in Betracht kommen. Demnach
ist das erste Stigma dem Mesothorax als intrasegmentale Bildung zuzurechnen. Ob allerdings
gerade die Lage neben dem Tergum selbst eine ursprüngliche ist, oder ob das Stigma erst nach Durchbrechung
der Sympleura dorthin gelangt ist, läßt sich kaum entscheiden.
Erforderlich ist es noch, bei dieser Gelegenheit des Verhältnisses zwischen Peritrema und
Mesopleurit beziehungsweise zwischen Tracheenstamm und Pleuralleiste zu gedenken, da sich diese
Frage bei der Behandlung des Tentoriums von selbst ergab. Damals wurde schon betont, daß die
bei Orthopteren ( C o m s t o c k und K o c h i) festgestellte Homologie des hinteren Tentorialastes
mit dem Pleuralapodem des Maxillarsegmentes auch bei Eosentomon klar hervortritt. C o m s t o c k
ließ aber die Frage offen, ob nicht die Pleuralleisten und Tracheenstämme einander homodynam
seien; er hielt eine Zusammensetzung der Segmente aus zwei primären Segmenten für möglich und
wies darauf hin, daß in diesem Falle das Apodem als Einstülpung zwischen den primären Metameren
der definitiven Segmente, das Stigma als homologe Einstülpung zwischen den Segmenten selbst betrachtet
werden könne. Gegen diese Auffassungsmöglichkeit spricht bei Eosentomon die intrasub-
segmentale Lage des Apodema, die intrasegmentale Lage des Stigma und die äußerst wahrscheinliche
Einheitlichkeit des Segmentes, dessen subsegmentale Gliederung nur sekundärer Natur ist. Damit
fällt einmal die Möglichkeit, die Pleuralapodemen und die Tracheenstämme auseinander herzuleiten
und dann der Versuch, das Tentorium auf Kopftracheen zurückzuführen, welche durch Funktionswechsel
zu Versteifungsleisten geworden seien.
Zu den Skleriten, welche sich am Exoskelett des Stammes beteiligen, gehört zuletzt, abgesehen
von der Coxa, noch die S u b c o x a (Trochantin). Bei ihr geht die Beurteilung durch die verschiedenen
Autoren noch ganz auseinander, und deshalb muß ihre morphologische Bedeutung kurz erörtert
werden.
A u d o u i n war der erste, welcher den kleinen Sklerit auffand, ihn als Trochantin bezeichnete
und ihm die Funktion eines Gelenkstückes beimaß. Ob er damit seine Zugehörigkeit zum Bein
ausdrücken wollte, läßt sich nicht bestimmt erkennen, jedenfalls rechnete er ihn aber nicht zu
den Pleuren. Späterhin scheint sich die Anschauung, daß es sich um eine Platte pleuraler Natur
handle, allgemein durchgesetzt zu haben. Embryologische Untersuchungen (H e y m o n s) und Vergleiche
mit den Crustaceen ( Ha n s e n , B ö r n e r ) haben es dann wahrscheinlich gemacht, daß
in dem Trochantin die Reste eines basalen Beingliedes zu suchen seien, welchem der Name Subcoxa
beigelegt wurde. Wenn auch rein vergleichende Nachuntersuchungen ( C r a m p t o n ) gezeigt haben,
daß das von H e y m o n s bei den Rhynchoten als Subcoxa bezeichnete Stück außer dem Trochantin
auch Episternum und Laterale enthält1), halte ich es doch für richtig, den Namen Subcoxa als morphologische
Bezeichnung beizubehalten. Die große Zersplitterung der Subcoxa bei. vielen Insekten
darf wohl in der Richtung gedeutet werden, daß es sich bei ihr um einen rudimentierenden Sklerit
handelt. Überdies artikuliert sie (Snodgraß u. a.) bald nur ventral mit der Coxa, indem sie sich
z wischen sie und das Sternum eindrängt (Prothorax von Blattiden u. a.), bald nur dorsal durch Bildung
eines dorsalen intercoxalen (coxosubcoxalen) und eines subcoxopleuralen Gelenkes (Eosentomon),
J) Auch B ö r .n e r betra chtet die Pleurenstücke und den Trochantin z u s a m m e n als Reste der hypothetischen Subcoxa
(Merosternum).