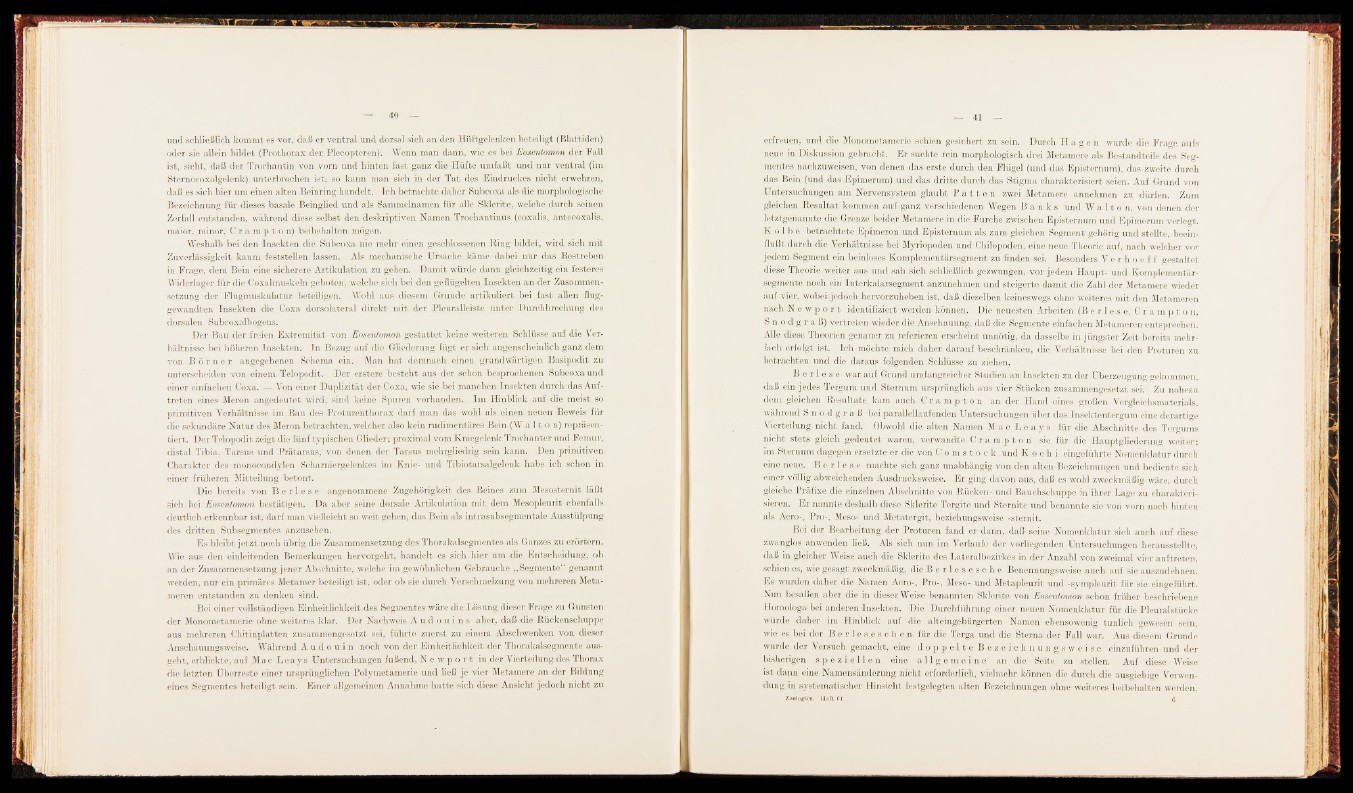
und schließlich kommt es vor, daß er ventral und dorsal sich an den Hüftgelenken beteiligt (Blattiden)
oder sie allein bildet (Prothorax der Plecopteren). Wenn man dann, wie es bei Eosentomon der Fall
ist, sieht, daß der Trochantin von vorn und hinten fast ganz die Hüfte umfaßt und nur ventral (im
Sternocoxalgelenk) unterbrochen ist, so kann man sich in der Tat des Eindruckes nicht erwehren,
daß es sich hier um einen alten Beinring handelt. Ich betrachte daher Subcoxa als die morphologische
Bezeichnung für dieses basale Beinglied und als Sammelnamen für alle Sklerite, welche durch seinen
Zerfall entstanden, während diese selbst den deskriptiven Namen Trochantinus (coxalis, antecoxalis,
maior, minor, C r am p t o n ) beibehalten mögen.
Weshalb bei den Insekten die Subcoxa nie mehr einen geschlossenen Ring bildet, wird sich mit
Zuverlässigkeit kaum feststellen lassen. Als mechanische Ursache käme dabei nur das Bestreben
in Frage, dem Bein eine sicherere Artikulation zu geben. Damit würde dann gleichzeitig ein festeres
Widerlager für die Coxalmuskeln geboten, welche sich bei den geflügelten Insekten an der Zusammensetzung
der Flugmuskulatur beteiligen. Wohl aus diesem Grunde artikuliert bei fast allen fluggewandten
Insekten die Coxa dorsolateral direkt mit der Pleuralleiste unter Durchbrechung des
dorsalen Subcoxalbogens.
Der Bau der freien Extremität von Eosentomon gestattet keine weiteren Schlüsse auf die Verhältnisse
bei höheren Insekten. In Bezug auf die Gliederung fügt er sich augenscheinlich ganz dem
von B ö r n e r angegebenen Schema ein. Man hat demnach einen grundwärtigen Basipodit zu
unterscheiden von einem Telopodit. Der erstere besteht aus der schon besprochenen Subcoxa und
einer einfachen Coxa. — Von einer Duplizität der Coxa, wie sie bei manchen Insekten durch das Auftreten
eines Meron angedeutet wird, sind keine Spuren vorhanden. Im Hinblick auf die meist so
primitiven Verhältnisse im Bau des Proturenthorax darf man das wohl als einen neuen Beweis für
die sekundäre Natur des Meron betrachten, welcher also kein rudimentäres Bein (W a 11 o n) repräsentiert.
Der Telopodit zeigt die fünf typischen Glieder; proximal vom Kniegelenk Trochanter und Femur,
distal Tibia, Tarsus und Prätarsus, von denen der Tarsus mehrgliedrig sein kann. Den primitiven
Charakter des monocondylen Scharniergelenkes im Knie- und Tibiotarsalgelenk habe ich schon in
einer früheren Mitteilung betont.
Die bereits von B e r 1 e s e angenommene Zugehörigkeit des Beines zum Mesosternit läßt
sich bei Eosentomon bestätigen. Da aber seine dorsale Artikulation mit dem Mesopleurit ebenfalls
deutlich erkennbar ist, darf man vielleicht so weit gehen, das Bein als intrasubsegmentale Ausstülpung
des dritten Subsegmentes anzusehen.
Es bleibt jetzt noch übrig die Zusammensetzung des Thorakalsegmentes als Ganzes zu erörtern.
Wie aus den einleitenden Bemerkungen hervorgeht, handelt es sich hier um die Entscheidung, ob
an der Zusammensetzung jener Abschnitte, welche im gewöhnlichen Gebrauche „Segmente“ genannt
werden, nur ein primäres Metamer beteiligt ist, oder ob sie durch Verschmelzung von mehreren Meta-
meren entstanden zu denken sind.
Bei einer vollständigen Einheitlichkeit des Segmentes wäre die Lösung dieser Frage zu Gunsten
der Monometamerie ohne weiteres klar. Der Nachweis A u d o u i n s aber, daß die Rückenschuppe
aus mehreren Chitinplatten zusammengesetzt sei, führte zuerst zu einem Abschwenken von dieser
Anschauungsweise. Während A u d o u i n noch von der Einheitlichkeit der Thorakalsegmente ausgeht,
erblickte, auf Mac Leays Untersuchungen fußend, N e w p o r t in der Vierteilung des Thorax
die letzten Überreste einer ursprünglichen Polymetamerie und ließ je vier Metamere an der Bildung
eines Segmentes beteiligt sein. Einer allgemeinen Annahme hatte sich diese Ansicht jedoch nicht zu
erfreuen, und die Monometamerie schien gesichert zu sein. Durch H a g e n wurde die Frage aufs
neue in Diskussion gebracht. Er suchte rein morphologisch drei Metamere als Bestandteile des Segmentes
nachzuweisen, von denen das erste durch den Flügel (und das Episternum), das zweite durch
das Bein (und das Epimerum) und das dritte durch das Stigma charakterisiert seien. Auf Grund von
Untersuchungen am Nervensystem glaubt P a t t e n zwei Metamere annehmen zu dürfen. Zum
gleichen Resultat kommen auf ganz verschiedenen Wegen B a n k s und W a 11 o n, von denen der
letztgenannte die Grenze beider Metamere in die Furche zwischen Episternum und Epimerum verlegt.
K o l b e betrachtete Epimeron und Episternum als zum gleichen Segment gehörig und stellte, beeinflußt
durch die Verhältnisse bei Myriopoden und Chilopoden, eine neue Theorie auf, nach welcher vor
jedem Segment ein beinloses Komplementärsegment zu finden sei. Besonders V e r h o e f f gestaltet
diese Theorie weiter aus und sah sich schließlich gezwungen, vor jedem Haupt- und Komplementärsegmente
noch ein Interkalarsegment anzunehmen und steigerte damit die Zahl der Metamere wieder
auf vier, wobei jedoch hervorzuheben ist, daß dieselben keineswegs ohne weiteres mit den Metameren
nach N e w p o r t identifiziert werden können. Die neuesten Arbeiten (B e r l e s e , C r am p t o n ,
S n o d g r a ß ) vertreten wieder die Anschauung, daß die Segmente einfachen Metameren entsprechen.
Alle diese Theorien genauer zu referieren erscheint unnötig, da dasselbe in jüngster Zeit bereits mehrfach
erfolgt ist. Ich möchte mich daher darauf beschränken, die Verhältnisse bei den Proturen zu
betrachten und die daraus folgenden Schlüsse zu ziehen.
B e r i e t e war auf Grund umfangreicher Studien an Insekten zu der Überzeugung gekommen,
daß ein jedes Tergum und Sternum ursprünglich aus vier Stücken zusammengesetzt sei. Zu nahezu
dem gleichen Resultate kam auch C r a m p t o n an der Hand eines großen Vergleichsmaterials,
während S n o d g r a ß bei parallellaufenden Untersuchungen über das Insektentergum eine derartige
Vierteilung nicht fand. Obwohl die alten Namen M a c L e a y s für die Abschnitte des Tergums
nicht stets gleich gedeutet waren, verwandte C r a m p t o n sie für die Hauptgliederung weiter;
im Sternum dagegen ersetzte er die von C o m s t o c k und K o c h i eingeführte Nomenklatur durch
eine neue. B e r 1 e s e machte sich ganz unabhängig von den alten Bezeichnungen und bediente sich
einer völlig abweichenden Ausdrucksweise. Er ging davon aus, daß es wohl zweckmäßig wäre, durch
gleiche Präfixe die einzelnen Abschnitte von Rücken- und Bauchschuppe in ihrer Lage zu charakterisieren.
Er nannte deshalb diese Sklerite Tergite und Sternite und benannte sie von vorn nach hinten
als Acro-, Pro-, Meso- und Metatergit, beziehungsweise -sternit.
Bei der Bearbeitung der Proturen fand er dann, daß seine Nomenklatur sich auch auf diese
zwanglos anwenden ließ. Als sich nun im Verlaufe der vorliegenden Untersuchungen herausstellte,
daß in gleicher Weise auch die Sklerite des Lateralbezirkes in der Anzahl von zweimal vier auftreten,
schien es, wie gesagt zweckmäßig, die B e r l e s e s c h . e Benennungsweise auch auf sie auszudehnen.
Es wurden daher die Namen Acro-, Pro-, Meso- und Metapleurit und -sympleurit für sie eingeführt.
Nun besaßen aber die in dieserWeise benannten Sklerite von Eosentomon schon früher beschriebene
Homologa bei anderen Insekten. Die Durchführung einer neuen Nomenklatur für die Pleuralstücke
würde daher im Hinblick auf die alteingebürgerten Namen ebensowenig tunlich gewesen sein,
wie es bei der B e r l e s e s c h en für die Terga und die Sterna der Fall war. Aus diesem Grunde
wurde der Versuch gemacht, eine d o p p e l t e B e z e i c h n u n g s w e i s e einzuführen und der
bisherigen s p e z i e l l e n eine a l l g e m e i n e an die Seite zu stellen. Auf diese Weise
ist dann eine Namensänderung nicht erforderlich, vielmehr können die durch die ausgiebige Verwendung
in systematischer Hinsicht festgelegten alten Bezeichnungen ohne weiteres beibehalten werden,