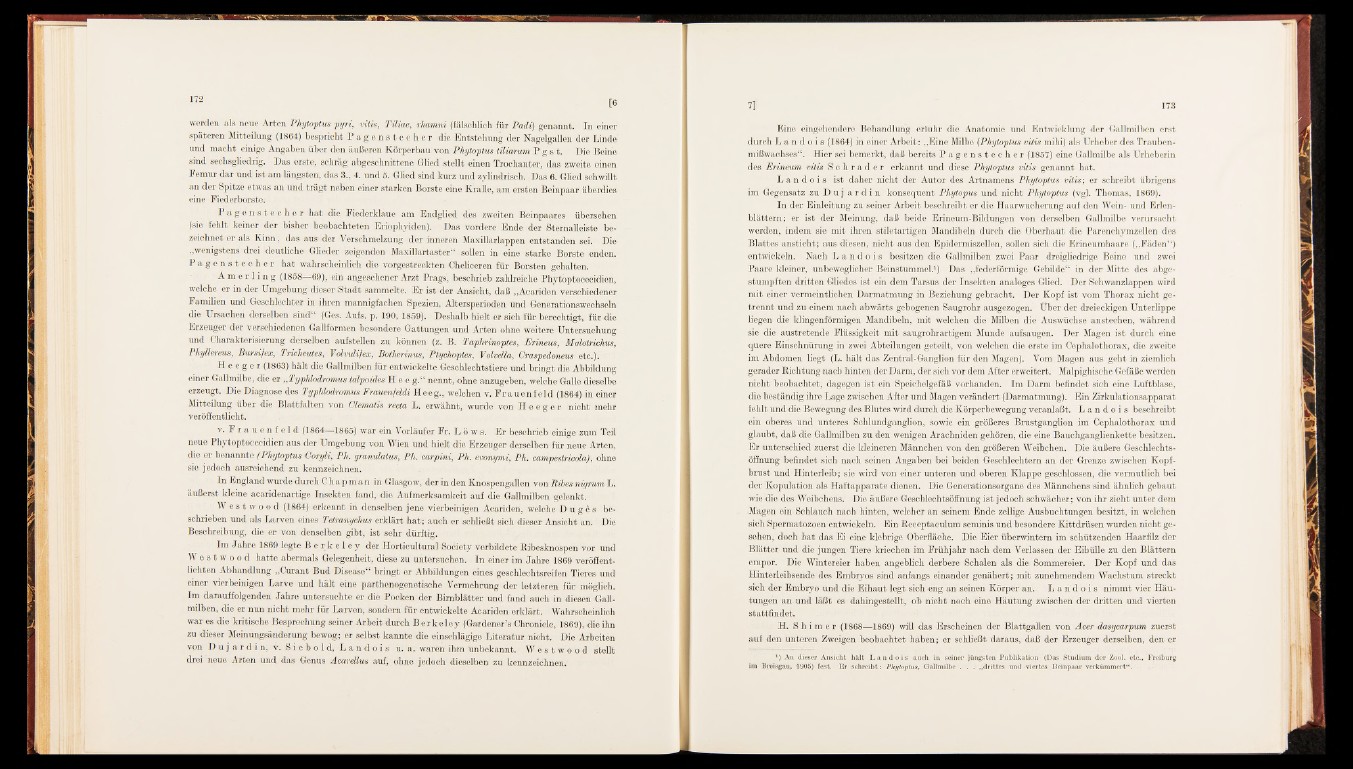
werden als neue Arten Phytoptus pyri, vitis, Tüiae, rhamni (fälschlich für Padi) genannt. In einer
späteren Mitteilung (1864) bespricht P a g e n s t e c h e r die Entstehung der Nagelgallen der Linde
und macht einige Angaben über den äußeren Körperbau von Phytoptus tiliarum P g s t. Die Beine
sind sechsgliedrig. Das erste, schräg abgeschnittene Glied' stellt einen Trochanter, das zweite einen
Femur dar und ist am längsten, das 3., 4. und 5. Glied sind kurz und zylindrisch. Das 6. Glied schwillt
an der Spitze etwas an und trägt neben einer starken Borste eine Kralle, am ersten Beinpaar überdies
eine Fiederborste:
P a g e n s t e c h e r hat die Fiederklaue am Endglied des zweiten Beinpaares übersehen
(sie fehlt keiner der bisher beobachteten Eriöphyiden). Das vordere Ende der Sternalleiste bezeichnet
er als Kinn, das auä der Verschmelzung der inneren Maxillarlappen entstanden sei. Die
„wenigstens drei deutliche Glieder zeigenden Maxillartaster“ sollen in eine starke Borste enden.
P a g e n s t e c h e r hat wahrscheinlich die vorgestreckten Cheliceren für Borsten gehalten.
A m e r l i n g (1858—69), ein angesehener Arzt Prags, beschrieb zahlreiche Phytoptocecidien,
welche er in der Umgebung dieser Stadt sammelte. Er ist der Ansicht, daß „Acariden verschiedener
Familien und Geschlechter in ihren mannigfachen Spezien, Altersperioden und Generationswechseln
die Ursachen derselben sind“ (Ges. Aufs. p. 190, 1859). Deshalb hielt er sich für berechtigt, für die
Erzeuger der verschiedenen Gallformen besondere Gattungen und Arten ohne weitere Untersuchung
und Charakterisierung derselben aufstellen zu können (z. B. Taphrinoptes, Erineus, Malotrichus,
Phyllereus, Bursifex, Tricheutes, Volvulifex, Boiherinus, Ptychoptes, Volvella, Craspedoneus etc.).
H e e g e r (1863) hält die Gallmilben für entwickelte Geschlechtsiiere und bringt die Abbildung
einer Gallmilbe, die er „Typhlodromus talpoides H e e g . “ nennt, ohne anzugeben, welche Galle dieselbe
erzeugt. Die Diagnose des TypUodromus Frauenfeldi H e eg ., welchen v. Frauenf eld (1864) in einer
Mitteilung über die Blattfalten von Clematis recta L. erwähnt, wurde von H e e g e r nicht mehr
veröffentlicht.
v. F r a u e n f e l d (1864—1865) war ein Vorläufer Fr. L ö w s. Er beschrieb einige zum Teil
neue Phytoptocecidien aus der Umgebung von Wien und hielt die Erzeuger derselben für neue Arten,
die er benannte (Phytoptus Coryli, Ph. granulatus, Ph. carpini, Ph. evonymi, Ph. campestricola), ohne
sie jedoch ausreichend zu kennzeichnen.
In England wurde durch Ch ap man in Glasgow, der in den Knospengäßen von Ribesnigrum L.
äußerst kleine acaridenartige Insekten fand, die Aufmerksamkeit auf die Gallmilben gelenkt.
W e s t w o o d (1864) erkennt in denselben jene vierbeinigen Acariden, welche D u g e s beschrieben
und als Larven eines Tetranychus erklärt hat; auch er schließt sich dieser Ansicht an. Die
Beschreibung, die er von denselben gibt, ist sehr dürftig.
Im Jahre 1869 legte B e r k e i e y der Horticultural Society verbildete Ribesknospen vor und
W e s t w o o d hatte abermals Gelegenheit, diese zu untersuchen. In einer im Jahre 1869 veröffentlichten
Abhandlung „Curant Bud Disease“ bringt er Abbildungen eines geschlechtsreifen Tieres und
einer vierbeinigen Larve und hält eine parthenogenetische Vermehrung der letzteren für möglich.
Im darauffolgenden Jahre untersuchte er die Pocken der Bimblätter und fand auch in diesen Gallmilben,
die er nun nicht mehr für Larven, sondern für entwickelte Acariden erklärt. Wahrscheinlich
war es die kritische Besprechung seiner Arbeit durch Be rke l ey (Gardener’s Chroniele, 1869), die ihn
zu dieser Meinungsänderung bewog; er selbst kannte die einschlägige Literatur nicht. Die Arbeiten
von D u j a r d i n, v. S i e b o 1 d, L a n d o i s u. a. waren ihm unbekannt. W e s t w o o d stellt
drei neue Arten und das Genus Acarellus auf, ohne jedoch dieselben zu kennzeichnen.
Eine eingehendere Behandlung erluhr die Anatomie und Entwicklung der Gallmilben erst
durch L a n d o i s (1864) in einer Arbeit: „Eine Milbe (Phytoptus vitis mihi) als Urheber des Trauben-
mißwaehses“. Hier sei bemerkt, daß bereits P a g e n s t e c h e r (1857) eine Gallmilbe als Urheberin
des Erineum vitis S c h r ä d e r erkannt und diese Phytoptus vitis genannt hat.
L a n d o i s ist daher nicht der Autor des Artnamens Phytoptus vitis; er schreibt übrigens
im Gegensatz zu D u j a r d i n konsequent Phytopus und nicht Phytoptus (vgl. Thomas, 1869).
In der Einleitung zu seiner Arbeit beschreibt er die Haarwucherung auf den Wein- und Erlen-
blättern; er ist der Meinung, daß beide Erineum-Bildungen von derselben Gallmilbe verursacht
werden, indem sie mit ihren stiletartigen Mandibeln durch die Oberhaut die Parenchymzellen des
Blattes ansticht; aus diesen, nicht aus den Epidermiszellen, sollen sich die Erineumhaare („Fäden“)
entwickeln. Nach L a n d o i s besitzen die Gallmilben zwei Paar dreigliedrige Beine und zwei
Paare kleiner, unbeweglicher Beinstummel.1) Das „federförmige Gebilde“ in der Mitte des abgestumpften
dritten Gliedes ist ein dem Tarsus der Insekten analoges Glied. Der Schwanzlappen wird
mit einer vermeintlichen Darmatmung in Beziehung gebracht. Der Kopf ist vom Thorax nicht getrennt
und zu einem nach abwärts gebogenen Saugrohr ausgezogen. Über der dreieckigen Unterlippe
liegen die klingenförmigen Mandibeln, mit welchen die Milben die Auswüchse anstechen, während
sie die austretende Flüssigkeit mit saugrohrartigem Munde aufsaugen. Der Magen ist durch eine
quere Einschnürung in zwei Abteilungen geteilt, von welchen die erste im Cephalothorax, die zweite
im Abdomen liegt (L. hält das Zentral-Ganglion für den Magen). Vom Magen aus geht in ziemlich
gerader Richtung nach hinten der Darm, der sich vor dem After erweitert. Malpighische Gefäße werden
nicht beobachtet, dagegen ist ein Speichelgefäß vorhanden. Im Darm befindet sich eine Luftblase,
die beständig ihre Lage zwischen After und Magen verändert (Darmatmung). Ein Zirkulationsapparat
fehlt und die Bewegung des Blutes wird durch die Körperbewegung veranlaßt. L a n d o i s beschreibt
ein oberes und unteres Schlundganglion, sowie ein größeres Brustganglion im Cephalothorax und
glaubt, daß die Gallmilben zu den wenigen Arachniden gehören, die eine Bauchganglienkette besitzen.
Er unterschied zuerst die kleineren Männchen von den größeren Weibchen. Die äußere Geschlechtsöffnung
befindet sich nach seinen Angaben bei beiden Geschlechtern an der Grenze zwischen Kopfbrust
und Hinterleib; sie wird von einer unteren und oberen Klappe geschlossen, die vermutlich bei
der Kopulation als Haftapparate dienen. Die Generationsorgane des Männchens sind ähnlich gebaut
wie die des Weibchens. Die äußere Geschlechtsöffnung ist jedoch schwächer; von ihr zieht unter dem
Magen ein Schlauch nach hinten, welcher an seinem Ende zellige Ausbuchtungen besitzt, in welchen
sich Spermatozoen entwickeln. Ein Receptaculum seminis und besondere Kittdrüsen wurden nicht gesehen;
doch hat das Ei eine klebrige Oberfläche. Die Eier überwintern im schützenden Haarfilz der
Blätter und die jungen Tiere kriechen im Frühjahr nach dem Verlassen der Eihülle zu den Blättern
empor. Die Wintereier haben angeblich derbere Schälen als die Sommereier. Der Kopf und das
Hinterleibsende des Embryos sind anfangs einander genähert; mit zunehmendem Wachstum streckt
sich der Embryo und die Eihaut legt sich eng an seinen Körper an. L a n d o i s nimmt vier Häutungen
an und läßt es dahingestellt, ob nicht noch eine Häutung zwischen der dritten und vierten
stattfindet.
H. S h i m e r (1868-—1869) will das Erscheinen der Blattgallen von Acer dasycarpum zuerst
auf den unteren Zweigen beobachtet haben; er schließt daraus, daß der Erzeuger derselben, den er
1) An dieser Ansicht h ä lt L a n d o i s auch in seiner jüngsten Publikation (Das Studium der Zool. etc., Freiburg
im Breisgau, 1905) fest. E r schreibt: Phytoptus, Gallmilbe . . . „drittes und viertes Beinpaar verkümmert“ .