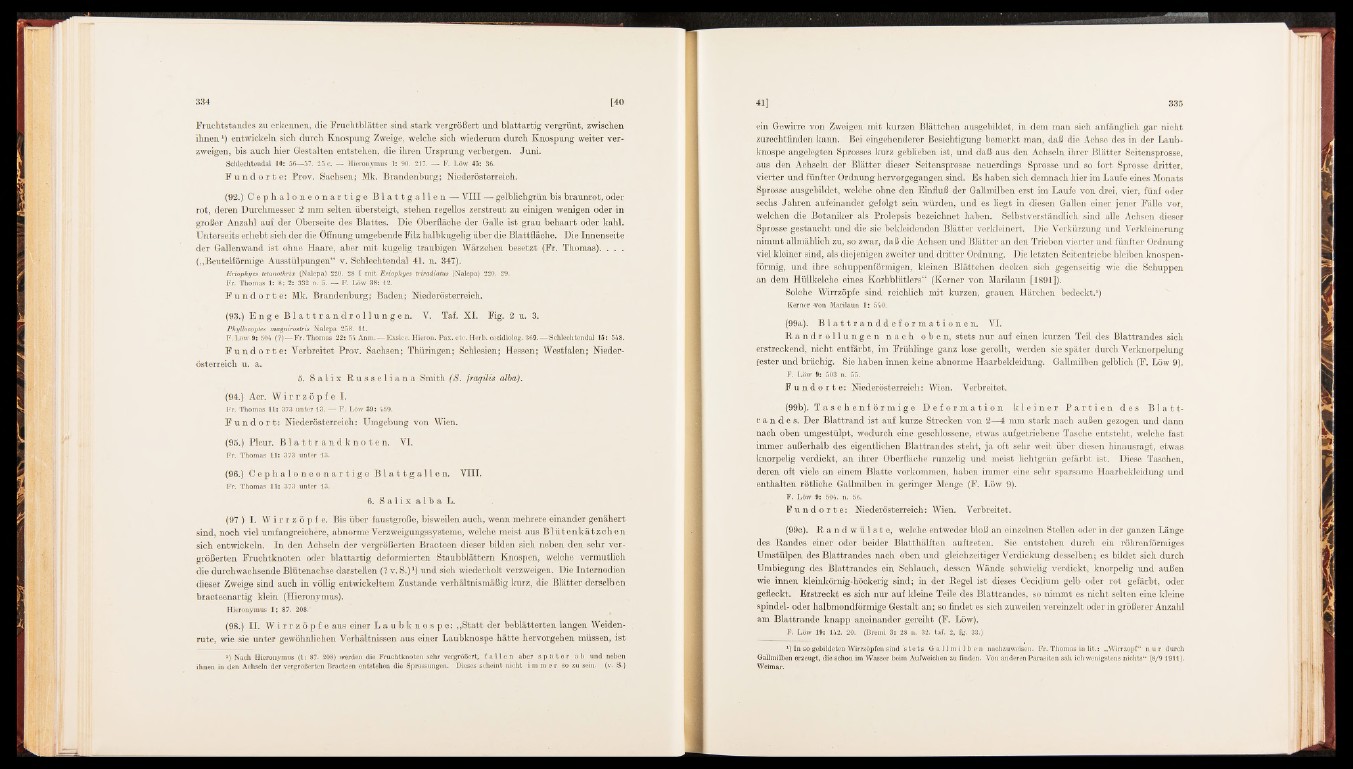
Fruchtstandes zu erkennen, die Fruchtblätter sind stark vergrößert und blattartig vergrünt, zwischen
ihnenx) entwickeln sich durch Knospung Zweige, welche sich wiederum durch Knospung weiter verzweigen,
bis auch hier Gestalten entstehen, die ihren Ursprung verbergen. Juni.
Schlechtendal 10: 56—57. 25 c. — Hieronymus 1: 90. 217. — F. Löw 45: 36.
F u n d o r t e : Pro v. Sachsen; Mk. Brandenburg; Niederösterreich.
(92.) C e p h a l o n e o n a r t i g e B l a t t g a l l e n — VIII — gelblichgrün bis braunrot, oder
rot, deren Durchmesser 2 mm selten übersteigt, stehen regellos zerstreut zu einigen wenigen oder in
großer Anzahl auf der Oberseite des Blattes. Die Oberfläche der Galle ist grau behaart oder kahl.
Unterseits erhebt sich der die Öffnung umgebende Filz halbkugelig über die Blattfläche. Die Innenseite
der Gallenwand ist ohne Haare, aber mit kugelig traubigen Wärzchen besetzt (Fr. Thomas). . . .
(„Beutelförmige Ausstülpungen“ v. Schlechtendal 41. n. 347).
Eriophyes tetanothrix (Nalepa) 220. 28 I mit Eriophyes triradiatus (Nalepa) 220. 29.
Fr. Thomas 1: 8; 2: 332 n. 5. — F. Löw 38: 12.
F u n d o r t e : Mk. Brandenburg; Baden; Niederösterreich.
(93.) E ng e B l a t t r a n d r o l l u n g e n . V. Taf. XI. Fig. 2 u. 3.
Phyllocoptes magnirostris Nalepa 258. 11.
F. Löw 9: 504 (? )— Fr. Thomas 22: 54 Anm. — Exsicc. Hieron. Pax. etc. Herb, cecidiolog. 369. — Schlechtendal 15: 548.
F u n d o r t e : Verbreitet Pro v. Sachsen; Thüringen; Schlesien; Hessen; Westfalen; Niederösterreich
u. a.
5. Sa l i x R u s s e l i a n a Smith (S. fragüis alba).
(94.) Acr. Wi r r z ö p f e I.
Fr. Thomas 11: 373 unter 13. — F. Löw 39: 459.
F u n d o r t : Niederösterreich: Umgebung von Wien.
(95.) Pleur. B l a t t r a n d k n o t e n . VI.
Fr. Thomas 11: 373 jmter 13.
(96.) C e p h a l o n e o n a r t i g e B l a t t g a l l e n . VIII.
Fr. Thomas 11: 37,3 unter 13.
6. S a l i x a l b a L.
(97 ) I. Wir r z ö p f e . Bis über faustgroße, bisweilen auch, wenn mehrere einander genähert
sind, noch viel umfangreichere, abnorme Verzweigungssysteme, welche meist aus Blü ten k ä tz ch en
sich entwickeln. In den Achseln der vergrößerten Bracteen dieser bilden sich neben den sehr vergrößerten
Fruchtknoten oder blattartig deformierten Staubblättern Knospen, welche vermutlich
die durchwachsende Blütenachse darstellen (? v. S.)1) und sich wiederholt verzweigen. Die Internodien
dieser Zweige sind auch in völlig entwickeltem Zustande verhältnismäßig kurz, die Blätter derselben
bracteenartig klein (Hieronymus).
Hieronymus 1: 87. 208^
(98.) II. Wi r r z ö p f e aus einer L a u b k n o s p e : „Statt der beblätterten langen Weidenrute,
wie sie unter gewöhnlichen Verhältnissen aus einer Laubknospe, hätte hervorgehen müssen, ist
i) Nach Hieronymus (1: 87. 208) werden die Fruchtknoten sehr vergrößert, f a l l e n aber s p ä t e r a b und neben
ihnen in den Achseln der vergrößerten Bracteen entstehen die Sprossungen. Dieses scheint nicht i m m e r So zu sein. (v. S..)
ein Gewirre von Zweigen mit kurzen Blättchen ausgebildet, in dem man sich anfänglich gar nicht
zurechtfinden kann. Bei eingehenderer Besichtigung bemerkt man, daß die Achse des in der Laub-
knospe angelegten Sprosses kurz geblieben ist, und daß aus den Achseln ihrer Blätter Seitensprosse,
aus den Achseln der Blätter dieser Seitensprosse neuerdings Sprosse und so fort Sprosse dritter,
vierter und fünfter Ordnung hervorgegangen sind. Es haben sich demnach hier im Laufe eines Monats
Sprosse ausgebildet, welche ohne den Einfluß der Gallmilben erst im Laufe von drei, vier, fünf oder
sechs Jahren aufeinander gefolgt sein würden, und es liegt in diesen Gallen einer jener Fälle vor,
welchen die Botaniker als Prolepsis bezeichnet haben. Selbstverständlich sind alle Achsen dieser
Sprosse gestaucht und die sie beldeidenden Blätter verkleinert. Die Verkürzung und Verkleinerung
nimmt allmählich zu, so zwar, daß die Achsen und Blätter an den Trieben vierter und fünfter Ordnung
viel kleiner sind, als diejenigen zweiter und dritter Ordnung. Die letzten Seitentriebe bleiben knospenförmig,
und ihre schuppenförmigen, kleinen Blättchen decken sich gegenseitig wie die Schuppen
an dem Hüllkelche eines Korbblütlers“ (Kerner von Marilaun [1891]).
Solche Wirrzöpfe sind reichlich mit kurzen, grauen Härchen bedeckt.1)
Kerner *von Marilaun 1: 540.
(99a). B l a t t r a n d d e f o rma t i o n e n . VI.
R a n d r o l l u n g e n n a c h oben, stets nur auf einen kurzen Teil des Blattrandes sich
erstreckend, nicht entfärbt, im Frühlinge ganz lose gerollt, werden sie später durch Verknorpelung
fester und brüchig. Sie haben innen keine abnorme Haarbekleidung. Gallmilben gelblich (F. Löw 9).
F. Löw 9: 503 n. 55.
F u n d o r t e : Niederösterreich: Wien. Verbreitet.
(99b). T a s c h e n f ö rmi g e D e f o rma t i o n k l e i n e r P a r t i e n des B l a t t r
ande s . Der Blattrand ist auf kurze Strecken von 2—4 mm stark nach außen gezogen und dann
nach oben umgestülpt, wodurch eine geschlossene, etwas aufgetriebene Tasche entsteht, welche fast
immer außerhalb des eigentlichen Blattrandes steht, ja oft sehr weit über diesen hinausragt, etwas
knorpelig verdickt, an ihrer Oberfläche runzelig und meist lichtgrün gefärbt ist. Diese Taschen,
deren oft viele an einem Blatte Vorkommen, haben immer eine sehr sparsame Haarbekleidung und
enthalten rötliche Gallmilben in geringer Menge (F. Löw 9).
F. Löw 9: 504. n. 56.
F u n d o r t e : Niederösterreich: Wien. Verbreitet.
(99c). R a n d w ü l s t e , welche entweder bloß an einzelnen Stellen oder in der ganzen Länge
des Randes einer oder beider Blatthälften auftreten. Sie entstehen durch ein röhrenförmiges
Umstülpen des Blattrandes nach oben und gleichzeitiger Verdickung desselben; es bildet sich durch
Umbiegung des Blattrandes ein Schlauch, dessen Wände schwielig verdickt, knorpelig und außen
wie innen kleinkörnig-höckerig sind; in der Regel ist dieses Cecidium gelb oder rot gefärbt, oder
gefleckt. Erstreckt es sich nur auf kleine Teile des Blattrandes, so nimmt es nicht selten eine kleine
spindel- oder halbmondförmige Gestalt an; so findet es sich zuweilen vereinzelt oder in größerer Anzahl
am Blattrande knapp aneinander gereiht (F. Löw).
F. Löw 19: 142. 20. (Brcmi 3: 28 n. 32. taf. 2, fg. 33.)
l ) In so gebildeten Wirrzöpfen sind " s t e t s G a l l m i l b e n nachzuweisen. Fr. Thomas in lit.: „Wirrzopf“ n u r durch
Gallmilben erzeugt, die schon im Wasser beim Aufweichen zu finden. Von anderen Parasiten sah ich wenigstens nichts“ (8/9 1911).
Weimar.