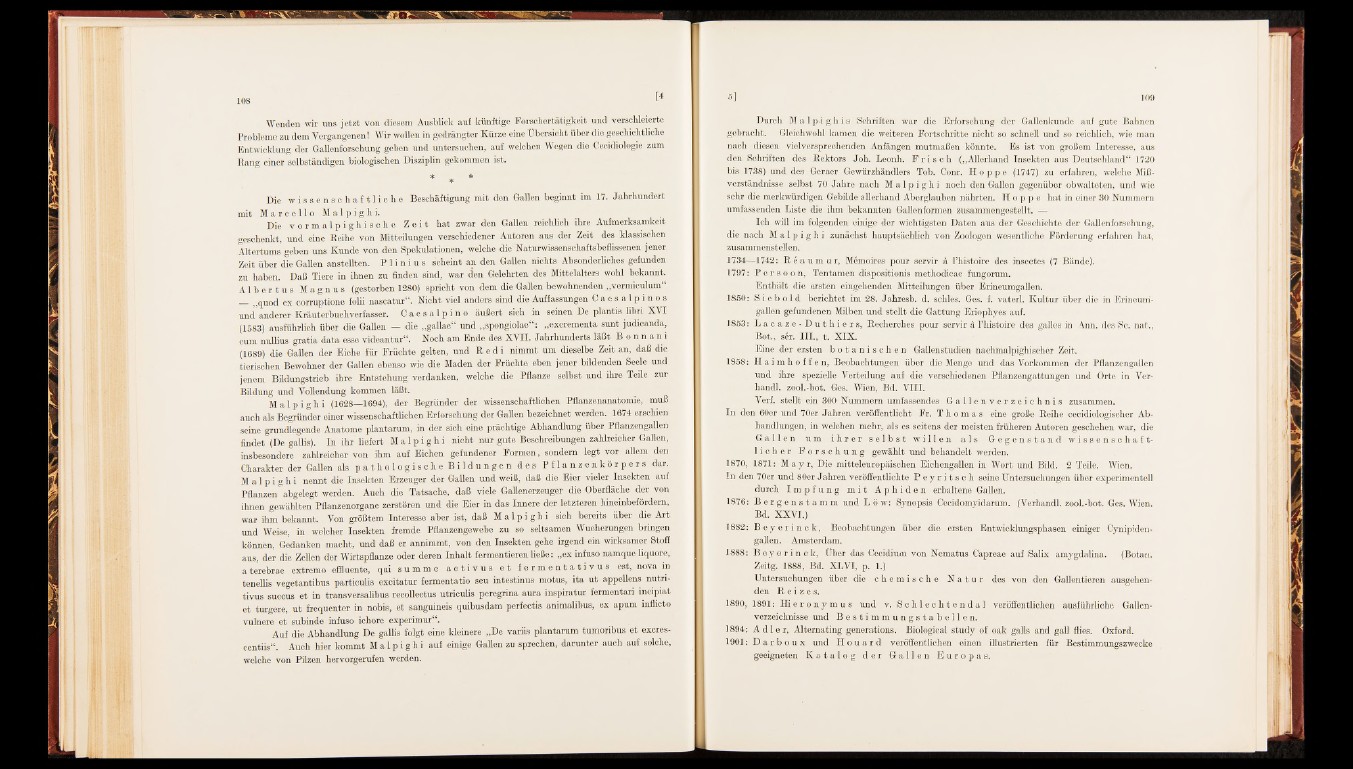
Wenden wir uns jetzt von diesem Ausblick auf künftige Forschertätigkeit und verschleierte
Probleme zu dem Vergangenen! Wir wollen in gedrängter Kürze eine Übersicht über die geschichtliche
Entwicklung der Gallenforschung geben und untersuchen, auf welchen Wegen die Cecidiologie zum
Rang einer selbständigen biologischen Disziplin gekommen ist.
* * *
Die w i s s e n s c h a f t l i c h e Beschäftigung mit den Gallen beginnt im 17. Jahrhundert
mit M a r c e l l o Ma l p i g h i . , :
Die v o r m a l p i g h i s c h e Z e i t hat zwar den Gallen reichlich ihre Aufmerksamkeit
geschenkt, und eine Reihe von Mitteilungen verschiedener Autoren aus der Zeit des klassischen
Altertums geben uns Kunde von den Spekulationen, welche die'-Naturwissenschaftsbeflissenen jener
Zeit über die Gallen anstellten. P 1 i n i u s scheint an den Gallen nichts Absonderliches gefunden
zu haben. Daß Tiere in ihnen zu finden sind, war den Gelehrten des Mittelalters wohl bekannt.
A l b e r t u s Ma g n u s (gestorben 1280) spricht von dem die Gallen bewohnenden „vermiculum“
— „quod ex corruptione folii nascatur“. Nicht viel anders sind die Auffassungen C a e s a 1 p i n o s
und anderer Kräuterbuchverfasser. C a e s a l p i n o äußert sich in seinen De plantis libri XVI
(1583) ausführlich über die Gallen — die „gaüae“ und „spongiolae“ : „excrementa sunt judicanda,
cum nullius gratia data esse videantux“. Noch am Ende des XVII. Jahrhunderts läßt B o n n a n i
(1689) die Gallen der Eiche für Früchte gelten, und R e d i nimmt um dieselbe Zeit an, daß die
tierischen Bewohner der Gallen ebenso wie die Maden der Früchte eben jener bildenden Seele und
jenem Bildungstrieb ihre Entstehung verdanken, welche die Pflanze selbst und ihre Teile zur
Bildung und Vollendung kommen läßt.
M a l p i g h i (1628—1694), der Begründer der wissenschaftlichen Pflanzenanatomie, muß
auch als Begründer einer wissenschaftlichen Erforschung der Gallen bezeichnet werden. 1674 erschien
seine grundlegende Anatome plantarum, in der sich eine prächtige Abhandlung über Pflanzengallen
findet (De gallis). In ihr liefert M a l p i g h i nicht nur gute Beschreibungen zahlreicher Gallen,
insbesondere zahlreicher von ihm auf Eichen gefundener Formen, sondern legt vor allem den
Charakter der Gallen als p a t h o 1 o g i s c h e B i 1 d u n g e n d e s P f l a n z e n k ö r p e r s dar.
M a l p i g h i nennt die Insekten Erzeuger der Gallen und weiß, daß die Eier vieler Insekten auf
Pflanzen abgelegt werden. Auch die Tatsache, daß viele Gallenerzeuger die Oberfläche der von
ihnen gewählten Pflanzenorgane zerstören und die Eier in das Innere der letzteren hineinbefördern,
war ihm bekannt. Von größtem Interesse aber ist, daß Ma l p i g h i sich bereits über die Art
und Weise, in welcher Insekten fremde Pflanzengewebe zu so seltsamen Wucherungen bringen
können, Gedanken macht, und daß er annimmt, von den Insekten gehe irgend ein wirksamer Stoff
aus, der die Zellen der Wirtspflanze oder deren Inhalt fermentieren ließe: „ex infuso namque liquore,
aterebrae extremo effluente, qui s u m m e a c t i v u s e t f e r m e n t a t i v u s est, nova in
tenellis vegetantibus particulis excitatur fermentatio seu intestinus motus, ita ut appellens nutn-
tivus succus et in transversalibus recollectus utriculis peregrina aura inspiratur fermentari incipiat
et turgere, ut frequenter in nobis, et sanguineis quibusdam perfectis animalibus, ex apum inflicto
vulnere et subinde infuso ichore experimur“.
Auf die Abhandlung De gallis folgt eine kleinere „De variis plantarum tumoribus et excres-
centiis“. Auch hier kommt Ma l p i g h i auf einige Gallen zu sprechen, darunter auch auf solche,
welche von Pilzen hervorgerufen werden.
Durch Ma l p i g h i s Schriften war die Erforschung der Gallenkunde auf gute Bahnen
gebracht. Gleichwohl kamen die weiteren Fortschritte nicht so schnell und so reichlich, wie man
nach diesen vielversprechenden Anfängen mutmaßen könnte. Es ist von großem Interesse, aus
den Schriften des Rektors Joh. Leonh. F r i s c h („Allerhand Insekten aus Deutschland“ 1720
bis 1738) und des Geraer Gewürzhändlers Tob. Conr. H o p p e (1747) zu erfahren, welche Mißverständnisse
selbst 70 Jahre nach Ma l p i g h i noch den Gallen gegenüber obwalteten, und wie
sehr die merkwürdigeil Gebilde allerhand Aberglauben nährten. H o p p e hat in einer 30 Nummern
umfassenden Liste die ihm bekannten Gallenformen zusammengestellt. —
Ich will im folgenden einige der wichtigsten Daten aus der Geschichte der Gallenforschung,
diè nach Ma l p i g h i zunächst hauptsächlich von Zoologen wesentliche Förderung erfahren hat,
zusammenstellen.
1734—1742: R é a u m u r , Mémoires pour servir à l’histoire des insectes (7 Bände).
1797: P e r s o o n , Ten tarnen dispositionis methodicae fungorum.
Enthält die erstén eingehenden Mitteilungen über Erineumgallen.
1850: S i e b o l d berichtet im 28. Jahresb. d. schles. Ges. f. vaterl. Kultur über die in Erineumgallen
gefundenen Milben und stellt die Gattung Eriophyes auf.
i 853: L a c a z e - D u t h i e r s , Recherches pour servir à l’histoire des galles in Ann. des Sc. nat.,
Bot., sér. III., t. XIX.
Eine der erstèn b o t a n i s c h e n Gallenstudien nachmalpighischer Zeit.
1858: H a im h o f f e n , Beobachtungen über die Menge und das Vorkommen der Pflanzengallen
und ihre spezielle Verteilung auf die verschiedenen Pflanzengattungen und Orte in Ver-
handl. zool.-böt. Ges. Wien, Bd. VIII.
Verf. stellt ein 300 Nummern umfassendes G a l l e n v e r z e i c h n i s zusammen.
In den 60er und 70er Jahren veröffentlicht Fr. T h om a s eine große Reihe ceeidiologischer Abhandlungen,
in welchen mehr, als es seitens der meisten früheren Autoren geschehen war, die
G a l l e n um i h r e r s e l b s t w i l l e n a l s G e g e n s t a n d w i s s e n s c h a f t l
i c h e r F o r s c h u n g gewählt und behandelt werden.
1870, 1871: Mayr , Die mitteleuropäischen Eichengallen in Wort und Bild. 2 Teile. Wien.
In den 70er und 80er Jahren veröffentlichte P e y r i t s c h seine Untersuchungen über experimentell
durch I m p f u n g m i t A p h i d e n erhaltene Gallen.
1876: B e r g e n s t a m m und Löw: Synopsis Cecidomyidarum. (Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien.
Bd. XXVI.)
1882: B e y e r i n c k , Beobachtungen über die ersten Entwicklungsphasen einiger Cynipiden-
gallen. Amsterdam.
1888: B e y e r i n c k , Über das Cecidium von Nematus Capreae auf Salix amygdalina. (Botan.
Zeitg. 1888, Bd. XLVI, p. 1.)
Untersuchungen über die c h e m i s c h e N a t u r des von den Gallentieren ausgehenden
R e i z e s .
1890, 1891: H i e r o n ym u s und v. S c h l e c h t e n d a l veröffentlichen ausführliche Gallenverzeichnisse
und B e s t i m m u n g s t a b e l l e n .
1894: Adl e r , Alternating générations. Biological study of oak galls and gall flies. Oxford.
1901 : D a r b o u x und H o u a r d veröffentlichen einen illustrierten für Bestimmungszwecke
geeigneten K a t a l o g d e r G a 11 e n E u r o p a s .