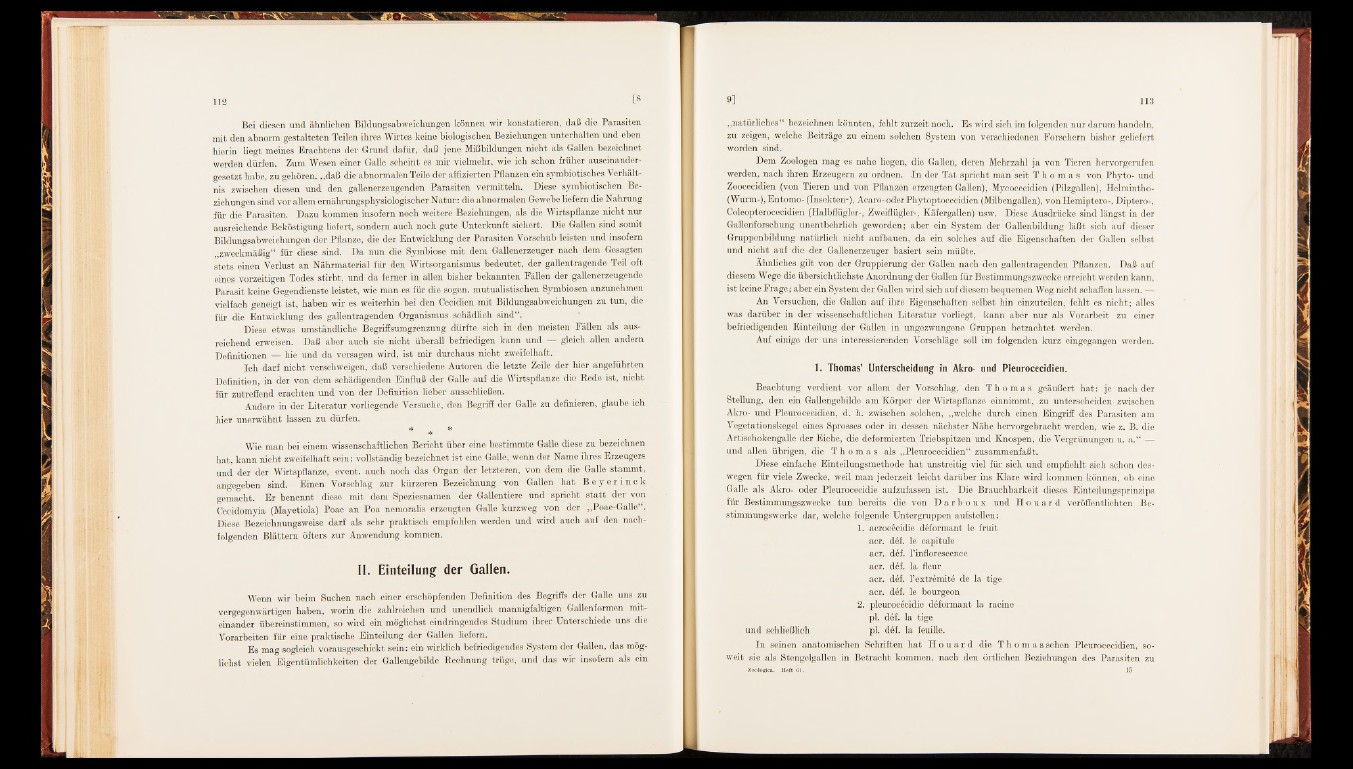
Bei diesen und ähnlichen Bildungsabweichungen können wir konstatieren, daß die Parasiten
mit den abnorm gestalteten Teilen ihres Wirtes keine biologischen Beziehungen unterhalten und eben
hierin liegt meines Erachtens der Grund dafür, daß jene. Mißbildungen nicht als. Gallen bezeichnet
werden dürfen. Zum Wesen einer Galle scheint es mir vielmehr, wie ich schon früher auseinandergesetzt
habe, zu gehören, „daß die abnormalen Teile der afflzierten Pflanzen ein symbiotisches Verhältnis
zwischen diesen und den gallenerzeugenden Parasiten vermitteln. Diese symbiotischen Beziehungen
sind vor allem ernährungsphysiologischer Natur: die abnormalen Gewebe liefern die Nahrung
für die Parasiten. Dazu kommen insofern noch weitere Beziehungen, als die Wirtspflanze nicht nur
ausreichende Beköstigung liefert, sondern auch noch gute Unterkunft sichert. Die Gallen sin f Somit
Bildungsabweichungen der Pflanze, die der Entwicklung der Parasiten Vorschub leisten und insofern
„zweckmäßig“ für diese sind. Da nun die Symbiose mit dem Gallenerzeuger nach dem Gesagten
stets einen Verlust an Nährmaterial für, den Wirtsorganismus bedeutet, der gallentragende Teil oft
eines vorzeitigen Todes stirbt, und da ferner in allen bisheT bekannten Fällen der gallenerzeugende
Parasit keine Gegendienste leistet, wie man es für die BdgBffl. mutualistischen Symbiosen anzunehmen
vielfach geneigt ist, haben wir es weiterhin bei den Cecidien mit Bildungsabweichungen zu tun, die
für die Entwicklung des gallentragenden Organismus schädlich sind“.
Diese etwas umständliche Begriflsumgrenzung dürfte, sich in den meisten Fällen als ausreichend
erweisen. Daß aber auch sie nicht überall befriedigen kann und S gleich allen ändern
Definitionen. -4#ne und da versagen wird, ist mir durchaus nicht zweifelhaft.'
Ich darf nicht verschweigen, daß verschiedene Autoren die letzte Zeile der Mer angeführten
Definition, in der von dem schädigenden Einfluß der Galle auf die Wirtspflanze die Rede ist, nicht
für zutreffend erachten und von der Definition lieber ausschließen.
Andere in der Literatur 'vorliegende Versuche, den Begriff der Galle zu definieren, glaube ich
hier unerwähnt lassen zu dürfen.
*
Wie man bei einem wissenschaftlichen Bericht über eine bestimmte Galle diese zu bezeichnen
hat, kann nicht zweifelhaft sein: vollständig bezeichnet ist eine Galle, wenn der Name ihres Erzeugers
und der der Wirtspflanze, event: auch noch das Organ der letzteren, von dem die Galle stam'Uit>
angegeben sind. Einen Vorschlag zur kürzeren Bezeichnung von Gallen hat Be y l i r i nc ' k
gemacht. Er benennt diese mit dem Speziesnamen der Gällentiere und spricht statt der von
Cecidomyia (Mayetiola) Poae an Poa nemoralis erzeugten Galle kurzweg von der „Poae^Gafle“.
Diese Bezeichnungsweise darf als sehr praktisch empfohlen werden und wird auch auf den nachfolgenden
Blättern öfters zur Anwendung kommen.
II. Einteilung der Gallen.
Wenn wir beim Suchen nach einer erschöpfenden Definition des Begriffs der Galle uns zu
vergegenwärtigen haben, worin die zahlreichen und unendlich mannigfaltigen Gallenformen miteinander
übereinstimmen, so wird ein möglichst eindringendes Studium ihrer Unterschiede uns die
Vorarbeiten für eine praktische Einteilung der Gallen liefern.
Es mag sogleich vorausgeschickt sein: ein wirklich befriedigendes System der Gallen, das möglichst
vielen Eigentümlichkeiten der Gallengebilde Rechnung trüge, und das wir insofern als ein
„natürliches“ bezeichnen könnten, fehlt zurzeit noch. Es wird sich im folgenden nur darum handeln,
zu zeigen, welche Beiträge zu einem solchen System von verschiedenen Forschern bisher geliefert
worden sind.
Dem Zoologen mag es nahe liegen, die Gallen, deren Mehrzahl ja von Tieren hervorgerufen
werden, nach ihren Erzeugern zu ordnen. In der Tat spricht man seit T h o m a s von Phyto- und
Zoocecidien (von Tieren und von Pflanzen erzeugtet! Gallen), Mycocecidien (Pilzgallen), Helmintho-
(Wurm-), Entomo- (Insekten-), Acaro-oder Phytoptocecidien (Milbengallen), vonHemiptero-, Diptero-,
Coleopterocecidien (Halbflügler-, Zweiflügler-, Käfergallen) usw. Diese Ausdrücke sind längst in der
Gallenforschung unentbehrlich geworden; aber ein System der Gallenbildung läßt sich auf dieser
Gruppenbildung natürlich nicht aufbauen, da ein solches auf die Eigenschaften der Gallen selbst
und nicht auf die der Gallenerzeuger basiert sein müßte.
Ähnliches gilt von der Gruppierung der Gallen nach den gallentragenden Pflanzen. Daß auf
diesem Wege die übersichtlichste Anordnung der Gallen für Bestimmungszwecke erreicht werden kann,
ist keine Frage; aber ein System der Gallen wird sich auf diesem bequemen Weg nicht schaffen lassen. —
An Versuchen, die Gallen auf ihre Eigenschaften selbst hin einzuteilen, fehlt es nicht; alles
was darüber in der wissenschaftlichen Literatur vorliegt, kann aber nur als Vorarbeit zu einer
befriedigenden Einteilung der Gallen in ungezwungene Gruppen betrachtet werden.
Auf einige der uns interessierenden Vorschläge soll im folgenden kurz eingegangen werden.
1. Thomas* Unterscheidung in Äkro- und Pleurocecidien.
Beachtung verdient vor allem der Vorschlag, den T h om a s geäußert hat: je nach der
Stellung, den ein Gallengebilde am Körper der Wirtspflanze einnimmt, zu unterscheiden zwischen
Akro- und Pleurocecidien, d. h. zwischen solchen, „welche durch einen Eingriff des Parasiten am
Vegetationskegel eines Sprosses oder in dessen nächster Nähe hervorgebracht werden, wie z. B. die
Artischokengalle der Eiche, die deformierten Triebspitzen und Knospen, die Vergrünungen u. a.“ —
und allen übrigen, die T h o m a s als „Pleurocecidien“ zusammenfaßt.
Diese einfache Einteilungsmethode hat unstreitig viel für sich und empfiehlt sich schon deswegen
für viele Zwecke, weil man jederzeit leicht darüber ins Klare wird kommen können, ob eine
Galle als Akro- oder Pleurocecidie aufzufassen ist. Die Brauchbarkeit dieses Einteilungsprinzips
für Bestimmungszwecke tun bereits die von D a r b o u x und H o u a r d veröffentlichten Bestimmungswerke
dar, welche folgende Untergruppen aufstellen:
1. acrocécidie déformant le fruit
acr. déf. le capitule
acr. déf. l’inflorescence
acr. déf. la fleur
acr. déf. l’extrémité de la tige
acr. déf. le bourgeon
2. pleurocécidie déformant la racine
pl. déf. la tige
und schließlich pl. déf. la feuille.
In seinen anatomischen Schriften hat H o u a r d die T h om a s sehen Pleurocecidien, soweit
sie als Stengelgallen in Betracht kommen, nach den örtlichen Beziehungen des Parasiten zu
Zoologica. H e ft 61. 15