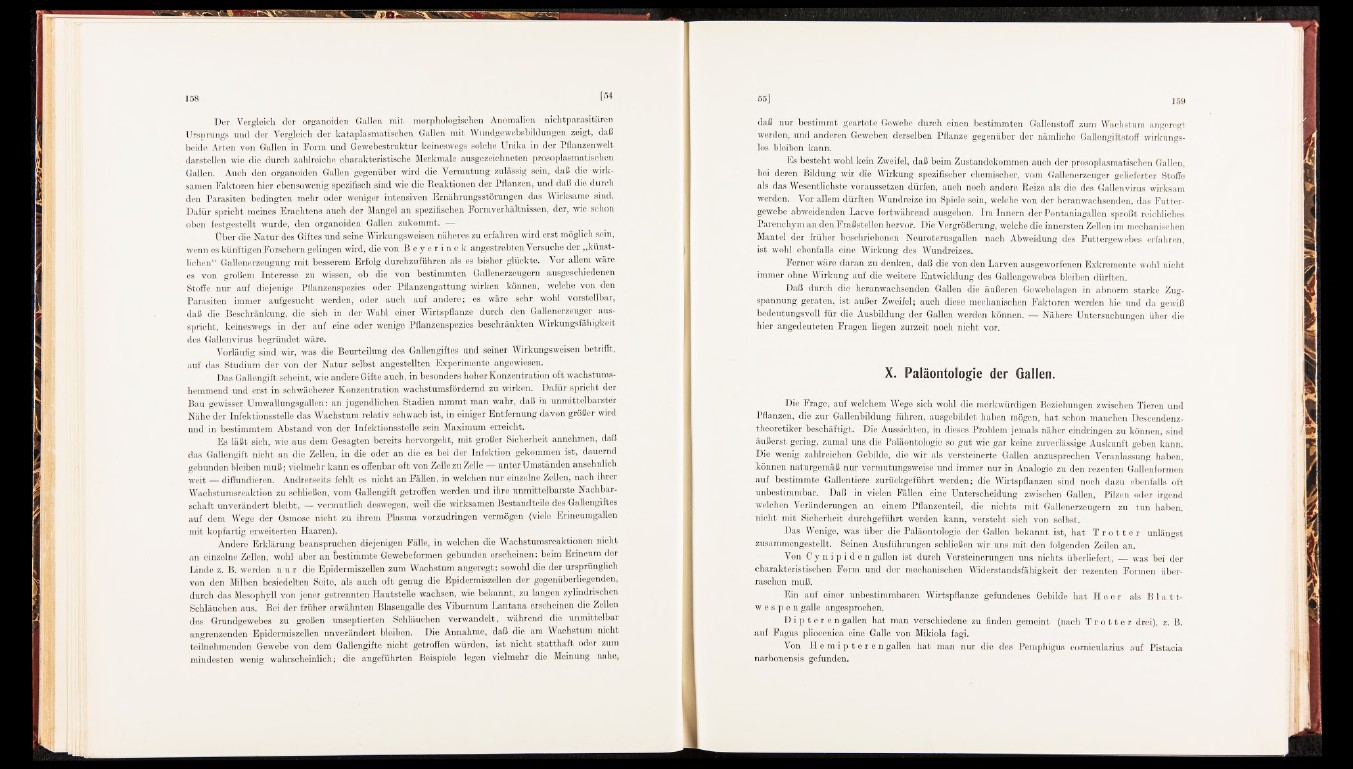
Der Vergleich der organoiden Gallen mit morphologischen Anomalien nichtparasitären
Ursnrungs und der Vergleich der kataplasmatischen Gallen mit Wundgewebsbildungen zeigt, daß
beide Arten von Gallen in Form und Gewebestruktur keineswegs solche Unika in der Pflanzenwelt
darstellen wie die durch zahlreiche charakteristische Merkmale ausgezeichneten prosoplasmatischen
Gallen. Auch den organoiden Gallen gegenüber wird die Vermutung zulässig sein, daß die wirksamen
Faktoren hier ebensowenig spezifisch sind wie die Reaktionen der Pflanzen, und daß die durch
den Parasiten bedingten mehr oder weniger intensiven Ernährungsstörungen das Wirksame sind.
Dafür spricht meines Erachtens auch der Mangel an spezifischen Formverhältnissen, der, wie schon
oben festgestellt wurde, den organoiden Gallen zukommt. —
Über die Natur des Giftes und seine Wirkungsweisen näheres zu erfahren wird erst möglich sein,
wenn es künftigen Forschern gelingen wird, die von B e y e r i n c k angestrebten Versuche der „künstlichen“
Gallenerzeugung mit besserem Erfolg durchzu führen als es bisher glückte. Vor allem wäre
es von großem Interesse zu wissen, ob die von bestimmten Gallenerzeugern ausgeschiedenen
Stoffe nur auf diejenige Pflanzenspezies oder Pflanzengattung wirken können, welche von den
Parasiten immer aufgesucht werden, oder auch auf andere; es wäre sehr wohl vorstellbar,
daß die Beschränkung, die sich in der Wahl einer Wirtspflanze durch den Gallenerzeuger ausspricht,
keineswegs in der auf eine oder wenige Pflanzenspezies beschränkten Wirkungsfähigkeit
des Gallenvirus begründet wäre.
Vorläufig sind wir, was die Beurteilung des Gallengiftes und seiner Wirkungsweisen betrifft,
auf das Studium der von der Natur selbst angestellten Experimente angewiesen.
Das Gallengift scheint, wie andere Gifte auch, in besonders hoher Konzentration oft wachstumshemmend
und erst in schwächerer Konzentration wachstumsfördemd zu wirken. Dafür spricht der
Bau gewisser Umwallungsgallen: an jugendlichen Stadien nimmt man wahr, daß in unmittelbarster
Nähe der Infektionsstelle das Wachstum relativ schwach ist, in einiger Entfernung davon größer wird
und in bestimmtem Abstand von der Infektionsstelle sein Maximum erreicht.
Es läßt sich, wie aus dem Gesagten bereits hervorgeht, mit großer Sicherheit annehmen, daß
das Gallengift nicht an die Zellen, in die oder an die es bei der Infektion gekommen ist, dauernd
gebunden bleiben muß; vielmehr kann es offenbar oft von Zelle zu Zelle — unter Umständen ansehnlich
weit _ diffundieren. Andrerseits fehlt es nicht an Fällen, in welchen nur einzelne Zellen, nach ihrer
Wachstumsreaktion zu schließen, vom Gallengift getroffen werden und ihre unmittelbarste Nachbarschaft
unverändert bleibt, — vermutlich deswegen, weil die wirksamen Bestandteile des Gallengiftes
auf dem Wege der Osmose nicht zu ihrem Plasma vorzudringen vermögen (viele Erineumgallen
mit köpf artig erweiterten Haaren).
Andere Erklärung beanspruchen diejenigen Fälle, in welchen die Wachstumsreaktionen nicht
an einzelne Zellen, wohl aber an bestimmte Gewebeformen gebunden erscheinen: beim Erineum der
Linde z. B. werden n u r die Epidermiszellen zum Wachstum angeregt: sowohl die der ursprünglich
von den Milben besiedelten Seite, als auch oft genug die Epidermiszellen der gegenüberhegenden,
durch das Mesophyll von jener getrennten Hautstelle wachsen, wie bekannt, zu langen zylindrischen
Schläuchen aus. Bei der früher erwähnten Blasengalle des Viburnum Lantana erscheinen die Zellen
des Grundgewebes zu großen unseptierten Schläuchen verwandelt, während die unmittelbar
angrenzenden Epidermiszellen unverändert bleiben. Die Annahme, daß die am Wachstum nicht
teilnehmenden Gewebe von dem Gallengifte nicht getroffen würden, ist nicht statthaft oder zum
mindesten wenig wahrscheinlich; die angeführten Beispiele legen vielmehr die Meinung nahe,
daß nur bestimmt geartete Gewebe durch einen bestimmten Gallenstoff zum Wachstum angeregt
werden, und anderen Geweben derselben Pflanze gegenüber der nämliche Gallengiftstoff wirkungslos
bleiben kann.
Es besteht wohl kein Zweifel, daß beim Zustandekommen auch der prosoplasmatischen Gallen,
bei deren Bildung wir die Wirkung spezifischer chemischer, vom Gallenerzeuger gelieferter Stoffe
als das Wesentlichste voraussetzen dürfen, auch noch andere Reize als die des Gallenvirus wirksam
werden. Vor allem dürften Wundreize im Spiele sein, welche von der heranwachsenden, das Futtergewebe
abweidenden Larve fortwährend ausgehen. Im Innern der Pontaniagallen sproßt reichliches
Parenchym an den Fraßstellen hervor. Die Vergrößerung, welche die innersten Zellen im mechanischen
Mantel der früher beschriebenen Neuroterusgallen nach Abweidung des Futtergewebes erfahren,
ist wohl ebenfalls eine Wirkung des Wundreizes.
Ferner wäre daran zu denken, daß die von den Larven ausgeworfenen Exkremente wohl nicht
immer ohne Wirkung auf die weitere Entwicklung des Gallengewebes bleiben dürften.
Daß durch die heranwachsenden Gallen die äußeren Gewebelagen in abnorm starke Zugspannung
geraten, ist außer Zweifel; auch diese mechanischen Faktoren werden hie und da gewiß
bedeutungsvoll für die Ausbildung der Gallen werden können.^! Nähere Untersuchungen über die
hier angedeuteten Fragen liegen zurzeit noch nicht vor.
X. Paläontologie der Gallen.
Die Frage, auf welchem Wege sich wohl die merkwürdigen Beziehungen zwischen Tieren und
Pflanzen, die zur Gallenbildung führen, ausgebildet haben mögen, hat schon manchen Descendenz-
theoretiker beschäftigt. Die Aussichten, in dieses Problem jemals näher eindringen zu können, sind
äußerst gering, zumal uns die Paläontologie so gut wie gar keine zuverlässige Auskunft geben kann.
Die wenig zahlreichen Gebilde, die wir als versteinerte Gallen anzusprechen Veranlassung haben,
können naturgemäß nur vermutungsweise und immer nur in Analogie zu den rezenten Gallenformen
auf bestimmte Gallentiere zurückgeführt werden; die Wirtspflanzen sind noch dazu ebenfalls oft
unbestimmbar. Daß in vielen Fällen eine Unterscheidung zwischen Gallen, Pilzen oder irgend
welchen Veränderungen an einem Pflanzenteil, die nichts mit Gallenerzeugern zu tun haben,
nicht mit Sicherheit durchgeführt werden kann, versteht sich von selbst.
Das Wenige, was über die Paläontologie der Gallen bekannt ist, hat T r o 11 e r unlängst
zusammengestellt. Seinen Ausführungen schließen wir uns mit den folgenden Zeilen an.
Von C y n i p i d e n gallen ist durch Versteinerungen uns nichts überliefert, — was bei der
charakteristischen Form und der mechanischen Widerstandsfähigkeit der rezenten Formen überraschen
muß.
Ein auf einer unbestimmbaren Wirtspflanze gefundenes Gebilde hat H e e r a l s B l a t t -
w e s p e n galle angesprochen.
D i p t e r e n gallen hat man verschiedene zu finden gemeint (nach T r o 11 e r drei), z. B.
auf Fagus pliocenica eine Galle von Mikiola fagi.
Von He mi p t e r e n g a l l e n hat man nur die des Pemphigus cornicularius auf Pistacia
narbonensis gefunden.