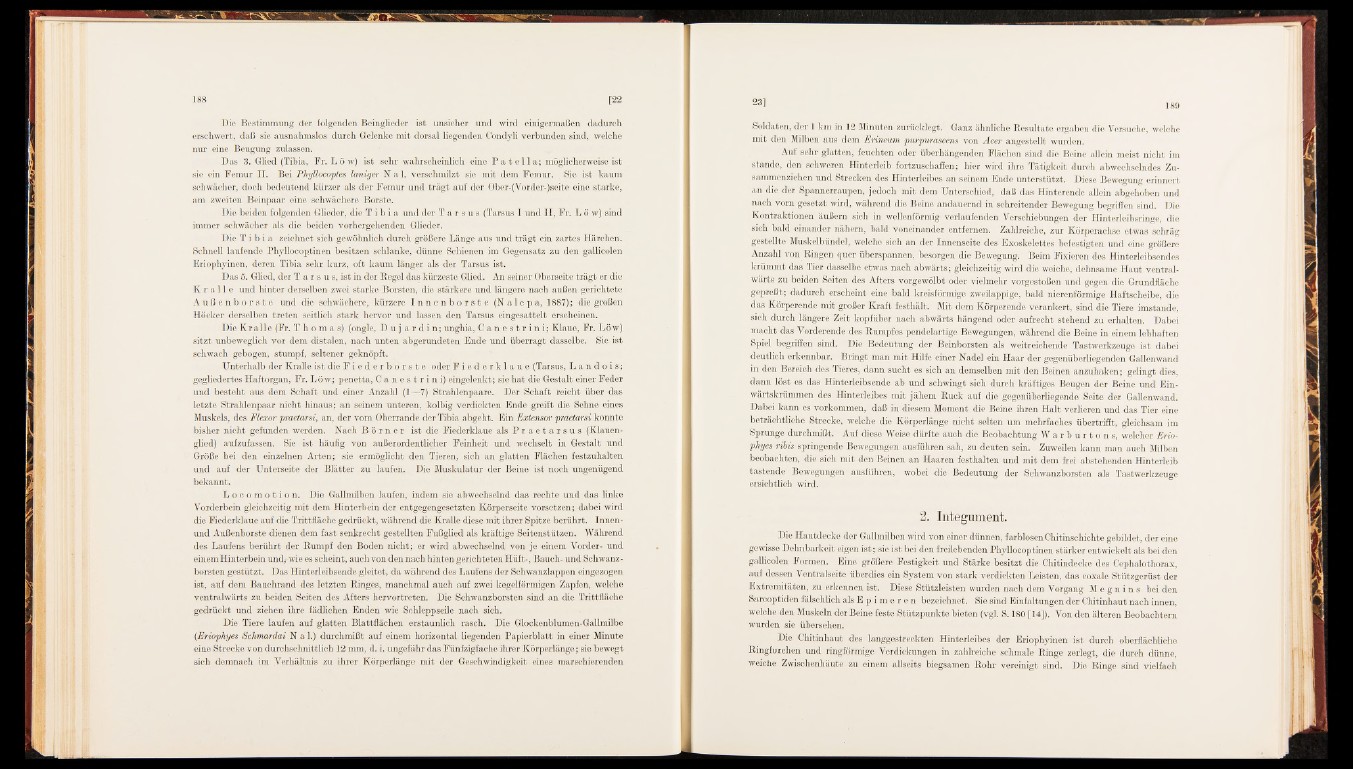
Die Bestimmung der folgenden Beinglieder ist unsicher und wird einigermaßen dadurch
erschwert, daß sie ausnahmslos durch Gelenke mit dorsal liegenden Condyli verbunden sind, welche
nur eine Beugung zulassen.
Das 3. Glied (Tibia, Fr. L ö w) ist sehr wahrscheinlich eine P a t e l l a ; möglicherweise ist
sie ein Femur II. Bei Phyllocoptes laniger Nal . verschmilzt sie mit dem Femur. Sie ist kaum
schwächer, doch bedeutend kürzer als der Femur und trägt auf der Ober-(Vorder-)seite eine starke,
am zweiten Beinpaar eine schwächere Borste.
Die beiden folgenden Glieder, die T i b i a und der T a r s u s (Tarsus I und II, Fr. L ö w) sind
immer schwächer als die beiden vorhergehenden Glieder.
Die T i b i a zeichnet sich gewöhnlich durch größere Länge aus und trägt ein zartes Härchen.
Schnell laufende Phyllocoptinen besitzen schlanke, dünne Schienen im Gegensatz zu den gallicolen
Eriophyinen, deren Tibia sehr kurz, oft kaum länger als der Tarsus ist.
Das 5. Glied, der T a r s u s, ist in der Regel das kürzeste Glied. An seiner Oberseite trägt er die
K r a l l e und hinter derselben zwei starke Borsten, die stärkere und längere nach außen gerichtete
A u ß e n b o r s t e und die schwächere, kürzere I n n e n b o r s t e (Na l e p a , 1887); die großen
Höcker derselben treten seitlich stark hervor und lassen den Tarsus eingesattelt erscheinen.
Die Kral le (Fr. T h oma s ) (ongle, D u j a r d i n ; unghia, C a n e s t r i n i; Klaue, Fr. Löw)
sitzt unbeweglich vor dem distalen, nach unten abgerundeten Ende und überragt dasselbe. Sie ist
schwach gebogen, stumpf, seltener geknöpft.
Unterhalb der Kralle ist die F i e d e r b o r s t e oder F i e d e r k l a u e (Tarsus, L a n d o i s ;
gegliedertes Haftorgan, Fr. Löw; penetta, C a n e s t r i n i ) eingelenkt; sie hat die Gestalt einer Feder
und besteht aus dem Schaft und einer Anzahl (1—7) Strahlenpaare. Der Schaft reicht über das
letzte Strahlenpaar nicht hinaus; an seinem unteren, kolbig verdickten Ende greift die Sehne eines
Muskels, des Flexor praetarsi, an, der vom Oberrande der Tibia abgeht. Ein Extensor praetarsi konnte
bisher nicht gefunden werden. Nach B ö r n e r ist die Fiederklaue als P r a e t a r s u s (Klauenglied)
aufzufassen. Sie ist häufig von außerordentlicher Feinheit und wechselt in Gestalt und
Größe bei den einzelnen Arten; sie ermöglicht den Tieren, sich an glatten Flächen festzuhalten
und auf der Unterseite der Blätter zu laufen. Die Muskulatur der Beine ist noch ungenügend
bekannt.
L o c o m o t i o n . Die Gallmilben laufen, indem sie abwechselnd das rechte und das linke
Vorderbein gleichzeitig mit dem Hinterbein der entgegengesetzten Körperseite vorsetzen; dabei wird
die Fiederklaue auf die Trittfläche gedrückt, während die Kralle diese mit ihrer Spitze berührt. Innen-
und Außenborste dienen dem fast senkrecht gestellten Fußglied als kräftige Seitenstützen. Während
des Laufens berührt der Rumpf den Boden nicht; er wird abwechselnd von je einem Vorder- und
einem Hinterbein und,-wie es scheint, auch von den nach hinten gerichteten Hüft-, Bauch- und Schwanzborsten
gestützt. Das Hinterleibsende gleitet, da während des Laufens der Schwanzlappen eingezogen
ist, auf dem Bauchrand des letzten Ringes, manchmal auch auf zwei kegelförmigen Zapfen, welche
ventralwärts zu beiden Seiten des Afters hervortreten. Die Schwanzborsten sind an die Trittfläche
gedrückt und ziehen ihre fädlichen Enden wie Schleppseile nach sich.
Die Tiere laufen auf glatten Blattflächen erstaunlich rasch. Die Glockenblumen-Gallmilbe
(Eriophyes Schmardai Nal . ) durchmißt auf einem horizontal liegenden Papierblatt in einer Minute
eine Strecke von durchschnittlich 12 mm, d. i. ungefähr das Fünfzigfache ihrer Körperlänge; sie bewegt
sich demnach im Verhältnis zu ihrer Körperlänge mit der Geschwindigkeit eines marschierenden
Soldaten, der 1 km in 12 Minuten zurücklegt. Ganz ähnliche Resultate ergaben die Versuche, welche
mit den Milben aus dem Erineum purpurascens von Acer angestellt wurden.
Auf sehr glatten, feuchten oder überhängenden Flächen sind die Beine allein meist nicht im
Stande, den schweren Hinterleib fortzuschaffen; hier wird ihre Tätigkeit durch abwechselndes Zusammenziehen
und Strecken des Hinterleibes an seinem Ende unterstützt. Diese Bewegung erinnert
an die der Spannerraupen, jedoch mit dem Unterschied, daß das Hinterende allein abgehoben und
nach vorn gesetzt wird, während die Beine andauernd in schreitender Bewegung begriffen sind. Die
Kontraktionen äußern sich in wellenförmig verlaufenden Verschiebungen der Hinterleibsringe, die
sich bald einander nähern, bald voneinander entfernen. Zahlreiche, zur Körperachse etwas schräg
gestellte Muskelbündel, welche sich an der Innenseite des Exoskelettes befestigten und eine größere
Anzahl von Ringen quer überspannen, besorgen die Bewegung. Beim Fixieren des Hinterleibsendes
krümmt das Tier dasselbe etwas nach abwärts; gleichzeitig wird die weiche, dehnsame Haut ventralwärts
zu beiden Seiten des Afters vorgewölbt oder vielmehr vorgestoßen und gegen die Grundfläche
gepreßt; dadurch erscheint eine bald kreisförmige zweilappige, bald nierenförmige Haftscheibe, die
das Körperende mit großer Kraft festhält. Mit dem Körperende verankert, sind die Tiere imstande,
sich durch längere Zeit kopfüber nach abwärts hängend oder aufrecht stehend zu erhalten. Dabei
macht das Vorderende des Rumpfes pendelartige Bewegungen, während die Beine in einem lebhaften
Spiel begriffen sind. Die Bedeutung der Beinborsten als weitreichende Tastwerkzeuge ist dabei
deutlich erkennbar. Bringt man mit Hilfe einer Nadel ein Haar der gegenüberliegenden Gallenwand
in den Bereich des Tieres, dann sucht es sich an demselben mit den Beinen anzuhaken; gelingt dies,
dann löst es das Hinterleibsende ab und schwingt sich durch kräftiges Beugen der Beine und Einwärtskrümmen
des Hinterleibes mit jähem Ruck auf die gegenüberliegende Seite der Gallen wand.
Dabei kann es Vorkommen, daß in diesem ÄJoment die Beine ihren Halt verlieren und das Tier eine
beträchtliche Strecke, welche die Körperlänge nicht selten um mehrfaches übertrifft, gleichsam im
Sprunge durchmißt. Auf diese Weise dürfte auch die Beobachtung Wa r b u r t o n s , welcher Erio-
phyes ribis springende Bewegungen ausführen sah, zu deuten sein. Zuweilen kann man auch Milben
beobachten, die sich mit den Beinen an Haaren festhalten und mit dem frei abstehenden Hinterleib
tastende Bewegungen ausführen, wobei die Bedeutung der Schwanzborsten als Tastwerkzeuge
ersichtlich wird.
2. Integument.
Die Hautdecke der Gallmilben wird von einer dünnen, farblosen Chitinschichte gebildet, der eine
gewisse Dehnbarkeit eigen ist; sie ist bei den freilebenden Phyllocoptinen stärker entwickelt als bei den
gallicolen Formen. Eine größere Festigkeit und Stärke besitzt die Chitindecke des Cephalothorax,
auf dessen Ventralseite überdies ein System von stark verdickten Leisten, das coxale Stützgerüst der
Extremitäten, zu erkennen ist. Diese Stützleisten wurden nach dem Vorgang M e g n i n s bei den
Sarcoptiden fälschlich als E p i m e r e n bezeichnet. Sie sind Einfaltungen der Chitinhaut nach innen,
welche den Muskeln der Beine feste Stützpunkte bieten (vgl. S. 180 [14]). Von den älteren Beobachtern
wurden sie übersehen.
Die Chitinhaut des langgestreckten Hinterleibes der Eriophyinen ist durch oberflächliche
Ringfurchen und ringförmige Verdickungen in zahlreiche schmale Ringe zerlegt, die durch dünne,
weiche Zwischenhäute zu einem allseits biegsamen Rohr vereinigt sind. Die Ringe sind vielfach