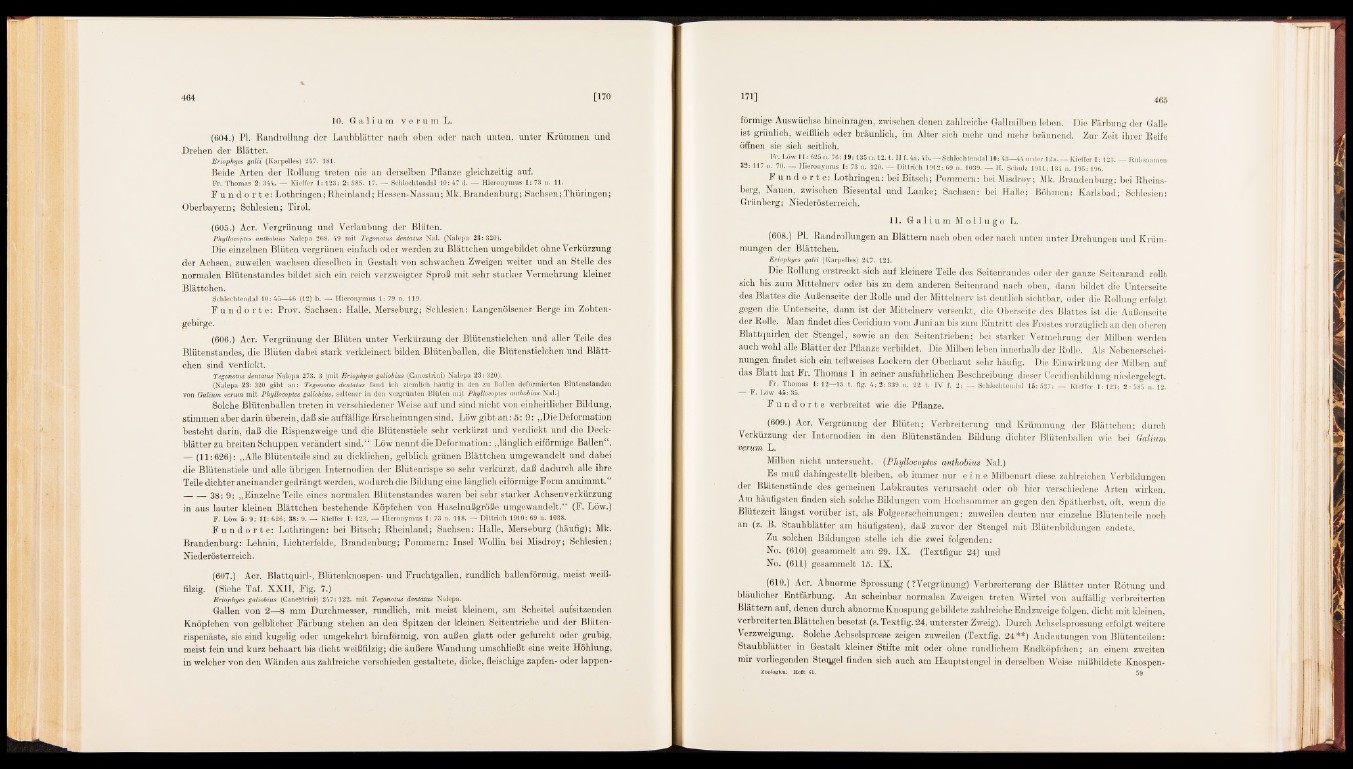
(604.) PI. Randrollung der Laubblätter nacb oben oder nach unten, unter Krümmen und
Drehen der Blätter.
Eriophyes galii (Karpelles) 247. 181.
Beide Arten der Rollung treten nie an derselben Pflanze gleichzeitig auf.
Fr. Thomas'2: 344. — Kieffer 1:123; 2: 585. 17. — Schlechtendal 10: 47 d. — Hieronymus 1: 73 n. 11. 1;‘ ■
F u n d o r t e : Lothringen; Rheinland; Hessen-Nassau; Mk. Brandenburg; Sachsen; Thüringen;
Oberbayern; Schlesien; Tirol.
(605.) Acr. Vergrünung und Verlaubung der Blüten.
Phyllocoptes anthobius Nalepa 268. 49 mit Tegonotus dentatus Nal. (Nalepa 23:320).
Die einzelnen Blüten vergrünen einfach oder werden zu Blättchen umgebildet ohne Verkürzung
der Achsen, zuweilen wachsen dieselben in Gestalt von schwachen Zweigen weiter und an Stelle des
normalen Blütenstandes bildet sich ein reich verzweigter Sproß mit sehr starker Vermehrung kleiner
Blättchen.
Schlechtendal 10: 45—46 (12) b. — Hieronymus 1: 79 n. 119.
F u n d o r t e : Pro v. Sachsen: Halle, Merseburg; Schlesien: Langenölsener Berge im Zobten-
gebirge.
(606.) Acr. Vergrünung der Blüten unter Verkürzung der Blütenstielchen und aller Teile des
Blütenstandes, die Blüten dabei stark verkleinert bilden Blütenballen, die Blütenstielchen und Blättchen
sind verdickt.
Tegonotus dentatus Nalepa 273. 3 (mit Eriophyes galiobius (Ganestrini) Nalepa 23: 320).
(Nalepa 23: 320 gibt an : Tegonotus dentatus fand ich ziemlich häufig in den zu Ballen deformierten Blütenständen
von Galiurn verum m it Phyllocoptes galiobius, seltener in den vergrünten Blüten mit Phyllocoptes anthobius Nal.)
Solche Blütenballen treten in verschiedener Weise auf und sind nicht von einheitlicher Bildung,
stimmen aber darin überein, daß sie auffällige Erscheinungen sind. Löw gibt an: 5: 9: „Die Deformation
besteht darin, daß die Rispenzweige und die Blütenstiele sehr verkürzt und verdickt und die Deckblätter
zu breiten Schuppen verändert sind.“ Löw nennt die Deformation: „länglich eiförmige Ballen“.
— (11:626): „Alle Blütenteile sind zu dicklichen, gelblich grünen Blättchen umgewandelt und dabei
die Blütenstiele und alle übrigen Internodien der Blütenrispe so sehr verkürzt, daß dadurch alle ihre
Teile dichter aneinander gedrängt werden, wodurch die Bildung eine länglich eiförmige Form annimmt.“
38: 9: „Einzelne Teile eines normalen Blütenstandes waren bei sehr starker Achsenverkürzung
in aus lauter kleinen Blättchen bestehende Köpfchen von Haselnußgröße umgewandelt.“ (F. Löw.)
F. Löw 5: 9; 11: 626; 38: 9. — Kieffer 1:123. —- Hieronymus 1: 73 n. 118. — Dittrich 1910: 69 n. 1038.
F u n d o r t e : Lothringen: bei Bitsch; Rheinland; Sachsen: Halle, Merseburg (häufig); Mk.
Brandenburg: Lehnin, Lichterfelde, Brandenburg; Pommern: Insel Wollin bei Misdroy; Schlesien;
Niederösterreich.
(607.) Acr. Blattquirl-, Blütenknospen- und Fruchtgallen, rundlich ballenförmig, meist weißfilzig.
(Siehe Taf. XXII, Fig. 7.)
Eriophyes galiobius (CaneStrini-) 247:122. mit Tegonotus dentatus Nalepa.
Gallen von 2—8 mm Durchmesser, rundlich, mit meist kleinem, am Scheitel aufsitzenden
Knöpfchen von gelblicher Färbung stehen an den Spitzen der kleinen Seitentriebe und der Blütenrispenäste,
sie sind kugelig oder umgekehrt bimförmig, von außen glatt oder gefurcht oder grubig,
meist fein und kurz behaart bis dicht weißfilzig; die äußere Wandung umschließt eine weite Höhlung,
in welcher von den Wänden aus zahlreiche verschieden gestaltete, dicke, fleischige zapfen- oder lappenförmige
Auswüchse hineinragen, zwischen denen zahlreiche Gallmilben leben. Die Färbung der Galle
ist grünlich, weißlich oder bräunlich, im Alter sich mehr und mehr bräunend. Zur Zeit ihrer Reife
öffnen sie sich seitlich.
Fr. Löw 11: 625 n. 76; 19:135 n. 12. t. II f. 4a, 4b. — Schlechtendal 10: 43—44 unter 12a. — Kieffer 1 :1 2 3 . Rübsaamen
32:117 n. 70 Hieronymus 1: 73 n. 120. — Dittrich 1912: 69 n. 1039. — H. Schulz 1911:134 n. 195:196.
F u n d o r t e : Lothringen: bei Bitsch; Pommern: bei Misdroy; Mk. Brandenburg: bei Rheinsberg,
Nauen, zwischen Biesental und Lanke; Sachsen: bei Halle; Böhmen: Karlsbad; Schlesien:
Grünberg; Niederösterreich.
11. G a l i um Mo l l u g o L.
(608.) PI. Randrollungen an Blättern nach oben oder nach unten unter Drehungen und Krümmungen
der Blättchen.
Eriophyes galii (Karpelles) 247. 121.
Die Rollung erstreckt sich auf kleinere Teile des Seitenrandes oder der ganze Seitenrand rollt
sich bis zum Mittelnerv oder bis zu dem anderen Seitenrand nach oben, dann bildet die Unterseite
des Blattes die Außenseite der Rolle und der Mittelnerv ist deutlich sichtbar, oder die Rollung erfolgt
gegen die Unterseite, dann ist der Mittelnerv versenkt, die Oberseite des Blattes ist die Außenseite
der Rolle. Man findet dies Cecidium vom Juni an bis zum Eintritt des Frostes vorzüglich an den oberen
Blattquirlen der Stengel, sowie an den Seitentrieben; bei starker Vermehrung der Milben werden
auch wohl alle Blätter der Pflanze verbildet. Die Milben leben innerhalb der Rolle. Als Nebenerscheinungen
findet sich ein teilweises Lockern der Oberhaut sehr häufig. Die Einwirkung der Milben auf
das Blatt hat Fr. Thomas 1 in seiner ausführlichen Beschreibung dieser Cecidienbildung niedergelegt.
Fr. Thomas 1:12—15 t. fig. 4; 2: 339 n. 22 t. IV f. 2; — Schlechtendal 15: 52#StI— Kieffer 1:123; 2 : 585 n. 12.
| 1 | F. Löw 45: 35.
F u n d o r t e verbreitet wie die Pflanze.
(609.) Acr. Vergrünung der Blüten; Verbreiterung und Krümmung der Blättchen; durch
Verkürzung der Internodien in den Blütenständen Bildung dichter Blütenballen wie bei Galium
verum L.
Milben nicht untersucht. (Phyllocoptes anthobius Nal.)
Es muß dahingestellt bleiben, ob immer nur e i n e Milbenart diese zahlreichen Verbildungen
der Blütenstände des gemeinen Labkrautes verursacht oder ob hier verschiedene Arten wirken.
Am häufigsten finden sich solche Bildungen vom Hochsommer an gegen den Spätherbst, oft, wenn die
Blütezeit längst vorüber ist, als Folgeerscheinungen; zuweilen deuten nur einzelne Blütenteile noch
an (z. B. Staubblätter am häufigsten), daß zuvor der Stengel mit Blütenbildungen endete.
Zu solchen Bildungen stelle ich die zwei folgenden:
No. (610) gesammelt am 29. IX. (Textfigur 24) und
No. (611) gesammelt 15. IX.
(610.) Acr. Abnorme Sprossung ( ?Vergrünung) Verbreiterung der Blätter unter Rötung und
bläulicher Entfärbung. An scheinbar normalen Zweigen treten Wirtel von auffällig verbreiterten
Blättern auf, denen durch abnorme Knospung gebildete zahlreiche Endzweige folgen, dicht mit kleinen,
verbreiterten Blättchen besetzt (s. Textfig. 24, unterster Zweig). Durch Achselsprossung erfolgt weitere
Verzweigung. Solche Achselsprosse zeigen zuweilen (Textfig. 24**) Andeutungen von Blütenteilen:
Staubblätter in Gestalt kleiner Stifte mit oder ohne rundlichem Endköpfchen; an einem zweiten
mir vorliegenden Stemel finden sich auch am Hauptstengel in derselben Weise mißbildete Knospen-
Zoologica, Heft 61. 59