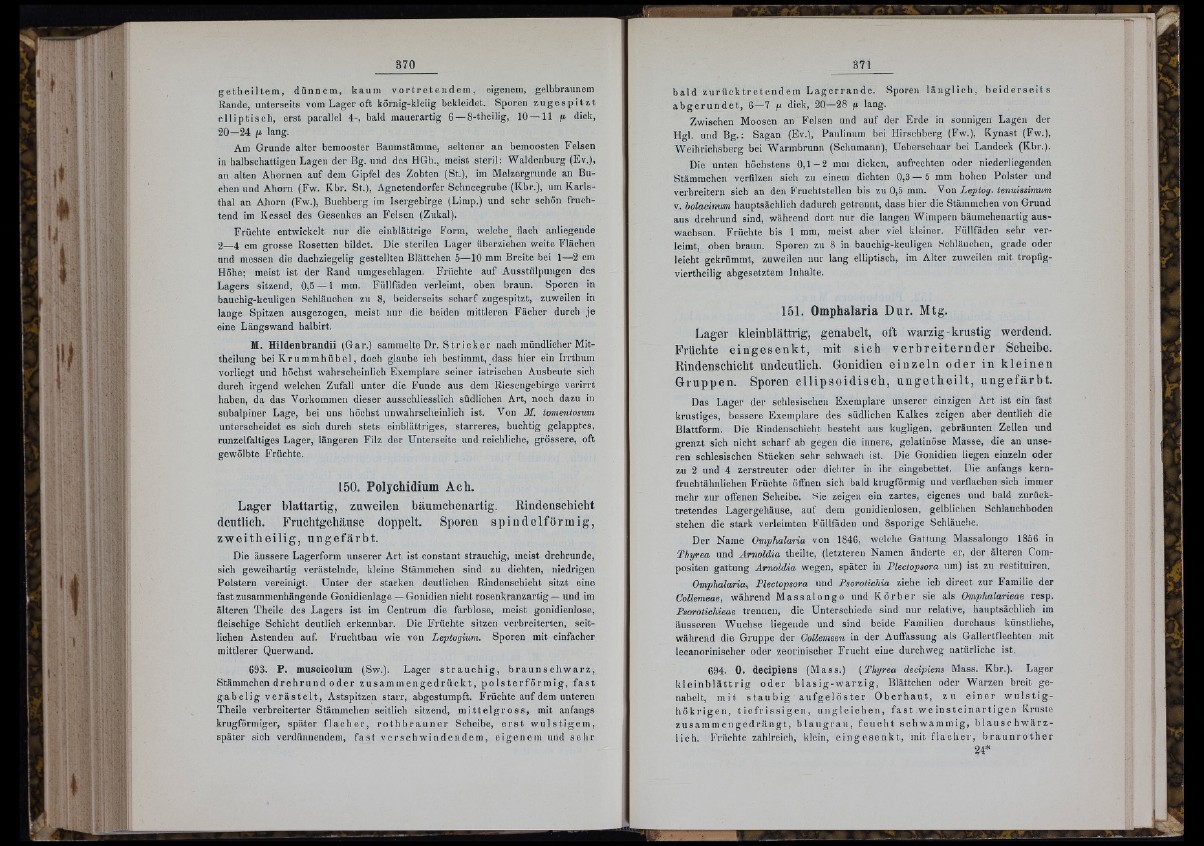
«
Ij
t
g e t h e i l t e m , d ü n n e m , k a u m v o r t r e t e n d e m , eigenem, gelbbraunem
Rande, unterseits vom Lager oft körnig-kleiig bekleidet. S p oren z u g e s p i t z t
e l l i p t i s c h , e rs t parallel 4-, bald mauerartig 6 — 8-theilig, 1 0— 11 p dick,
2 0—24 p lang.
Am Grunde alter bemooster Baumstämme, seltener an bemoosten Felsen
in halbsohattigen Lagen der Bg. und des HGh., meist s te ril; W ald en b u rg (Ev.),
an alten Ahornen a u f dem Gipfel des Zobten (St.), im Melzergrunde an Buchen
und Ahorn (Fw. Kbr. St.), Agnetendorfer Schneegrube (Kbr.), um K a rls thal
an Ahorn (Fw.), Buchberg im Isergebirge (Limp.) uud sehr schön fruchtend
im Kessel des Gesenkes an F e lsen (Zukal).
Frü ch te entwickelt nur die einblättrige Form, welche_ flaeh anliegende
2—4 cm g rosse Rosetten bildet. Die sterilen L a g e r überziehen weite B’lächen
und messen die dachziegelig gestellten Blättchen 5— 10 mm Breite bei 1—2 cm
Höhe; meist ist der Rand nmgeschlagen. B'rüchte au f Ausstülpungen des
Lagers sitzend, 0,5 — 1 mm. Füllfäden verleimt, oben braun. Sporen in
bauchig-keuligen Schläuchen zu 8, beiderseits s ch a rf zugespitzt, zuweilen in
lange Spitzen ausgezogen, meist nur die beiden mittleren B'ächer durch je
eine Längswand halbirt.
M. H ild e n b ra n d ii (G a r.) sammelte Dr. S t r i c k e r nach mündlicher Mittheilung
bei K r u m m h ü b e l , doch glaube ich bestimmt, dass hier ein Irrthum
vorliegt und höchst wahrscheinlich Exemplare seiner istrischen Ausbeute sich
durch irgend welchen Zufall u n te r die Funde aus dem Riesengehirge v e rirrt
haben, da das Vorkommen dieser ausschliesslich südlichen Art, noch dazu in
subalpiner Lage, bei uns höchst unwahrscheinlich Ist. Von M. tomentosum
unterscheidet es sich durch stets einblättriges, s ta rre re s, buchtig gelapptes,
runzelfaltiges Lager, längeren Filz d e r U nterseite und reichliche, grössere, oft
gewölbte B'rüchte.
150. Polychidium Ach.
Lager blattartig, zuweilen bäumchenartig. Rindenschicht
deutlich. Fruchtgehäuse doppelt. Sporen s p i n d e l f örm i g ,
zw e i t h e i l i g , un ge f ä rbt .
Die äussere Lagerform u n serer A rt ist constant strauchig, meist drehrunde,
sich geweihartig verästelnde, kleine Stämmchen sind zu dichten, niedrigen
P o ls te rn vereinigt. U n te r der s tarken deutliclien Rindenschicht s itz t eine
fa st zusammenhängende Gonidienlage — G onidien nicht rosenkranza rtig — und im
ä lteren Theile des Lagers ist im Centrum die farblose, meist gonidienlose,
fleischige Schicht deutlich erkennbar. Die Frü ch te sitzen verbreiterten, seitlichen
Astenden auf. B'ruchtbau wie von Leptogium. Sporen mit einfacher
m ittlerer Querwand.
693. P . muscicolum (Sw.). Lage r s t r a u c h i g , b r a u n s c h w a r z ,
Stämmchen d r e h r n n d o d e r z u s a m m e n g e d r ü c k t , p o l s t e r f ö r m i g , f a s t
g a b e l i g v e r ä s t e l t , Astspitzen s ta rr, abgestumpft. Frü ch te a u f dem unteren
Theile v e rb re ite rte r Stämmchen seitlich sitzend, m i t t e l g r o s s , mit anfangs
krugförmiger, sp ä te r f l a c h e r , r o t h b r a u n e r Scheibe, e r s t w u l s t i g e m ,
sp äte r sich verdünnendem, f a s t v e r s e i l w i n d e n d e m , e i g e n e m nnd s e h r
b a l d z u r ü c k t r e t e n d e m L a g e r r a n d e . Sporen l ä n g l i c h , b e i d e r s e i t s
a b g e r u n d e t , 6—7 p dick, 20—28 p lang.
Zwischen Moosen an B'elsen und au f der E rd e in sonnigen Lagen der
Hgl. und B g .: Sagan (Ev.), Paulinum bei Hirschberg (Fw.), Kynast (Fw.),
W eih rich sh e rg bei W arm brunn (Sclmmann), Ueberschaar bei Landeck (Kbr,).
Die unten höchstens 0 , 1 - 2 mm dicken, aufrechten oder niederliegenden
Stämmchen verfilzen sich zu einem dichten 0,3 — 5 mm hohen P o ls te r und
verbreitern sich an den B’ruchtstellen bis zu 0,5 mm. Vo n Leptog. tenuissimum
v. holacinum hauptsächlich dadurch getrennt, dass hier die Stämmchen von Grund
aus drehrnnd sind, während d o rt nur die langen Wimpern bäumchenartig a u s wachsen.
F rü ch te bis 1 mm, meist aber viel kleiner. Füllfäden sehr verleimt,
oben braun. Sporen zu 8 in bauchig-keuligen Schläuchen, grade oder
leicht gekrümmt, zuweilen nur lang elliptisch, im Alter zuweilen mit tropfig-
viertheilig abgesetztem Inhalte.
151. Omphalaria Dur. Mtg.
Lager kleinblättrig, genabelt, oft warzig-krustig werdend.
Früchte e i n g e s e n k t , mit sich v e r b r e i t e r n d e r Scheibe.
Rindenschicht undeutlich. Gonidien e i nz e l n ode r in k l e i n e n
Gruppen. Sporen e l l i p s o i d i s c h , u n g e t h e i l t , u n g ef ä r b t .
Das Lager der schlesischen Exemplare un serer einzigen Art ist ein fa st
krustiges, bessere Exemplare des südlichen Kalkes zeigen aber deutlich die
Blattform. Die Rindenschicht b e steh t aus kugligen, gebräunten Zellen und
gren z t sich nicht sch a rf ab gegen die innere, gelatinöse Masse, die an unseren
schlesischen Stücken sehr schwach ist. Die Gonidien liegen einzeln oder
zu 2 nnd 4 z e rstreu te r oder dicliter in Ihr eingebettet. Die anfangs kernfruchtähnlichen
Frü ch te öffnen sich bald krugförmig und verflachen sich immer
mehr zur offenen Scheibe. Sie zeigen ein zartes, eigenes und bald zurfick-
tretendes Lagergehäuse, au f dem gonidienlosen, gelblichen Schlauchboden
stehen die s ta rk verleimten B’üllfäden und Ssporige Schläuclie.
Der Name Omphalaria von 1846, welche Gattung Massalongo 1856 in
Thyrea und Arnoldia theilte, (letzteren Namen änderte er, der älteren Com-
positen gattn n g Arnoldia wegen, sp äte r iu Plectopsora um) ist zu restituiren.
Omphalaria, Plectopsora und Psorotichia ziehe ich direct zur Familie der
CoUemeae, während M a s s a l o n g o und K ö r b e r sie als Omphalarieae resp.
Psorotichieae trennen, die Unterschiede sind n u r relative, hauptsächlich im
äusse ren W üchse liegende und sind beide Familien durchaus künstliche,
während die Gruppe der CoUemeen iu der Auffassung als Gallertflechten mit
lecanorlnischer oder zeoriuischer B’rueht eine durchweg natürliche ist.
694. 0 . d e cip ien s (M a s s .) (T h yrea decipiens Mass. Kbr.). Lager
k l e i n b l ä t t r i g o d e r b l a s i g - w a r z i g , Blättchen oder W a rz en b re it genabelt,
m i t s t a u b i g a u f g e l ö s t e r O b e r h a u t , z u e i n e r w u l s t i g -
h ö k r i g e n , t i e f r i s s i g e n , u n g l e i c h e n , f a s t w e i n s t e i n a r t i g e n Kruste
z u s a m m e n g e d r ä n g t , b l a n g r a u , f e u c h t s c h w a m m i g , h l a n s c h w ä r z -
l i c h . B'rüchte zahlreich, klein, e i n g e s e n k t , mit f l a c h e i - , b r a u n r o t h e r
24*