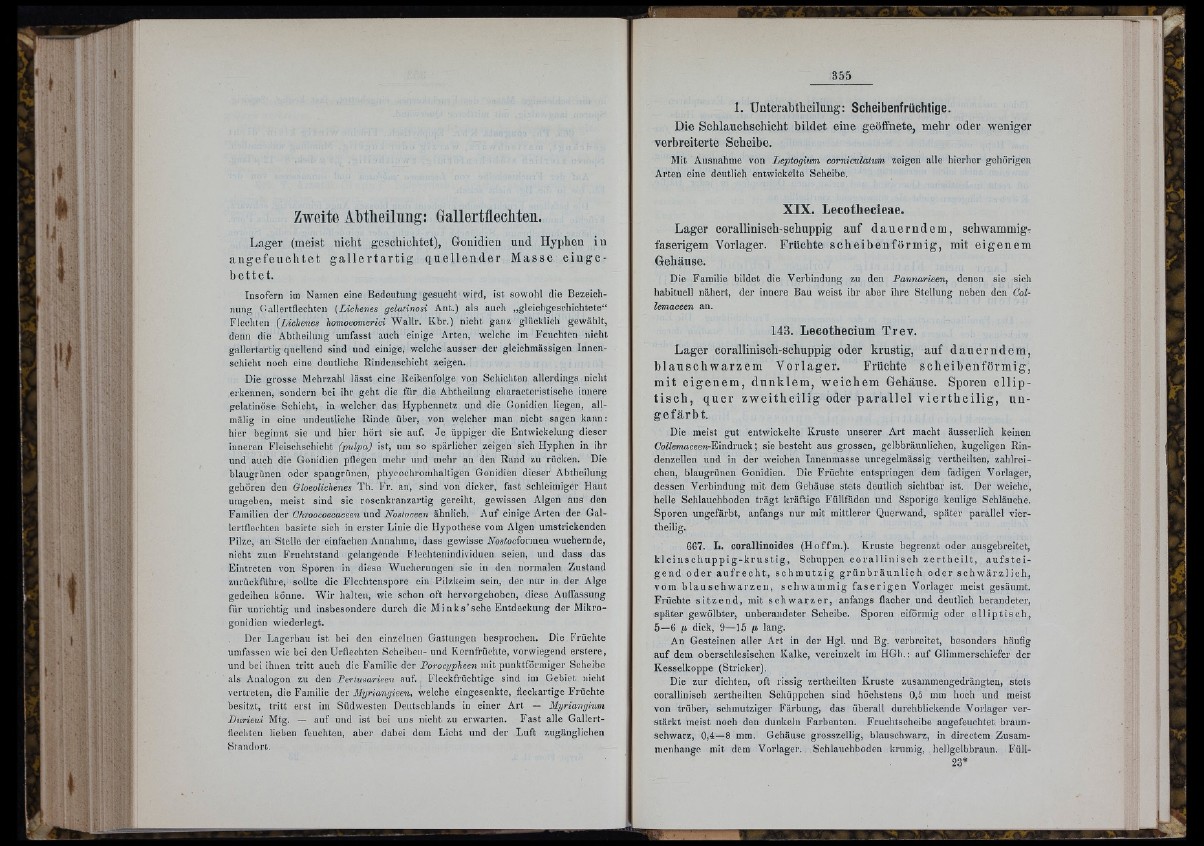
I»
U .
1
'i
Zweite Abtheilimg: Grallertflechten.
Lager (meist nicht geschichtet), Gonidien und Hyphen in
a n g e f e u e h t e t g a l l e r t a r t i g q u e l l e n d e r M a s s e e i n g e bet
tet .
Insofern im Nainen eine Bedeutung gesucht wird, ist sowohl die Bezeichnung
(hUlertflechten (Lichenes gelatinosi Ant.) als auch ,,gleichgeschiehtete“
Flechten (Lichenes homoeomerici W a llr. Kbr.) nicht ganz glücklich gewählt,
denn die Abtheilnng umfasst auch einige Arten, welche im Feuchten nicht
ga lle rta rtig quellend sind und einige, welche au sse r der gleichmässigen Innenschicht
noch eine deutliche Rindenschicht zeigen.
Die gro sse Mehrzahl lä ss t eine Reihenfolge von Schichten allerdings nicht
erkennen, sondern bei ihr geht die für die Abtheilnng characteristisehe innere
gelatinöse Schicht, in welcher das Hyphennetz und die Gonidien liegen, all-
mälig in eine undeutliche Rinde über, von welcher man nicht sagen kann:
hier beginnt sie und hier h ö rt sie auf. J e üppiger die Entwickelung dieser
inneren Fleischschicht (pulpa) ist, um so spärlicher zeigen sich Hyphen in ihr
und auch die Gonidien pflegen mehr und mehr an den Rand zu rücken. Die
blaugrünen oder spangriinen, phycochronihaltigen Gonidien dieser Abtheilung
gehören den Gloeolichenes Th. Fr. an, sind von dicker, fa st schleimiger Haut
umgeben, meist sind sie ro sen k ran za rtig gereiht, gewissen Algen aus den
Familien der Ghroococcaceen und Nostoceen ähnlich. A u f einige Arten der Gallertflechten
basirte sich in e rs te r Linie die Hypothese vom Algen umstrickenden
Pilze, an Stelle der einfachen Annahme, dass gewisse Nostocfovmen wuchernde,
nicht zum B'ruchtstand gelangende Flechtenindividucn seien, und dass das
E in tre ten von Sporen in diese Wucherungen sie in den normalen Zustand
zurückführe, sollte die Flechtenspore ein Pilzkeim sein, der nur in der Alge
gedeihen könne. W ir halfen, wie schon oft hervorgehoben, diese Auflassung
fü r unrichtig und insbesondere durch die M i n k s ’ sehe Entdeckung der Mikro-
gonldlen wiederlegt.
Der Lagerbau ist bei den einzelnen Gattungen besprochen. Die Früchte
umfassen wie bei den Urflechten Scheiben- und Kernfrüchte, vorwiegend e rs te re ,
und bei ihnen tritt auch die B'amilie der Porocypheen mit punktförmiger Scheibe
als Analogon zu den Pertusarieen auf. B'leckfrüchtige sind im Gebiet nicht
v ertreten, die Familie der Myriangieen, welche eingesenkte, fleckartige F rü ch te
besitzt, tritt e rs t im Südwesten Deutschlands in einer A rt — Myriangium
Durieui Mtg. — au f und ist bei uns nicht zu erwarten. B'ast alle Gallert-
flecliteu lieben feuchten, aber dabei dem Licht und der Luft zugänglichen
Standort.
1. Unterahtheilung: Scheibenfrüchtige.
Die Schlauchscliicht bildet eine geöffnete, mehr oder weniger
verbreiterte Scheibe.
Mit Ausnahme von L ep to g im i corniculaium zeigen alle hierher gehörigen
Arten eine deutlich entwickelte Scheibe.
X IX . Lecothecieae.
Lager corallinisch-schuppig auf d a u e r n dem , schwammigr
faserigem Vorlager. Früchte s c h e i b e n f ö r m i g , mit e i g enem
Gehäuse.
Die Familie bildet die Verbindung zu den Pannarieen, denen sie sich
habituell nähert, der innere Bau w e ist ihr aber ihre Stellung neben den Ool-
lemaceen an.
143. Lecothecium Trev.
Lager corallmisch-schuppig oder krustig, auf d a u e r n dem,
b l a u s c hwa r z em Vor l age r . Früchte s c h e i b e n förmi g ,
mi t e i g e n e m , d un k lem, we i ch em Gehäuse. Sporen e l l i p t
i s c h , q ue r z w e i t h e i l i g oder p a r a l l e l v i e r t h e i l i g , u n ge
f ä r b t .
Die meist g u t entwickelte K ru s te un serer A rt macht äusserlich keinen
CoHemaceen-Eindruck; sie be steht aus grossen, gelbbräunlichen, kugeligen Rindenzellen
und in der weichen Innenmasse unregelmässig vertheilten, z ah lre ichen,
blaugrünen Gonidien. Die B'rüchte entspringen dem fädigen Vorlager,
dessen Verbindung mit dem Gehäuse stets deutlich sichtbar ist. Der weiche,
helle Schlauchboden tr ä g t kräftige Füllfäden und Ssporige keulige Schläuche.
S p oren ungefärbt, anfangs n u r mit m ittlerer Querwand, sp äte r parallel viertheilig.
667. L. coralllnoldes (H o ffm .) . K ru s te begrenzt oder ausgebreitet,
k l e i n s c h u p p i g - k r u s t i g , Schuppen c o r a l l i n i s c h z e r t h e i l t , a u f s t e i g
e n d o d e r a u f r e c h t , s c h m u t z i g g r ü n b r ä u n l i c h o d e r s c h w ä r z l i c h ,
v om b l a u s c h w a r z e n , s c h w a m m i g f a s e r i g e n Vo rlag e r meist gesäumt.
B'rüchte s i t z e n d , mit s c h w a r z e r , anfangs flacher und deutlich berandeter,
s p ä te r gewölbter, u n be randeter Scheibe. S p oren eiförmig oder e l l i p t i s c h ,
5—6 p dick, 9—15 p lang.
An Gesteinen aller A rt in der Hgl. und Bg. verbreitet, besonders häufig
a u f dem oberschlesischen Kalke, vereinzelt im HGh.: au f Glimmerschiefer der
Kesselkoppe (Stricker).
Die zur dichten, oft rissig zertheilten K ru s te zusainmeugedräiigtea, stets
corallinisch zertheilten Schüppchen sind höchstens 0,5 mm hoch und meist
von trü b e r, schmutziger Färbung, das überall durchblickende Vorlager vers
tä rk t meist noch den dunkeln Farbenton. Fruchtscheibe angefeuchtet braunschwarz,
0,4—8 mm. Gehäuse grosszellig, blauschwarz, in directem Zusammenhänge
mit dem Vorlager. Schlauchboden krumig, hellgelbbraun. Füll-
23’*
' t.aSKBPSBWfc.'dHiHN»'