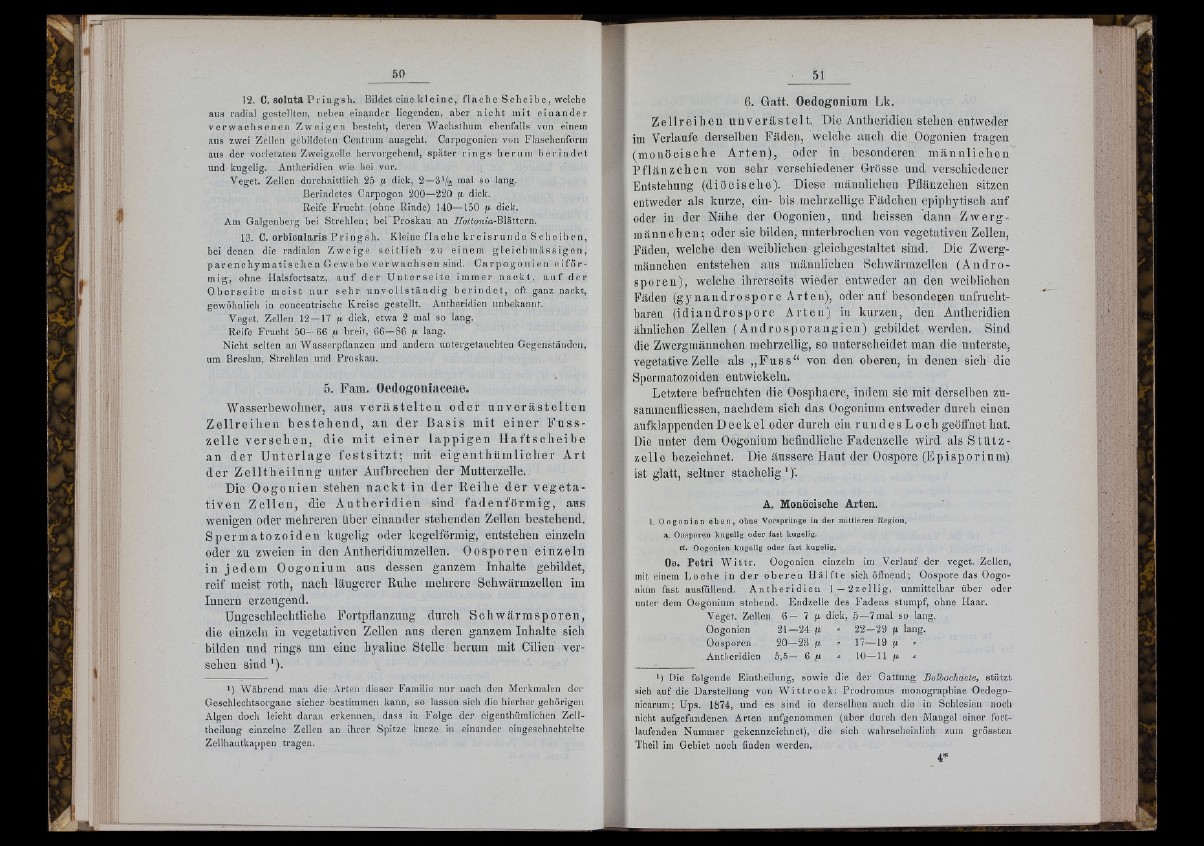
12. C. s o ln ta P r i i i g s l i . Bildet eine k l e i n e , f l a c h e S c h e i b e , welche
aus radia l gestellten, neben e inander liegenden, aber n i c h t m i t e i n a n d e r
v e rw a c h s e n e n Z w e i g e n besteht, deren Wachsthum ehenfalhs von einem
aus zwei Zellen gebildeten Centrum aiisgeht. Carpogonien von Fla.schenfonn
ans d e r vorletzten Zweigzelle hervorgehend, sp ä te r r i n g s h e r u m b e r i n d e t
und kugelig. Antheridien wie bei vor.
Veget. Zellen durchnittlich 25 fj. dick, 2—S ’/z mal so lang.
Berindetes Carpogon 200—220 (t dick.
Reife F ru ch t (ohne Rinde) 140— 150 ft dick.
Am Galgeiiberg bei S treh len ; bei P ro sk au an 7/otionia-Blättern.
13. C. o rb ic u la r is P r i n g s h . Kleine f l a c h e k r e i s r u n d e S c h e i b e n ,
bei denen die radialen Z w e i g e s e i t l i c h z u e in e m g l e i c h m ä s s i g e n ,
p a r e n c h y m a t i s c h e n G e w e b e v e rw a c h s e n sind. C a r p o g o n i e n e i f ö r m
ig , ohne Halsfortsatz, a n f d e r U n t e r s e i t e im m e r n a c k t , a u f d e r
O b e r s e i t e m e i s t n u r s e h r u n v o l l s t ä n d i g b e r i n d e t , oft ganz nackt,
gewöhnlich in concentrisehe K re ise g estellt. Antheridien unbekannt.
Veget. Zellen 12—17 fi dick, etwa 2 mal so lang.
Reife F ru ch t 50—66 breit, 66—86 fi lang.
Nicht s elten an Wasserp flan zen und ändern untergetanchteu GcgciistäTidcn,
um Breslau, S trehlen und Proskau.
5. Fam. O ed o g o n ia c e a e .
Wasserbewohner, ans v e r ä s t e l t e n o d e r n n v e r ä s t e l t e n
Z e l l r e i h e n b e s t e h e n d , a n d e r B a s i s m i t e i n e r F u s s -
z e l l e v e r s e h e n , di e mi t e i n e r l a p p i g e n H a f t s o h e i b e
a n d e r U n t e r l a g e f e s t s i t z t ; mit e i g e n t hUml i c h e r Ar t
d e r Z e l l t h e i l u n g un ter Auf brechen der Mutterzelle.
Die Oo g o n i e n stehen n a c k t in d e r R e i h e d e r v e g e t a t
i v e n Z e l l e n , die A n t h e r i d i e n sind f a d e n f ö rm i g , ans
wenigen oder mehreren Uber einander stehenden Zellen bestehend.
S p e rm a t o z o i d e n kugelig oder kegelförmig, entstehen einzeln
oder zu zweien in den Antheridiumzellen. O o s p o r e n e i n z e l n
in j e d e m Oo g o n i um aus dessen ganzem In h a lte gebildet,
re if meist roth, nach längerer Ruhe mehrere Schwärmzellen im
Innern erzeugend.
Ungeschlechtliche Fortpflanzung durch S c h w ä rm s p o r e n ,
die einzeln iu vegetativen Zellen aus deren ganzem In h a lte sich
bilden und rings um eine hyaline Stelle herum mit Cilien v ersehen
s in d ') .
6. Gatt. Oedogonium Lk.
Zel l r e i h e n n n v e r ä s t e l t . Die Antheridien stehen entweder
im Verlaufe derselben Fäd en , welche auch die Oogonien tragen
( m o n ö c i s c h e Ar t e n ) , oder in besonderen m ä n n l i c h e n
P f l ä n z c h e n von sehr verschiedener Grösse und verschiedener
Entstehung (diöci scl i e) . Diese männlichen Pflänzchen sitzen
entweder als kurze, ein- bis mehrzellige Fäd eh en epiphytisch au f
oder in der Nähe der Oogonien, und heissen dann Z w e r g m
ä n n c h e n ; oder sie bilden, unterbrochen von vegetativen Zellen,
Fäden, welche den weiblichen gleichgestaltet sind. Die Zwerg-
männohen entstehen aus mäniiliclien Schwärmzellen ( A n d r o -
spor en) , welche ih rerseits wieder entweder an den weiblichen
Fäden ( g y n a n d r o s p o r e Ar ten) , oder a u f besonderen unfruchtbaren
( i d i a n d r o s p o r e Ar t e n ) in k u rz en , den Antheridien
ähnlichen Zellen ( A n d r o s p o r a n g i e n ) gebildet werden. Sind
die Zwergmännchen mehrzellig, so unterscheidet man die unterste,
vegetative Zelle als „ F u s s “ von den oberen, in denen sich die
Spermatozoiden entwickeln.
Letztere befruchten die Oosphaere, indem sie mit derselben zu-
sammenfliessen, nachdem sich das Oogonium entweder durch einen
anfklappenden D e c k e l oder durch ein r u n d e s L o c h geöffnet hat.
Die unter dem Oogonium heflndliche Fadenzelle wird als S t ü t z -
zel l e bezeichnet. Die äussere Haut der Oospore ( E p i s p o ri u m)
ist glatt, seltner sta ch e lig ')'.
A. Monöcische Arten.
1. O o g o n i e n e b e n , o h n e V o rsp rü n g e in d e r m ittle r e n R eg io n ,
a. O o sp o re n k u g e lig o d e r fa s t k u g e lig .
ce, O o g o n ie n k u g e lig o d e r fa st k u g e lig .
Oe. P e t r i W i t t r . Oogonien einzeln im V e rlau f d e r veget. Zellen,
mit einem L o c h e in d e r o b e r e n H ä l f t e sich öffnend; Oospore das Oogonium
fast ausfiillend. A n t h e r i d i e n 1 —2 z e l l i g , unmittelbar über oder
unter dem Oogonium stehend. Endzeile des F adens stumpf, ohne Haar.
Veget. Zellen 6 — 7 ft dick, 5—7 mal so lang.
Oogonien 21—24 (t > 2 2 - 2 9 ¡i lang.
Oosporen 20—23 ft = 17— 19 ft >
Antheridien 5,5— 6 ft > 10—11 ft >
I) W äh ren d man die Arten dieser Familie nur nach den Merkmalen der
Geschlechtsorgane sicher bestimmen kann, so lassen sich die hie rhe r gehörigen
Algen doch leicht daran erkennen, dass in Folge d e r eigenthümlichen Zell-
theilmig einzelne Zellen an ihre r Spitze kurze in e inander eingesoliachtelte
Zellhautkappen tragen.
') Die folgende Eintheilung, sowie die der Gattung Bolboohaete, s tü tz t
sich auf die Darstellung von W i t t r o c k : P rodromus inonographiae Oedogo-
niearum; Ups. 1874, und es sind in derselben auch die in Schlesien noch
nicht aufgefundenen Arten aufgenommeii (aber durch den Mangel einer fo rtlaufenden
Nummer gekennzeichnet), die sich wahrscheinlich zum grö ssten
Theil im Gebiet noch finden werden.