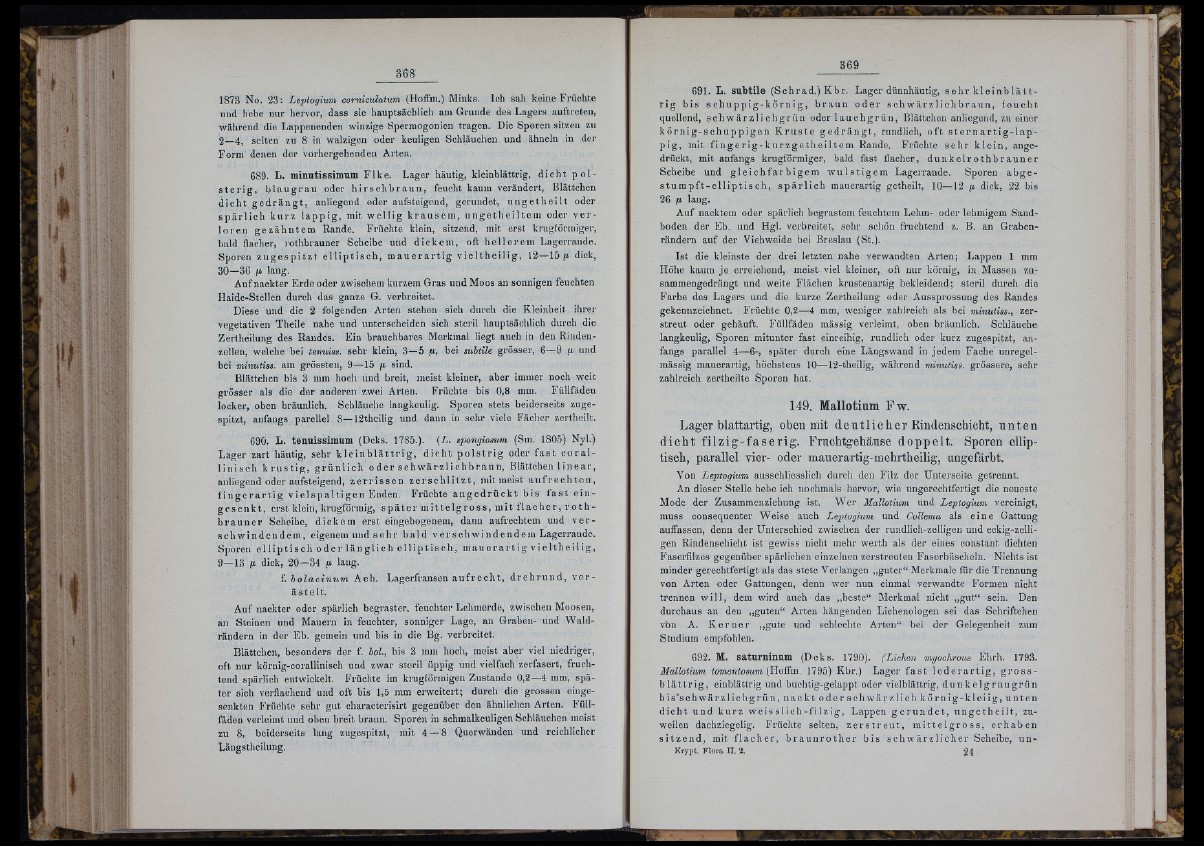
\i
l -
1873 No. 23: Leptogium corniculaium (Hoffm.) Minks. Ich sah keine F rü ch te
nnd hebe n u r hervor, dass sie hauptsächlich am Grunde des L ag e rs auftreten,
während die Lappenenden winzige Spermogonien tragen. Die S p oren sitzen zu
2—4, selten zu 8 in walzigen oder keuligen Schläueheu und ähneln in der
Fo rm denen der vorhergehenden Arten.
689. L. m in u tis s im um B' 1 k e . Lager häutig, kleinblättrig, d i c h t p o l s
t e r i g , b l a u g r a u oder h i r s c h b r a u n , feucht kaum verändert, Blättchen
d i c h t g e d r ä n g t , anliegend oder aufsteigend, gerundet, u n g e t h e i l t oder
s p ä r l i c h k u r z l a p p i g , mit w e l l i g k r a u s e m , u n g e t h e i l t e m oder v e r l
o r e n g e z ä h n t e m Rande. Frü ch te klein, sitzend, mit e rs t krugförmiger,
bald flacher, ro th b rau n e r Scheibe und d i c k e m , oft h e l l e r e m Lagerrande.
Sporen z u g e s p i t z t e l l i p t i s c h , m a u e r a r t i g v i e l t h e i l i g , 12—1 5 p diek,
3 0—36 p lang.
A u f na ck ter E rd e oder zwisehem kurzem Gras und Moos an sonnigen feuchten
Haide-Stellen durch das ganze G. verbreitet.
Diese und die 2 folgenden A rten stehen sich durch die Kleinheit ihrer
vegetativen Theile nahe und unterscheiden sich steril hauptsächlich durch die
Ze rtheilung des Randes. Ein brauchbares Merkmal liegt auch in den Rindeuzellen,
welche bei tenuiss. seh r klein, 3—5 p, bei subtile g rö sse r, 6—9 p und
bei minutiss. am grössten, 9—15 p sind.
Blättchen bis 3 mm hoch und breit, meist kleiner, aber immer noch weit
g rö s se r als die der anderen zwei Arten. Früchte bis 0,8 mm. Füllfäden
locker, oben bräunlich. Schläuche langkeulig. Sporen s tets beiderseits ziige-
spitzt, anfangs parellel 8—12theilig und dann in s eh r viele Fä cher zertheilt.
690. L. ten n is s im um (Dcks. 1785.). (X. spongiosum (Sm. 1805) Nyl.)
Lag e r z a rt häutig, sehr k l e i n b l ä t t r i g , d i c h t p o l s t r i g oder f a s t c o r a l -
l i n i s c l i k r u s t i g , g r ü n l i c h o d e r s c h w ä r z l i c h b r a u n , Blättchen 1 i n e a r ,
anliegend oder anfsteigend, z e r r i s s e n z e r s c h l i t z t , mit meist a u f r e c h t e n ,
f i n g e r a r t i g v i e l s p a l t i g e n Enden. Frü ch te a n g e d r ü c k t b i s f a s t e i n g
e s e n k t , e rs t klein, krugförmig, s p ä t e r m i t t e l g r o s s , m i t f l a c h e r , r o t h b
r a u n e r Scheibe, d i c k e m e rs t eiugebogenem, dann aufrechtem uud v e r s
c h w i n d e n d e m , eigenem und s e h r b a l d v e r s c h w i n d e n d e m Lagerrande.
Sporen e l l i p t i s c h o d e r l ä n g l i c h e l l i p t i s c h , m a u e r a r t i g v i e l t h e i l i g ,
9—13 p diek, 20—34 p laug.
i . b o l a c i n u m A c h . Lagerfransen a u f r e c h t , d r e h r n n d , v e r ä
s t e l t .
A u f nackter oder spärlich begra ste r, feuchter Lehmerde, zwischen Moosen,
an Steinen und Mauern in feuchter, sonniger Lage, an Graben- und W a ld rän
d e rn in der Eb. gemein und bis in die Bg. verbreitet.
Blättchen, besonders der f. bol, bis 3 mm hoch, meist aber viel niedriger,
oft n u r köruig-corallinisch und zwar s teril üppig und vielfach zerfasert, fruchtend
spärlich entwickelt. Frü ch te im krugförmigen Zustande 0,2—4 mm, sp ä te
r sich verflachend und oft bis 1,5 mm e rw e ite rt; durch die grossen eiuge-
senkten B'rüchte s eh r g u t charac te risirt gegenüber den ähnlichen Arten. B'üllfäden
verleimt und oben bre it braun. S poren in schmalkeuligen Schläuchen meist
zu 8, beiderseits lang ziigespitzt, mit 4 — 8 Querwänden uud reichlicher
Längstheilung.
3 6 9
691. L. s u b tile ( S c h r a d . ) K b r . L ag e r dünnhäutig, s e h r k l e i n b l ä t t r
i g b i s s c h u p p i g - k ö r n i g , b r a u n o d e r s c h w ä r z l i c h b r a u n , f e u c h t
quellend, s c h w ä r z 1 i c h g r ü n oder l a u c h g r ü n , Blättchen anliegend, zu einer
k ö r n i g - s c h u p p i g e n K r u s t e g e d r ä n g t , rundlich, o f t s t e r n a r t i g - l a p p
i g , mit f i n g e r i g - k u r z g e t h e i l t e m Rande. Frü ch te s e h r k l e i n , angedrückt,
mit anfangs krugförmiger, bald fa st flacher, d u n k e l r o t h b r a u n e r
Scheibe und g l e i c h f a r b i g e m w u l s t i g e m Lagerrande. Sporen a b g e s
t u m p f t - e l l i p t i s c h , s p ä r l i c h mauerartig getheilt, 10— 12 p dick, 22 bis
26 p lang.
A u f nacktem oder spärlich begrastem feuchtem Lehm- oder lehmigem Sandboden
der Eb. und Hgl. verbreitet, s eh r schön fruchtend z. B. an Grabenrän
d e rn a u f der Viehweide bei Breslau (St.).
I s t die kleinste der drei letzten nahe verwandten A rte n ; Lappen 1 mm
Blöhe kaum j e erreichend, meist viel kleiner, oft nur körnig, in Massen zusammengedrängt
und weite Flächen k ru sten artig bekleidend; steril durch die
F a rb e des Lagers und die kurze Zertheilung oder Aussprossung des Randes
gekennzeichnet. Frü ch te 0,2—4 mm, weniger zahlreich als bei minutiss., zers
tre u t oder gehäuft. B'üllfäden mässig verleimt, oben bräunlich. Schläuche
langkeulig, S poren mitunter fa st einreihig, rundlich oder kurz zugespitzt, anfangs
parallel 4—6-, sp äte r durch eine Längswand in jedem Fache unregelmässig
mauerartig, höchstens 10—12-theilig, während minutiss. grössere, sehr
zahlreich zertheilte Sporen hat.
149. Mallotium Fw.
Lager blattartig, oben mit d e u t l i c h e r Rmdenschicht, u n t e n
d i c h t f i l z i g - f a s e r i g . Fruchtgehäuse doppel t . Sporen elliptisch,
parallel vier- oder mauerartig-mehrtheilig, ungefärbt.
Von Leptogium ausschliesslich durch den B'llz d e r Unterseite getrennt.
An dieser Stelle hebe ich nochmals hervor, wie ungerechtfertigt die neueste
Mode der Zusammenziehung ist. W e r Mallotium und Leptogium vereinigt,
muss consequenter W eise auch Leptogium und Gollema als e i n e Gattung
auffassen, denn d e r Unterschied zwischen der rundlich-zeiligen und eckig-zeiligen
Rindenschicht ist gewiss nicht mehr werth als der eines constant dichten
B'aserfilzes gegenüber spärlichen einzelnen z erstreu ten Faserbüscheln. Nichts ist
minder g erechtfertigt als das stete Verlangen „g u te r“ Merkmale für die Trennung
von Arten oder Gattungen, denn w e r nun einmal verwandte B'ormen nicht
trennen w i l l , dem wird auch das „b este “ Merkmal nicht „g u t“ sein. Den
durchaus an den „guten“ A rten hängenden Licheuologen sei das Schriftchen
von A. K e r n e r ,,gute und schlechte A rte n “ bei d e r Gelegenheit zum
Studium empfohlen.
692. M. s a tu rn in nm (D c k s . 1790). (Lichen myochrous Ehrh. 1793.
Mallotium tomentosum (HoYim. 1795) Kbr.) Lag e r f a s t l e d e r a r t i g , g r o s s b
l ä t t r i g , einblättrig und bnchtig-gelappt oder vielblättrig, d u n k e l g r a u g r ü n
b i s 's c h w ä r z l i c h g r ü n , n a c k t o d e r s c h w ä r z l i c h k ö r n i g - k l e i i g , u n t e n
d i c h t u n d k u r z w e i s s li c h - f i Iz ig , Lap p en g e r u n d e t , u n g e t h e i l t , zuweilen
dachziegelig. Frü ch te selten, z e r s t r e u t , m i t t e l g r o s s , e r h a b e n
s i t z e n d , mit f l a c h e r , b r a u n r o t h e r b i s s c h w ä r z l i e h e r Scheibe, u n -
Krypt. F lo r a II. 2. 2 4
m m