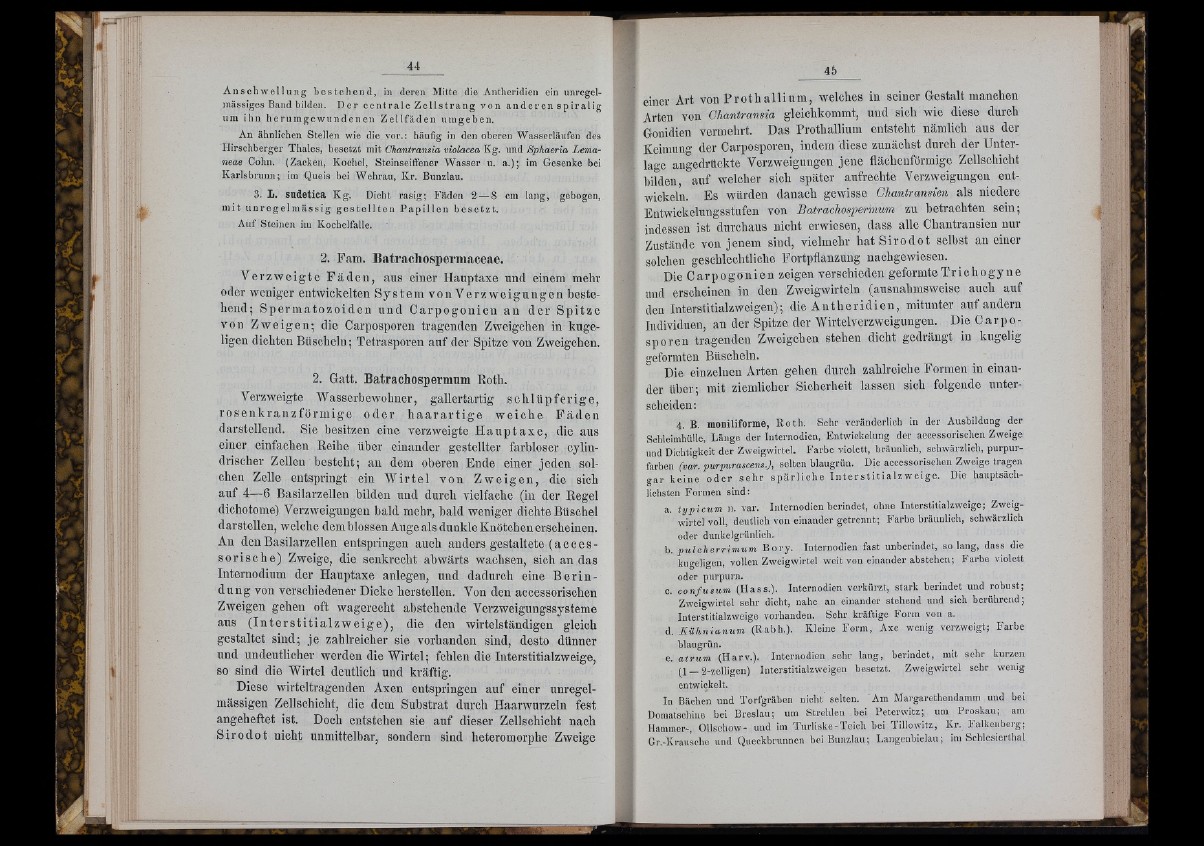
A n s c h w e l l u n g b e s t e h e n d , in deren Mitte die Antheridien ein unregel-
inässiges Band bilden. D e r c e n t r a l e Z e l l s t r a n g v o n a n d e r e n s p i r a l i g
um ih n h e r u m g e w u n d e n e n Z e l l f ä d e n u m g e b e n .
An ähnlichen Stellen wie die vor.: häufig in den oberen W asserläufen des
Hirschberger Tha ie s, b e se tz t mit Chantransia violacea Kg. und Sphaeria Lema-
neae Cohn. (Zacken, Kochel, Steinseiffener W a s s e r u. a .); im Gesenke bei
K a rlsb ru im ; im Queis bei W eh raii, K r. Bunzlau.
3. L. sudetica K g . Dicht ra s ig ; B'äden 2 — 8 cm lan g , gebogen,
m i t u n r e g e lm ä s s i g g e s t e l l t e n P a p i l l e n b e s e t z t .
A u f Steinen im Kochelfalle.
2. Fam. B a trach o sp erm a cea e.
Ve r zw e i g t e F ä d e n , aus einer Hauptaxe nnd einem mehr
oder weniger entwickelten S y s t e m von Ve r zwe i g u n g e n bestehend;
S p e rma t o z o i d e n un d Ca r p o g o n i e n an de r S pi t z e
von Zwei g e n ; die Carposporen tragenden Zweigehen in kugeligen
dichten Büscheln; Tetrasporen auf der Spitze von Zweigehen.
2. Gatt. Batrachospermum Roth.
Verzweigte Wasserhewohner, gallertartig s c h l ü p f e r i g e ,
r o s e n k r a n z f ö rmi g e o d e r h a a r a r t i g e w e i c h e F ä d e n
darstellend. Sie besitzen eine verzweigte Ha u p t a x e , die aus
einer einfachen Reihe über einander gestellter farbloser cylin-
drischer Zellen besteht; an dem oberen Ende einer jeden solchen
Zelle entspringt ein Wi r t e l von Zwe i g e n , die sich
auf 4—6 Basilarzellen bilden und durch vielfache (in der Regel
dichotome) Verzweigungen bald mehr, bald weniger dichte Büschel
darstellen, welche dem blossen Auge als dunkle Knötchen erscheinen.
An den Basilarzellen entspringen auch anders gestaltete (a c c e s sor
i se he) Zweige, die senkrecht abwärts wachsen, sich an das
Internodium der Hauptaxe anlegen, und dadurch eine B e r i n du
ng von verschiedener Dicke hersteilen. Von den accessorischen
Zweigen gehen oft wagerecht abstehende Verzweignngssysteme
aus ( I n t e r s t i t i a l zwe i g e ) , die den wirtelständigen gleich
gestaltet sind; je zahlreicher sie vorhanden sind, desto dünner
und undeutlicher werden die Wirtel; fehlen die Interstitialzweige,
so sind die Wirtel deutlich und kräftig.
Diese wirteltragenden Axen entspringen auf einer unregel-
inässigen Zellschicht, die dem Substrat durch Haarwurzeln fest
angeheftet ist. Doch entstehen sie auf dieser Zellschicht nach
S i ro do t nicht unmittelbar, sondern sind heteromorphe Zweige
einer Art von P r o t h a l l i um, welches in seiner Gestalt manchen
Arten von Ghantransia gleichkommt, und sich wie diese durch
Gonidien vermehrt. Das Prothallium entsteht nämlich aus der
Keimung der Carposporen, indem diese zunächst durch der Unterlage
angedrückte Verzweigungen jene tlächenförmige Zellschicht
bilden, auf welcher sich später aufrechte Verzweigungen entwickeln.
Es würden danach gewisse Ghantransien als niedere
Entwickelungsstufen von Batrachospermum zu betrachten sein;
indessen ist durchaus nicht erwiesen, dass alle Ghantransien nur
Zustände von jenem sind, vielmehr hat S i r od ot selbst an einer
solchen geschlechtliche Fortpflanzung nachgewiesen.
Die C a r p o g o n i e n zeigen verschieden geformte Tr i c h o g y n e
und erscheinen in den Zweigwirteln (ausnahmsweise auch auf
den Interstitialzweigen); die An t h e r i d i e n , mitunter auf ändern
Individuen, an der Spitze der Wirtelverzweigungen. Die C a r p o sporen
tragenden Zweigehen stehen dicht gedrängt in kugelig
geformten Büscheln.
Die einzelnen Arten gehen durch zahlreiche Formen in einander
über; mit ziemlicher Sicherheit lassen sich folgende unterscheiden;
4 . B. moniliforme, R o th . S eh r veränderlich in der Ausbildung der
Schleimhülle, Län g e der Internodien, Entwickelung der accessorischen Zweige
und Dichtigkeit d e r Zweigwirtel. I'a rb e violett, bräunlich, schwärzlich, p u rp u rfarben
( m r . p u r p u r a s e e n s . J , selten blaugrün. Die accessorischen Zweige tragen
g a r k e in e o d e r s e h r s p ä r l i c h e I n t e r s t i t i a l z w e i g e . Die hauptsächlichsten
I'orm en sind:
a. t y p i c u m n. var. Inte rnodien berindet, ohne In te rstitia lzw e ig e; Zweigwirtel
voll, deutlich von e inander g e tren n t; F a rb e bräunlich, schwärzlich
oder dunkelgrünlich.
h . p u l c h e r r i m u m B o r y . Internodien fa st unberindet, s o la n g , dass die
kugeligen, vollen Zweigwirtel weit von einander abstehen; F a rb e violett
oder purpurn.
C. c o n f u s u m (H a s s .) . Inte rn o d ien verkürzt, s ta rk b erindet und ro b u s t;
Zweigwirtel s eh r dicht, nahe an e inander stehend und sich berü h ren d ;
Interstitialzweige vorhanden. Sehr kräftige F o rm von a.
d. K U h n i a n u m (R a b h .) . Kleine F o rm , Axe wenig verzweigt; F a rb e
blaugrün.
e. a t r u m (H a rv .) . Inte rnodien s eh r la n g , b e rin d e t, mit s eh r kurzen
(1 _ 2 -zelligen) Inte rstitia lzw e igen besetzt. Zweigwirtel sehr wenig
entwickelt.
In Bächen und T o rfg räb en nicht selten. Am Margarethendamm und bei
Domatschiue bei B re slau ; um S treh len bei P e te rw itz ; um P ro sk a u ; am
Hammer-, Ollschow- und im T u r lis k e -T e ic h bei Tillow itz , Kr. Fa lkcnbe rg;
Gr.-Krausche und Queckbrunnen bei B u n z lau ; Lan g en b ie lau ; im Schlesierthal