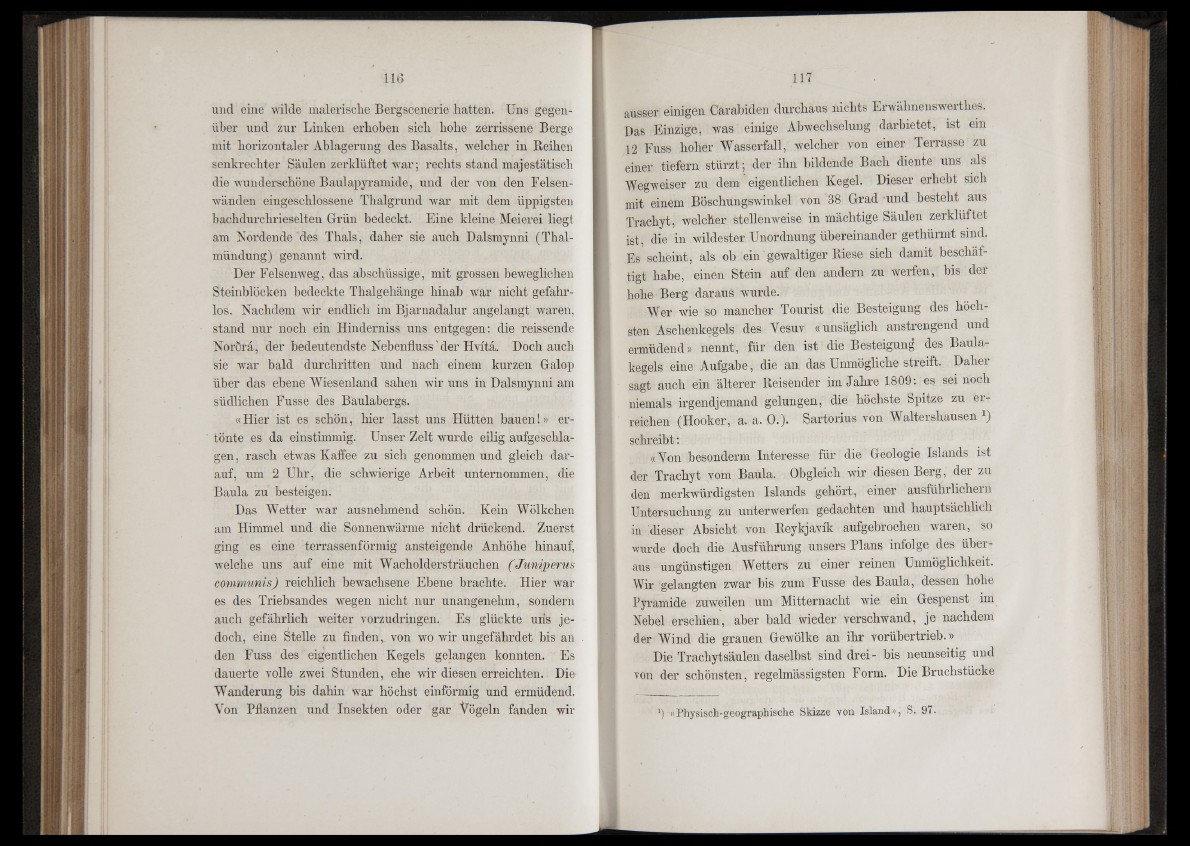
und eine wilde malerische Bergscenerie hatten. Uns gegenüber
und zur Linken erhoben sich hohe zerrissene Berge
mit horizontaler Ablagerung des Basalts, welcher in Reihen
senkrechter Säulen zerklüftet war; rechts stand majestätisch
die wunderschöne Baulapyramide, und der von den Felsenwänden
eingeschlossene Thalgrund war mit dem üppigsten
bachdurchrieselten Grün bedeckt. Eine kleine Meierei liegt
am Nordende des Thals, daher sie auch Dalsmynni (Thalmündung)
genannt wird.
Der Felsenweg, das abschüssige, mit grossen beweglichen
Steinblöcken bedeckte Thalgehänge hinab war nicht gefahrlos.
Nachdem wir endlich im Bjarnadalur angelangt waren,
stand nur noch ein Hinderniss uns entgegen: die reissende
NorÖrä, der bedeutendste Nebenfluss'der Hvita. Doch auch
sie war bald durchritten und nach einem kurzen Galop
über das ebene Wiesenland sahen wir uns in Dalsmynni am
südlichen Fusse des Bäulabergs.
«Hier ist es schön, hier lasst uns Hütten bauen!» ertönte
es da einstimmig. Unser Zelt wurde eilig aufgeschlagen
, rasch etwas Kaffee zu sich genommen und gleich darauf,
um 2 Uhr, die schwierige Arbeit unternommen, die
Baula zu besteigen.
Das Wetter war ausnehmend schön. Kein Wölkchen
am Himmel und die Sonnenwärme nicht drückend. Zuerst
ging es eine terrassenförmig ansteigende Anhöhe hinauf,
welche uns auf eine mit Wacholdersträuchen (Juniperus
communis) reichlich bewachsene Ebene brachte. Hier war
es des Triebsandes wegen nicht nur unangenehm, sondern
auch gefährlich weiter vorzudringen. Es glückte uns jedoch,
eine Stelle zu finden v von wo wir ungefährdet bis an
den Fuss des eigentlichen Kegels gelangen konnten. Es
dauerte volle zwei Stunden, ehe wir diesen erreichten. Die
Wanderung bis dahin war höchst einförmig und ermüdend.
Von Pflanzen und Insekten oder gar Vögeln fanden wir
ausser einigen Carabiden durchaus nichts Erwähnenswerthes.
Das Einzige, was einige Abwechselung darbietet, ist ein
12 Fuss hoher Wasserfall, welcher von einer Terrasse zu
einer tiefern stürzt ; der ihn bildende Bach diente uns als
Wegweiser zu dem eigentlichen Kegel. Dieser erhebt sich
mit einem Böschungswinkel von 38 Grad -und besteht aus
Trachyt, welcher stellenweise in mächtige Säulen zerklüftet
ist, die in wildester Unordnung übereinander gethürmt sind.
Es scheint, als ob ein' gewaltiger Riese sich damit beschäftigt
habe, einen Stein auf den ändern zu werfen, bis der
hohe Berg daraus wurde.
Wer wie so mancher Tourist die Besteigung des höchsten
Aschenkegels des Vesuv «unsäglich anstrengend und
ermüdend» nennt, für den ist die Besteigung des Baulakegels
eine Aufgabe, die an das Unmögliche streift. Daher
sagt auch ein älterer Reisender im Jahre 1809: es sei noch
niemals irgendjemand gelungen, die höchste Spitze zu erreichen
(Hooker, a. a. O.). Sartorius von Waltershausen1)
schreibt |
«Von besonderm Interesse für die Geologie Islands ist
der Trachyt vom Baula. Obgleich wir diesen Berg, der zu
den merkwürdigsten Islands gehört, einer ausführlichem
Untersuchung zu unterwerfen gedachten und hauptsächlich
in dieser Absicht von Reykjavik aufgebrochen waren, so
wurde doch die Ausführung unsers Plans infolge des überaus
ungünstigen Wetters zu einer reinen Unmöglichkeit.
Wir gelangten zwar bis zum Fusse des Baula, dessen hohe
Pyramide zuweilen um Mitternacht wie ein Gespenst im
Nebel erschien, aber bald wieder verschwand, je nachdem
der Wind die grauen Gewölke an ihr vorübertrieb.»
Die Trachytsäulen daselbst sind drei- bis neunseitig und
von der schönsten, regelmässigsten Form. Die Bruchstücke
J) •«Physisch-geographische Skizze von Island», S. 97.