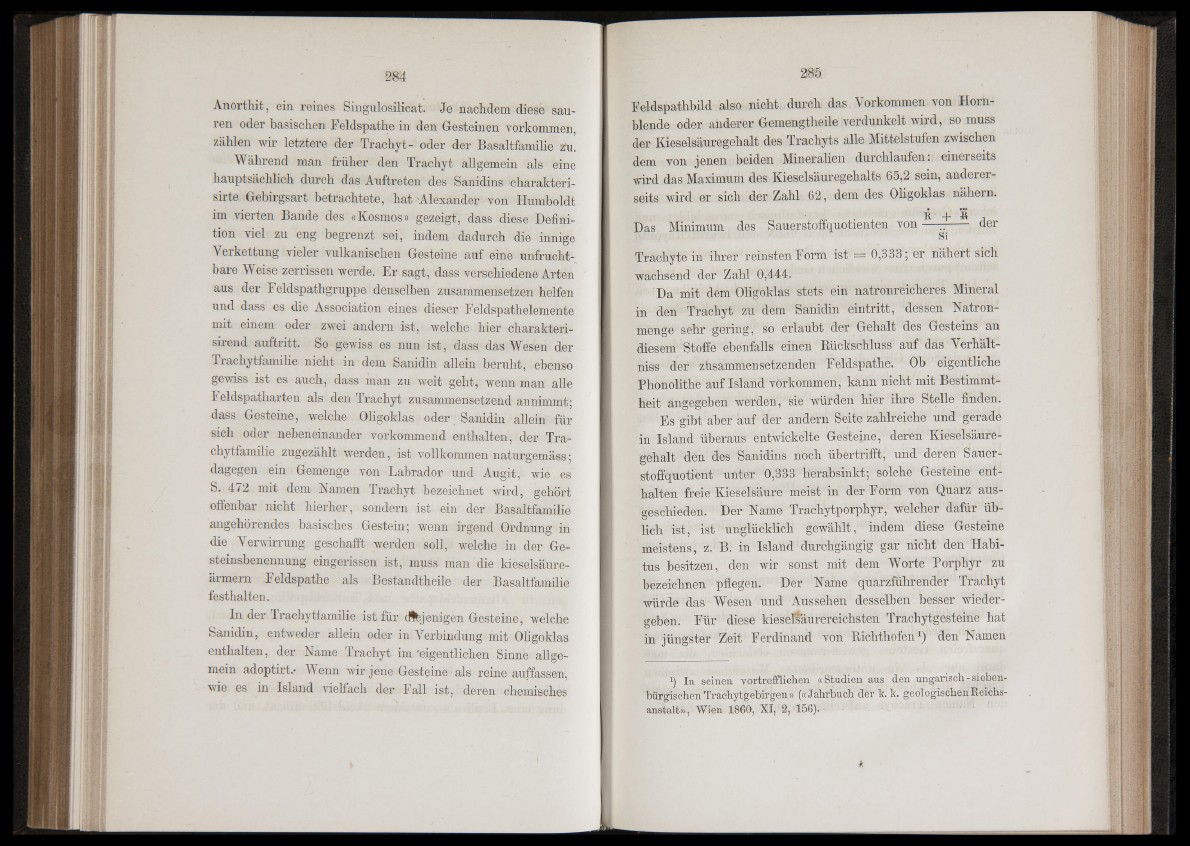
Anorthit, ein reines Singulosilicat. Je nachdem diese sauren
oder basischen Feldspathe in den Gesteinen Vorkommen,
zählen wir letztere der Trachyt- oder der Basaltfamilie 2u.
Während man früher den Trachyt allgemein als eine
hauptsächlich durch das Auftreten des Sanidins charakteri-
sirte Gebirgsart betrachtete, hat Alexander von Humboldt
im vierten Bande des «Kosmos» gezeigt, dass diese Definition
viel zu eng begrenzt sei, indem dadurch die innige
Verkettung vieler vulkanischen Gesteine auf eine unfruchtbare
Weise zerrissen werde. Er sagt, dass verschiedene Arten
aus der Eeldspathgruppe denselben zusammensetzen helfen
und dass es die Association eines dieser Feldspathelemente
mit einem oder zwei ändern ist, welche hier charakteri-
sirend auftritt. So gewiss es nun ist, dass das Wesen der
Trachytfamilie nicht in dem Sanidin allein beruht, ebenso
gewiss ist es auch, dass man zu weit geht, wenn man alle
Feldspätharten als den Trachyt zusammensetzend annimmt;
dass Gesteine, welche Oligoklas oder Sanidin allein für
sich oder nebeneinander vorkommend enthalten, der Tra-
chytfamilie zugezählt werden, ist vollkommen naturgemäss;
dagegen ein Gemenge von Labrador und Augit, wie es
S. 472 mit dem Namen Trachyt bezeichnet wird, gehört
offenbar nicht hierher, sondern ist ein der Basaltfamilie
angehörendes basisches Gestein; wenn irgend Ordnung in
die Verwirrung geschafft werden soll, welche in der Gesteinsbenennung
eingerissen ist, muss man die kieselsäure-
ärmern Feldspathe als Bestandtheile der Basaltfamilie
festhalten.
In der Trachytiamilie ist für diejenigen Gesteine, welche
Sanidin, entweder allein oder in Verbindung mit Oligoklas
enthalten, der Name Trachyt im 'eigentlichen Sinne allgemein
adoptirt.* Wenn wir jene Gesteine -als reine auffassen,
wie es in Island vielfach der Fall ist, deren chemisches
Feldspatbbild also nicht durch das Vorkommen von Hornblende
oder anderer Gemengtheile verdunkelt wird, so muss
der Kieselsäuregehalt des Trachyts alle Mittelstufen zwischen
dem von jenen beiden Mineralien durchlaufen: einerseits
wird das Maximum des Kieselsäuregehalts 65,2 sein, andererseits
wird er sich der Zahl 62, dem des Oligoklas nähern.
•
R ■ -f- -R j Das Minimum des Sauerstoffquotienten von —S i----- der
Trachyte in ihrer reinsten Form ist = 0,333; er nähert sich
wachsend der Zahl 0,444.
Da mit dem Oligoklas stets ein natronreicheres Mineral
in den Trachyt zu dem Sanidin eintritt, dessen Natronmenge
sehr gering, so erlaubt der Gehalt des Gesteins an
diesem Stoffe ebenfalls einen Rückschluss auf das Verhält-
niss der zhsammensetzenden Feldspathe. Ob eigentliche
Phonolithe auf Island Vorkommen, kann nicht mit Bestimmtheit
angegeben werden, sie würden hier ihre Stelle finden.
Es gibt aber auf der ändern Seite zahlreiche und gerade
in Island überaus entwickelte Gesteine, deren Kieselsäuregehalt
den des Sanidins noch übertrifft, und deren Sauerstoffquotient
unter 0,333 herabsinkt; solche Gesteine enthalten
freie Kieselsäure meist in der Form von Quarz ausgeschieden.
Der Name Trachytporphyr, welcher dafür üblich
ist, ist unglücklich gewählt, indem diese Gesteine
meistens, z. B. in Island durchgängig gar nicht den Habitus
besitzen, den wir sonst mit dem Worte Porphyr zu
bezeichnen pflegen. Der Name quarzführender Trachyt
würde das Wesen und Aussehen desselben besser wiedergeben.
Für diese kieselfaurereichsten Trachytgesteine hat
in jüngster Zeit Ferdinand von Richthofen1) den Namen
i) ln. seinen vortrefflichen «Studien aus den ungarisch -sieben-
bürgischen Trachytgebirgen» («Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt
», Wien 1860, XI, 2, 156).