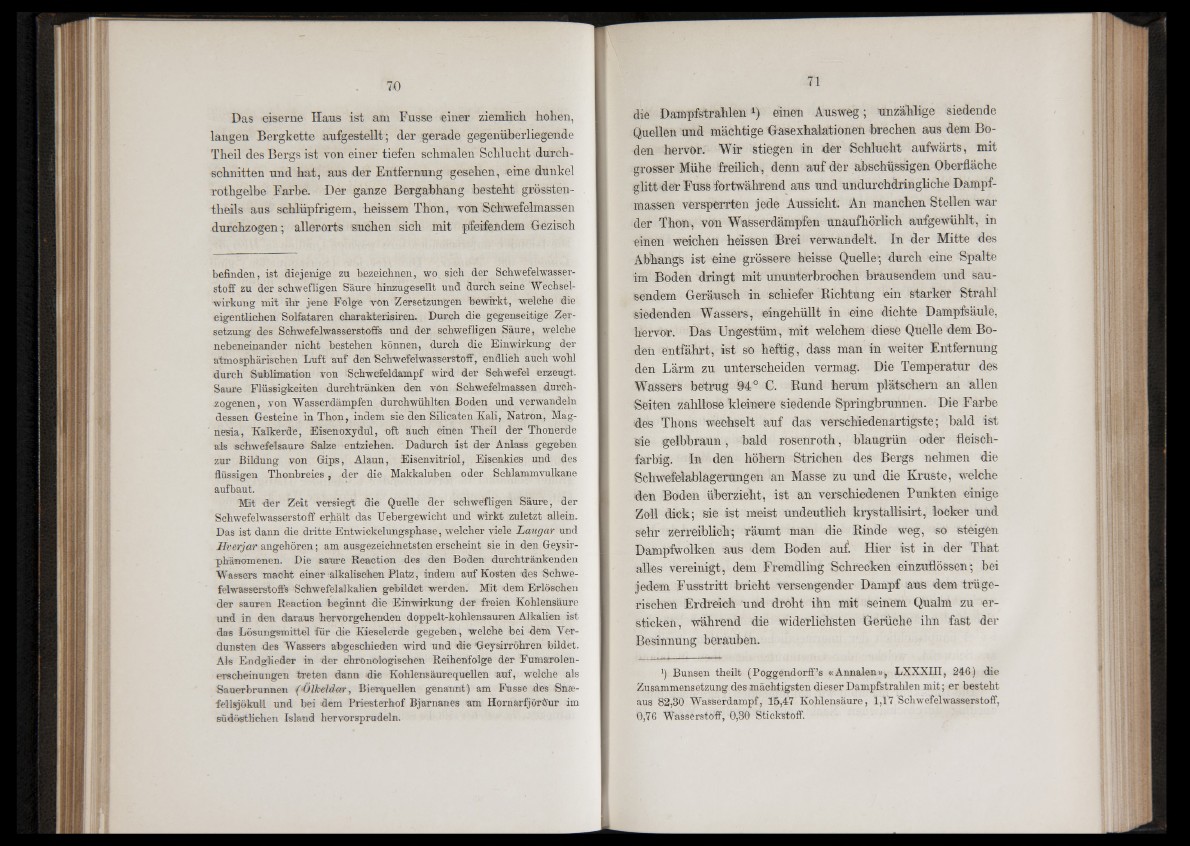
Das eiserne Haus ist am Fusse einer ziemlich hohen,
langen Bergkette aufgestellt; der gerade gegenüberliegende
Theil des Bergs ist von einer tiefen schmalen Schlucht durchschnitten
und hat, aus der Entfernung gesehen, eine dunkel
rothgelbe Farbe. Der ganze Bergabhang besteht grössten-
theils aus schlüpfrigem, heissem Thon, von Schwefelmassen
durchzogen; allerorts suchen sich mit pfeifendem Gezisch
befinden, ist diejenige zu bezeichnen, wo sich der Schwefelwasserstoff
zu der schwefligen Säure hinzugesellt und durch seine Wechselwirkung
mit ihr jene Folge von Zersetzungen bewirkt, welche die
eigentlichen Solfataren charakterisiren. Durch die gegenseitige Zersetzung
des Schwefelwasserstoffs und der schwefligen Säure, welche
nebeneinander nicht bestehen können, durch die Einwirkung der
atmosphärischen Luft auf den Schwefelwasserstoff, endlich auch wohl
durch Sublimation von Schwefeldampf wird der Schwefel erzeugt.
Saure Flüssigkeiten durchtränken den von Schwefelmassen durchzogenen,
.von Wasserdämpfen durchwühlten Boden und verwandeln
dessen Gesteine in Thon, indem sie den Silicaten Kali, Natron, Magnesia,
Kalkerde, Eisenoxydul, oft auch einen Theil der Thonerde
als schwefelsaure Salze entziehen. Dadurch ist der Anlass gegeben
zur Bildung von Gips, Alaun, Eisenvitriol, Eisenkies und des
flüssigen Thonbreies , der die Makkaluben oder Schlammvulkane
aufbaut.
Mit der Zeit versiegt die Quelle der schwefligen Säure, der
Schwefelwasserstoff erhält das Uebergewicht und wirkt zuletzt allein.
Das ist dann die dritte Entwickelungsphase, welcher viele Laugar und
Hver ja r angehören; am ausgezeichnetsten erscheint sie in den Geysir-
phänomenen. Die saure Reaction des den Boden durchtränkenden
Wassers macht einer alkalischen Platz, indem auf Kosten des Schwefelwasserstoffs
SchwefelalkaMen gebildet werden. Mit dem Erlöschen
der sauren Reaction beginnt die Einwirkung der freien Kohlensäure
und in den daraus hervorgehenden doppelt-kohlensauren Alkalien ist
das Lösungsmittel für die Kieselerde gegeben, welche bei dem Verdunsten
des Wassers abgeschieden wird und die Geysirröhren bildet.
Als Endglieder in der chronologischen Reihenfolge der Fumarolen-
erscheinungen treten dann die Kohlensäurequellen auf, welche als
■Sauerbrunnen (Ölkeldar, Bierquellen genannt) am Fusse des Snse-
fellsjökull und bei dem Priesterhof Bjarnanes am HornarfjörÖur im
südöstlichen Island hervorsprudeln.
die Dampfstrahlen1) einen Ausweg; unzählige siedende
Quellen und mächtige Gasexhalationen brechen aus dem Boden
hervor. Wir stiegen in der Schlucht aufwärts, mit
grösser Mühe freilich, denn auf der abschüssigen Oberfläche
glitt der Fuss fortwährend aus und undurchdringliche Dampfmassen
versperrten jede Aussicht. An manchen Stellen war
der Thon, von Wasserdämpfen unaufhörlich aufgewühlt, in
einen weichen heissen Brei verwandelt. In der Mitte des
Abhangs ist eine grössere freisse Quelle; durch eine Spalte
im Boden dringt mit ununterbrochen brausendem und sausendem
Geräusch in schiefer Richtung ein starker Strahl
siedenden Wassers, eingehüllt in eine dichte Dampfsäule,
hervor. Das Ungestüm, mit welchem diese Quelle dem Boden
entfährt, ist so heftig, dass man in weiter Entfernung
den Lärm zu unterscheiden vermag. Die Temperatur des
Wassers betrug 94° C. Rund herum plätschern an allen
Seiten zahllose kleinere siedende Springbrunnen. Die Farbe
des Thons wechselt auf das verschiedenartigste; bald ist
sie gelbbraun, bald rosenroth, blaugrün oder fleischfarbig.
In den hohem Strichen des Bergs nehmen die
Schwefelablägerungen an Masse zu und die Kruste, welche
den Boden überzieht, ist an verschiedenen Punkten einige
Zoll dick; sie ist meist undeutlich krystallisirt, locker und
sehr zerreiblich; räumt man die Rinde weg, so steigen
Dampfwolken aus dem Boden aui. Hier ist in der That
alles vereinigt, dem Fremdling Schrecken einzuflössen; bei
jedem Fusstritt bricht versengender Dampf aus dem trügerischen
Erdreich und droht ihn mit seinem Qualm zu ersticken,
während die widerlichsten Gerüche ihn fast der
Besinnung berauben.
x) Bunsen theilt (Poggendorff’s «Annalen», LXXXIII, 246) die
Zusammensetzung des mächtigsten dieser Dampfstrahlen mit; er besteht
aus 82,30 Wässerdampf, 15,47 Kohlensäure, 1,17 Schwefelwasserstoff,
0,76 Wasserstoff, 0,30 Stickstoff.