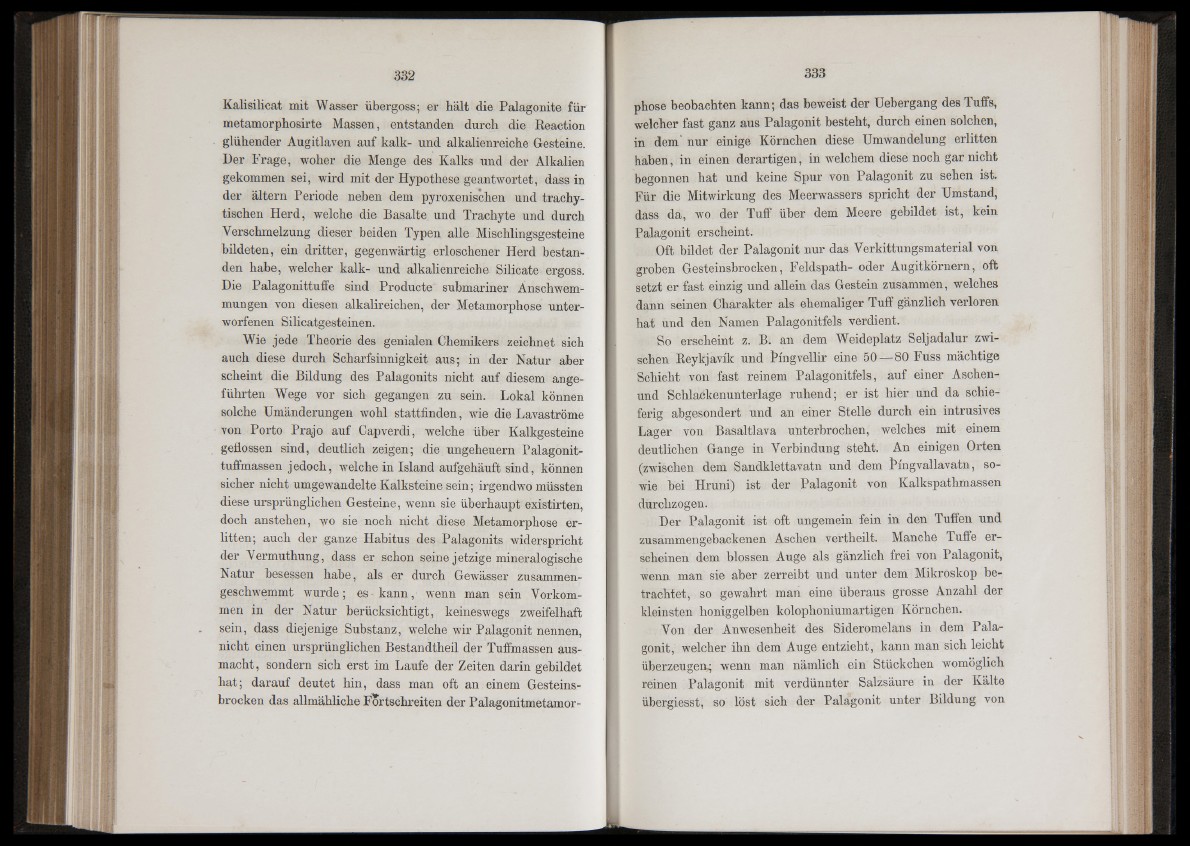
Kalisilicat mit Wasser übergoss; er hält die Palagonite für
metamorphosirte Massen, entstanden durch die Reaction
glühender Augitlaven auf kalk- und alkalienreiche Gesteine.
Der Frage, woher die Menge des Kalks und der Alkalien
gekommen sei, wird mit der Hypothese geantwortet, dass in
der altern Periode neben dem pyroxenischen und trachy-
tischen Herd, welche die Basalte und Trachyte und durch
Verschmelzung dieser beiden Typen alle Mischlingsgesteine
bildeten, ein dritter, gegenwärtig erloschener Herd bestanden
habe, welcher kalk- und alkalienreiche Silicate ergoss.
Die Palagonittuffe sind Producte submariner Anschwemmungen
von diesen alkalireichen, der Metamorphose unterworfenen
Silicatgesteinen.
Wie jede Theorie des genialen Chemikers zeichnet sich
auch diese durch Scharfsinnigkeit aus; in der Natur aber
scheint die Bildung des Palagonits nicht auf diesem angeführten
Wege vor sich gegangen zu sein. Lokal können
solche Umänderungen wohl stattfinden, wie die Lavaströme
von Porto Prajo auf Capverdi, welche über Kalkgesteine
geflossen sind, deutlich zeigen; die Ungeheuern Palagonit-
tuffmassen jedoch, welche in Island aufgehäuft sind, können
sicher nicht umgewandelte Kalksteine sein; irgendwo müssten
diese ursprünglichen Gesteine, wenn sie überhaupt existirten,
doch anstehen, wo sie noch nicht diese Metamorphose erlitten;
auch der ganze Habitus des Palagonits widerspricht
der Vermuthung, dass er schon seine jetzige mineralogische
Natur besessen habe, als er durch Gewässer zusammengeschwemmt
wurde; es-kann, wenn man sein Vorkommen
in der Natur berücksichtigt, keineswegs zweifelhaft
sein, dass diejenige Substanz, welche wir Palagonit nennen,
nicht einen ursprünglichen Bestandtheil der Tuffmassen ausmacht,
sondern sich erst im Laufe der Zeiten darin gebildet
hat; darauf deutet hin, dass man oft an einem Gesteinsbrocken
das allmähliche Fortschreiten der Palagonitmetamorphose
beobachten kann; das beweist der Uebergang des Tuffs,
welcher fast ganz aus Palagonit besteht, durch einen solchen,
in dem nur einige Körnchen diese Umwandelung erlitten
haben, in einen derartigen, in welchem diese noch gar nicht
begonnen hat und keine Spur von Palagonit zu sehen ist.
Für die Mitwirkung des Meerwassers spricht der Umstand,
dass da, wo der Tuff über dem Meere gebildet ist, kein
Palagonit erscheint.
Oft bildet der Palagonit nur das Verkittungsmaterial von
groben Gesteinsbrocken, Feldspath- oder Augitkörnern, oft
setzt er fast einzig und allein das Gestein zusammen, welches
dann seinen Charakter als ehemaliger Tuff gänzlich verloren
hat und den Namen Palagonitfels verdient.
So erscheint z. B. an dem Weideplatz Seljadalur zwischen
Reykjavik und Pingvellir eine 50—80 Fuss mächtige
Schicht von fast reinem Palagonitfels, auf einer Aschen-
und Schlackenunterlage ruhend; er ist hier und da schie-
ferig abgesondert und an einer Stelle durch ein intrusives
Lager von Basältlava unterbrochen, welches mit einem
deutlichen Gange in Verbindung steht An einigen Orten
(zwischen dem Sandklettavatn und dem Pingvallavatn, sowie
bei Hruni) ist der Palagonit von Kalkspathmassen
durchzogen.
Der Palagonit ist oft ungemein fein in den Tuffen und
zusammengebackenen Aschen vertheilt. Manche Tuffe erscheinen
dem blossen Auge als gänzlich frei von Palagonit,
wenn man sie aber zerreibt und unter dem Mikroskop betrachtet,
so gewährt man eine überaus grosse Anzahl der
kleinsten honiggelben kolophoniumartigen Körnchen.
Von der Anwesenheit des Sideromelans in dem Palagonit,
welcher ihn dem Auge entzieht, kann man sich leicht
überzeugen; wenn man nämlich ein Stückchen womöglich
reinen Palagonit mit verdünnter Salzsäure in der Kälte
übergiesst, so löst sich der Palagonit unter Bildung von