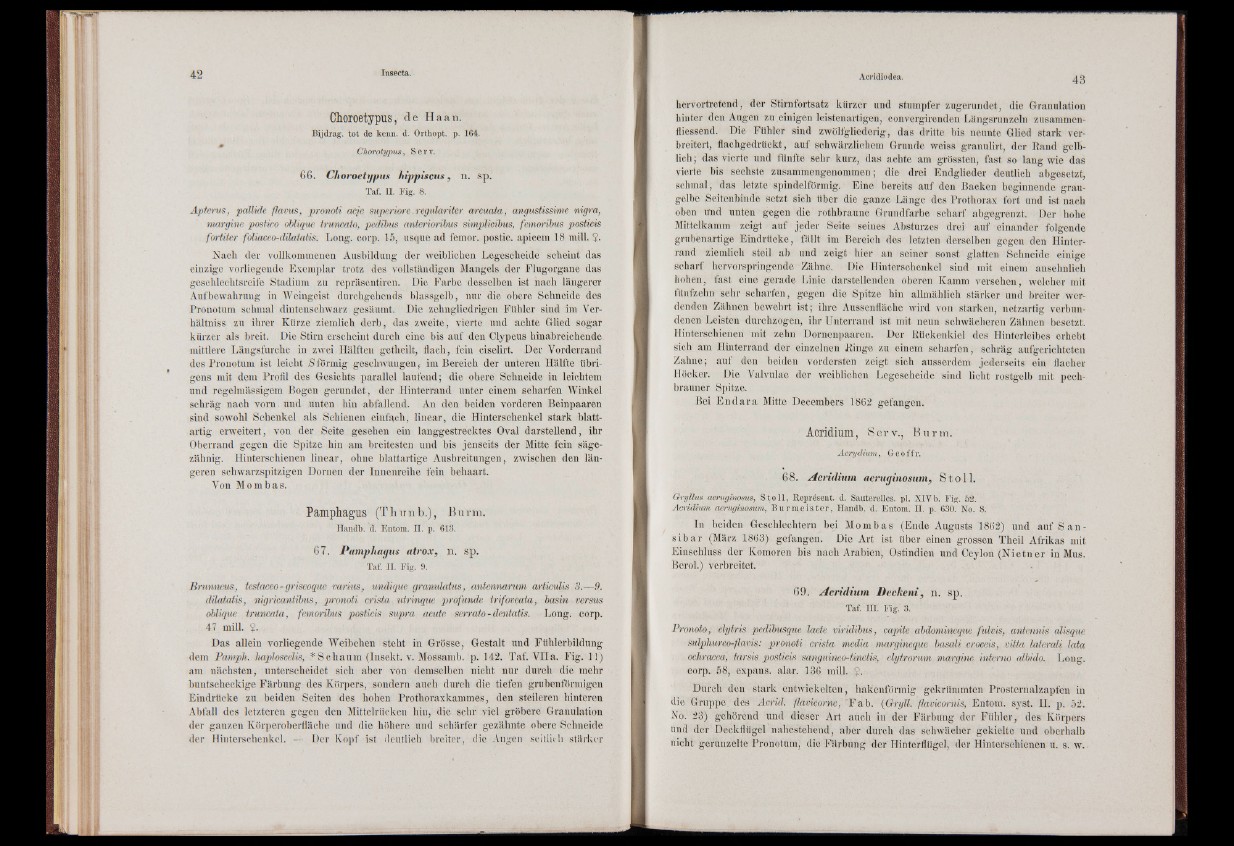
Choroetypus, d e H a a n .
Bijdrag. tot de kenn. d. Orthopt. p. 164.
Chorotyjms, S e r v.
6 6 . Choroetypus hippiscus, n. sp.
Taf. II. Fig. 8.
Apterus, paüide flavus, pronoti acje superiore regulariter aremta, angmtissime nigra,
margine postico oblique truncato, pedibus anterioribus simplicibus, femoribus posticis
fortiter foliaceo-düatatis. Long. corp. 15, usque ad femor. postic. apieem 18 mill. ?.
Nach der vollkommenen Ausbildung der weiblichen Legescheide scheint das
einzige vorliegende Exemplar trotz des vollständigen Mangels der Flugorgane das
gesclilechtsreife Stadium zu repräsentiren. Die Farbe desselben ist hach längerer
Aufbewahrung in Weingeist durckgehends blassgelb, nur die obere Schneide des
Pronotum schmal dintensckwarz gesäumt. Die zehngliedrigen Flihler sind im Ver-
hältniss zu ihrer Kürze ziemlich derb, das zweite, vierte und achte Glied sogar
kürzer als breit. Die Stirn erscheint durch eine bis auf den Clypeus hinabreichende
mittlere Längsfurche in zwei Hälften getheilt, flach, fein ciselirt. Der Vorderrand
des Pronotum ist leicht S förmig geschwungen, im Bereich der unteren Hälfte übrigens
mit dem Profil des Gesichts parallel laufend; die obere Schneide in leichtem
und regelmässigem Bogen gerundet, der Hinterrand unter einem scharfen Winkel
schräg nach vorn und unten hin abfallend. An den beiden vorderen Beinpaaren
sind sowohl Schenkel als Schienen einfach, linear, die Hinterschenkel stark blattartig
erweitert, von der Seite gesehen ein langgestrecktes Oval darstellend, ihr
Oberrand gegen die Spitze hin am breitesten und bis jenseits der Mitte fein säge-
zähnig. Hinterschienen linear, ohne blattartige Ausbreitungen, zwischen den längeren
schwarzspitzigen Dornen der Innenreihe fein behaart.
Von Mombas.
Pamphagus (T h r r n b .) , B u rm .
Haadb. d. Entom. ü . p. 613.
67. Pamphauus atrox, n. sp.
Taf. II. Fig. 9.
Brunnens, testaceo -griseoque varius, undique granulatus, antennarum articulis 3 .-9 .
dilatatis, nigricantibus, pronoti crista utrinque profunde trifoveata, basin versus
oblique truncata, femonbus posticis supra acute serrato-dentatis. Long. corp.
47 mill. $. ,
Das allein vorliegende Weibchen steht in Grösse, Gestalt und Ftthlerbildung
dem Pamph. lmploscelis, *S ch aum (Insekt, v. Mossamb. p. 142. Taf. Vna. Fig. 11)
am nächsten, unterscheidet sieh aber von demselben nicht nur durch die mehr
buntscheckige Färbung des Körpers, sondern auch durch die tiefen grubenförmigen
Eindrücke zu beiden Seiten des hohen Prothoraxkammes, den steileren hinteren
Abfall des letzteren gegen den Mittelrücken hin, die sehr viel gröbere Granulation
der ganzen Körperoberfläche und die höhere und schärfer gezähnte obere Schneide
der Hinterschenkcl. — Der Kopf ist deutlich breiter, die Augen seitlich stärker
hervortretend, der Stirnfortsatz kürzer und stumpfer zugerundet, die Granulation
hinter den Augen zu einigen leisten artigen, convergirenden Längsrunzeln zusammen-
fliessend. Die Fühler sind zwölfgliederig, das dritte bis neunte Glied stark verbreitert,
flachgedrückt, auf schwärzlichem Grunde weiss granulirt, der Band gelblich
; das vierte und fünfte sehr kurz, das achte am grössten, fast so lang wie das
vierte bis sechste zusammengenommen; die drei Endglieder deutlich abgesetzt,
schmal, das letzte spindelförmig. Eine bereits auf den Backen beginnende graugelbe
Seitenbinde setzt sich über die ganze Länge des Prothorax fort und ist nach
oben und unten gegen die rothbraune Grundfarbe scharf abgegrenzt. Der hohe
Mittelkamm zeigt auf jeder Seite seines Absturzes drei auf einander folgende
grubenartige Eindrücke, fällt im Bereich des letzten derselben gegen den Hinterrand
ziemlich steil ab und zeigt hier an seiner sonst glatten Schneide einige
scharf hervorspringende Zähne. Die Hinterschenkel sind mit einem ansehnlich
hohen, fast eine gerade Linie darstellenden oberen Kamm versehen, welcher mit
fünfzehn sehr scharfen, gegen die Spitze hin allmählich stärker und breiter werdenden
Zähnen bewehrt ist; ihre Aussenfläche wird von starken, netzartig verbundenen
Leisten durchzogen, ihr Unterrand ist mit neun schwächeren Zähnen besetzt.
Hinterschienen mit zehn Dornenpaaren. Der Rückenkiel des Hinterleibes erhebt
sich am Hinterrand der einzelnen Ringe zu einem scharfen, schräg aufgerichteten
Zahne; auf den beiden vordersten zeigt sich ausserdem jederseits ein flacher
Höcker. Die Valvulae der weiblichen Legescheide sind licht rostgelb mit pechbrauner
Spitze.
Bei E n d a r a Mitte Decembers 1862 gefangen.
Acridium, S e r v., B it r in.
Acrydium, Geoffr.
6 8 . Acridium aeruyinosum, S t o l l .
Cfryllus aeruginosus, St o l l , Reprdsent. d. Sauterelles. pl. XIVb. Fig. 52.
Acridium. aerugitiosum, B u rme i s t e r , Handb. d. Entom. Dt. p. 630. No. 8.
In beiden Geschlechtern bei M omba s (Ende Augusts 1862) und auf S a n s
ib a r (März 1863) gefangen. Die Art ist über einen grossen Theil Afrikas mit
Einschluss der Komoren bis nach Arabien, Ostindien und Ceylon (N ie tn e r in Mus.
Berol.) verbreitet.
69. Acridium Deckeni, n. sp.
Taf. III. Fig. 3.
Pronoto, elytris pedibusque laete viridibus, capite abdmnincqtie fulvis, antennis edisque
sulphureo-flams: pronoti crista media margineque basali croceis, vitta laterali lata
ochracea, tarsis posticis sanguineo-tinctis, clytrorum margim interna albido. Long.
eorp. 58, expans. alar. 136 mill. $.
Durch den stark entwickelten, hakenförmig gekrümmten Prosternalzapfen in
die Gruppe des Acrid. flavicorne, "Fab. (G-rytt. flavicornis, Entom. syst. II. p. 52.
No. 23) gehörend und dieser Art auch in der Färbung der Fühler, des Körpers
und der Deckfiügel nahestehend, aber durch das schwächer gekielte und oberhalb
nicht gerunzelte Pronotum, die Färbung der Hinterflügel, der Hinterscliienen u. s. w.