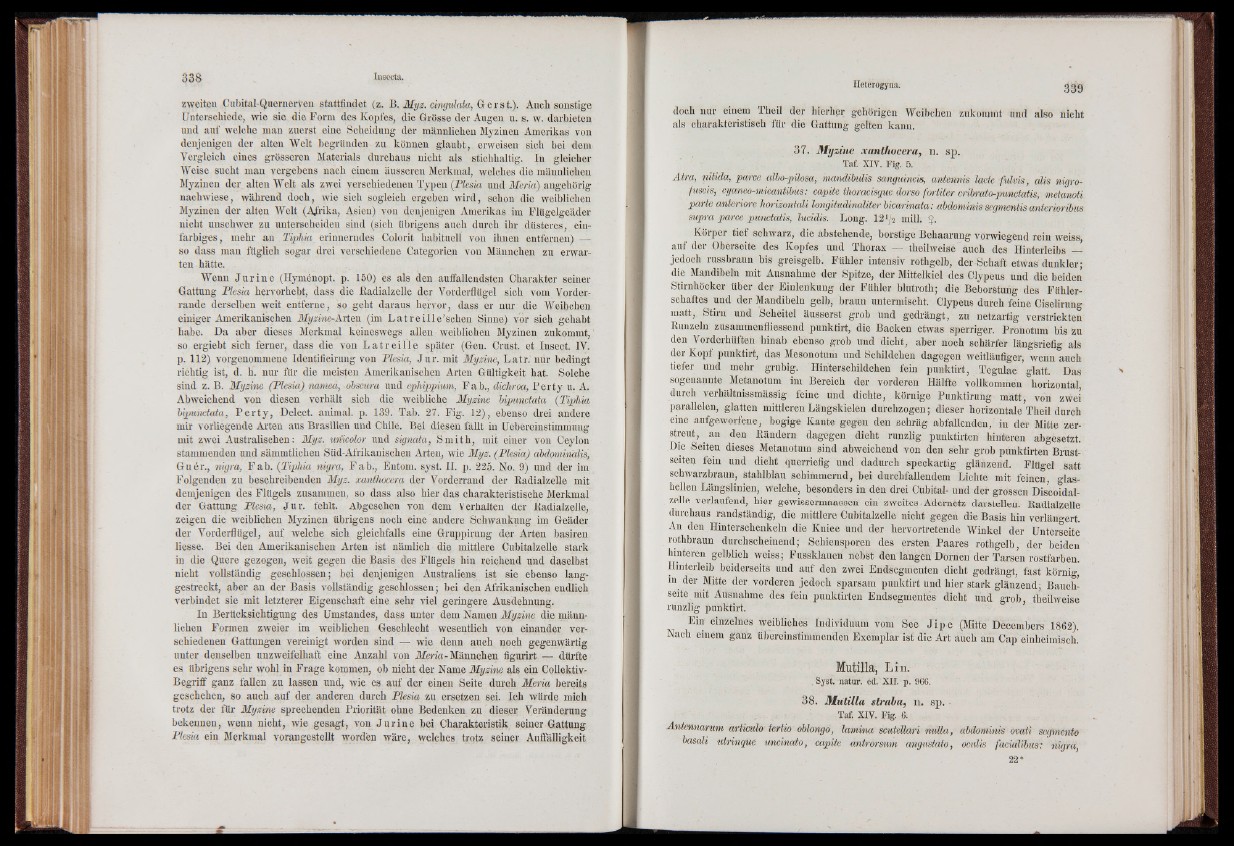
zweiten Cubital-Quernerven stattfindet (z. B. Mys. cingulata, G e r st.). Auch sonstige
Unterschiede, wie sie die Form des Kopfes, die Grösse der Augen u. s. w. darbieten
und auf welche man zuerst eine Scheidung der männlichen Myzinen Amerikas von
denjenigen der alten Welt begründen zu können glaubt, erweisen sich bei dem
Vergleich eines grösseren Materials durchaus nicht als stichhaltig. In gleicher
Weise sucht man vergebens nach einem äusseren Merkmal, welches die männlichen
Myzinen der alten Welt als zwei verschiedenen Typen (Plesia und Meria) angehörig
nachwiese, während doch, wie sich sogleich ergeben wird, schon die weiblichen
Myzinen der alten Welt (Afrika, Asien) von denjenigen Amerikas im Flügelgeäder
nicht unschwer zu unterscheiden sind (sich übrigens auch durch ihr düsteres, einfarbiges,
mehr an Tiphia erinnerndes Colorit habituell von ihnen entfernen) —
so dass man füglich sogar drei verschiedene Categorien von Männchen zu erwarten
hätte.
Wenn J u r in e (Hymenopt. p. 150) es als den auffallendsten Charakter seiner
Gattung Plesia hervorhebt, dass die ßadialzelle der Vorderflügel sich vom Vorderrande
derselben weit entferne, so geht daraus hervor, dass er nur die Weibchen
einiger Amerikanischen Mysine-Arten (im L a t r e i l l e ’schen Sinne) vor sich gehabt
habe. Da aber dieses Merkmal keineswegs allen weiblichen Myzinen zukommt,
so ergiebt sich ferner, dass die von L a t r e i l l e später (Gen. Crust. et Insect. IV.
p. 112) vorgenommene Identificirung von Plesia, Jur . mit Mysine, Lat r. nur bedingt
richtig ist, d. h. nur für die meisten Amerikanischen Arten Gültigkeit hat. Solche
sind z. B. Mysine (Plesia) namea, obscura und ephippium, Fab., dichroa, Per ty u. A.
Abweichend von diesen verhält sich die weibliche Mysine bipunctata (Tiphia
bipunctata, P e r t y , Delect. animal, p. 139. Tab. 27. Fig. 12), ebenso drei andere
mir vorliegende Arten aus Brasilien und Chile. Bei diesen fällt in Uebereinstimmung
mit zwei Australischen: Mys. uriicölor und signata, Smi th, mit einer von Ceylon
stammenden und sämmtlichen Süd-Afrikanischen Arten, wie Mys. (Plesia) abdominalis,
Guer., nigra, Fab. (Tiphia nigra, Fab., Entom. syst. II. p. 22.5. No. 9) und der im
Folgenden zu beschreibenden Mys. xanthocera der Vorderrand der Radialzelle mit
demjenigen des Flügels zusammen, so dass also hier das charakteristische Merkmal
der Gattung Plesia, Jur . fehlt. Abgesehen von dem Verhalten der Radialzelle,
zeigen die weiblichen Myzinen übrigens noch eine andere Schwankung im Geäder
der Vorderflügel, auf welche sich gleichfalls eine Gruppirung der Arten basiren
liesse. Bei den Amerikanischen Arten ist nämlich die mittlere Cubitalzelle stark
in die Quere gezogen, weit gegen die Basis des Flügels hin reichend und daselbst
nicht vollständig geschlossen; bei denjenigen Australiens ist sie ebenso langgestreckt,
aber an der Basis vollständig geschlossen; bei den Afrikanischen endlich
verbindet sie mit letzterer Eigenschaft eine sehr viel geringere Ausdehnung.
In Berücksichtigung des Umstandes, dass unter dem Namen Mysine die männlichen
Formen zweier im weiblichen Geschlecht wesentlich von einander verschiedenen
Gattungen vereinigt worden sind — wie denn auch noch gegenwärtig
unter denselben unzweifelhaft eine Anzahl von Meria- Männchen figurirt. — dürfte
es übrigens sehr wohl in Frage kommen, ob nicht der Name Mysine als ein Collektiv-
Begriff ganz fallen zu lassen und, wie es auf der einen Seite durch Meria bereits
geschehen, so auch auf der anderen durch Plesia zu ersetzen sei. Ich würde mich
trotz der für Mysine sprechenden Priorität ohne Bedenken zu dieser Veränderung
bekennen, wenn nicht, wie gesagt, von J u r i n e bei Charakteristik seiner Gattung
Plesia ein Merkmal vorangestellt worden wäre, welches trotz seiner Auffälligkeit
doch nur einem Theil der hierher gehörigen Weibchen zukommt und also nicht
als charakteristisch für die Gattung gelten kann.
37. Myzine xanthocera, n. sp.
Taf. XIV. Fig. 5.
Atra, nitida, parce albo-pilosa, mandibulis sanguinem, antennis laete futvis, alis nigro-
fuscis, cyamo-mieantibus: capite thoraeisgue dorso fortiter cribrato-pwnctatis, metanoti
parte anteriore hori'sontali longitudinaliter bicarinata: dbdommis segmenbis mterioribus
supra parce punetatis, lucidis. Long. 12 mill. J.
Köipci tief schwarz, die abstehende, borstige Behaarung vorwiegend rein weiss
auf der Oberseite des Kopfes und Thorax — theilweise auch des Hinterleibs —
jedoch russbraun bis greisgelb. Fühler intensiv rothgelb, der Schaft etwas dunkler;
die Mandibeln mit Ausnahme der Spitze, der Mittelkiel des Clypeus und die beiden
Stirnhöcker über der Einlenkung der Fühler blutroth; die Beborstung des Fühlerschaftes
und der Mandibeln gelb, braun untermischt. Clypeus durch feine Ciselirung
matt, Stiin und Scheitel äusserst grob und gedrängt, zu netzartig verstrickten
Runzeln zusammenfliessend punktirt, die Backen etwas sperriger. Pronotum bis Zu
den Vorderhüften hinab ebenso grob und dicht, aber noch schärfer längsriefig als
der Kopf punktirt, das Mesonotum und Schildchen dagegen weitläufiger, wenn auch
tiefer und mehr grubig. Hintersehildchen fein punktirt, Tegulae glatt. Das '
sogenannte Metänotum im Bereich der vorderen Hälfte vollkommen horizontal
durch verhältnissmässig feine und dichte, körnige Punktirung matt, von zwei
parallelen, glatten mittleren Längskielen durchzogen; dieser horizontale Theil durch
eine aufgeworfene, bogige Kante gegen den schräg abfallenden, in der Mitte zerstreut,
an den Rändern dagegen dicht runzlig punktirten hinteren abgesetzt.
Die Seiten dieses Metänotum sind abweichend von den sehr grob punktirten Brustsehen
fein und dicht querriefig und dadurch speckartig glänzend. Flügel satt
schwarzbraun, stahlblau schimmernd, bei dur.chfallendem Lichte mit feinen, glashellen
Längslinien, welche, besonders in den drei Cubital- und der grossen Discoidal-
zelle verlaufend, hier gewissermaassen ein zweites. Adernetz darstellen. Radialzelle
durchaus randständig, die mittlere Cubitalzelle nicht gegen die Basis hin verlängert.
An den Hinterschenkeln die Kniee und der hervortretende Winkel der Unterseite
rqthbraun durchscheinend; Schiensporen des ersten Paares rothgelb, der beiden
hinteren gelblich weiss; Fussklauen nebst den langen Dornen der Tarsen rostfarben.
Hinterleib beiderseits und auf den zwei Endsegmenten dicht gedrängt, fast körnig,
in der Mitte der vorderen jedoch sparsam punktirt und hier stark glänzend; Bauchseite
mit Ausnahme des fein punktirten Endsegmentes dicht und grob, theilweise
runzlig punktirt.
Ein einzelnes weibliches Individuum vom See J i p e (Mitte Decembers 1862).
Nach einem ganz übereinstimmenden Exemplar ist die Art auch am Cap einheimisch.
Mutilla, Lin.
, Syst. natur. ed. XII. p. 966.
38. Mütilla straba, n. sp. •
Taf. XIV. Fig. 6.
Antenna/rum articulo tertio öblongo, lamma scuteUa/ri mdla, abdominis ovati segmento
basali ubringm uncinato, capite antrorsum angustato, oculis faeiedibus: nigra,
22 *