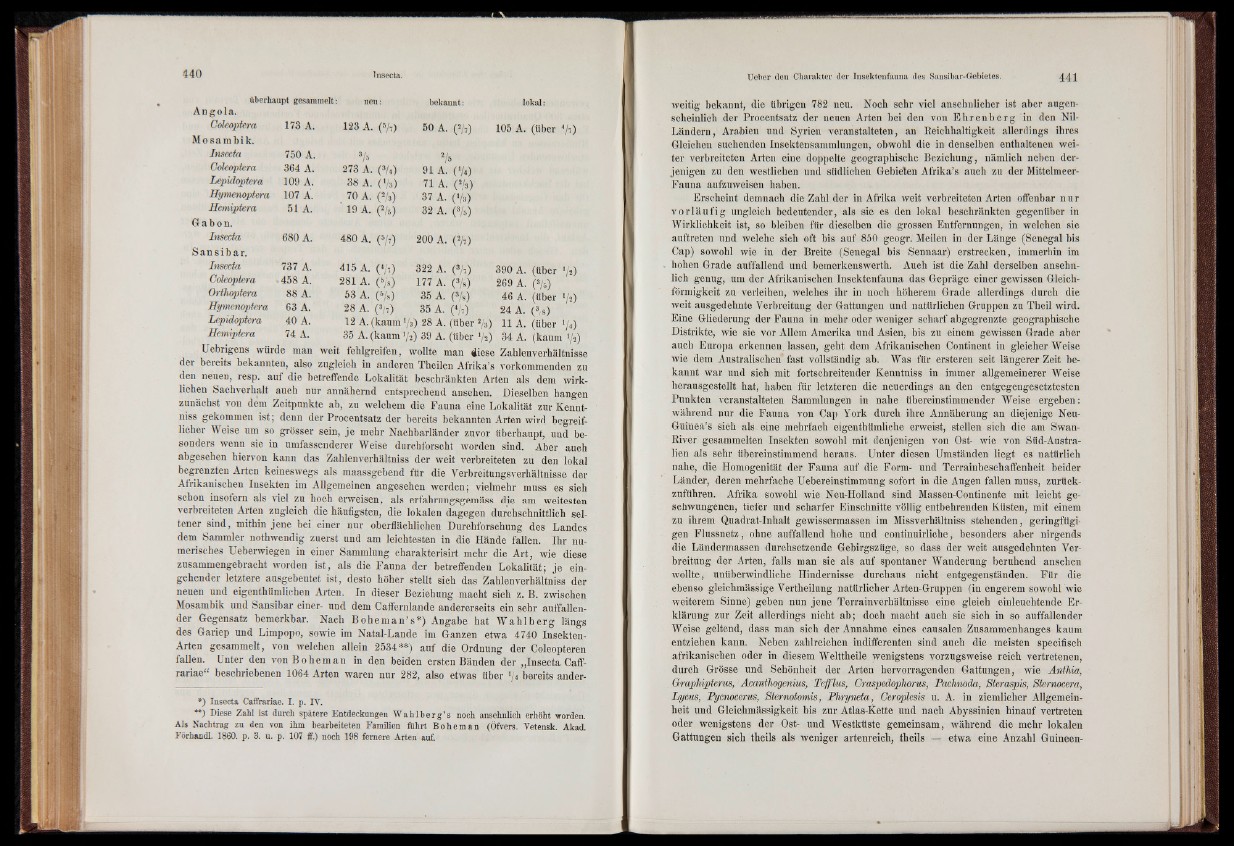
überhaupt gesammelt: neu: bekannt: lokal:
Angola.
Coleóptera 173 A. 123 A. .$/,) 50 A. (2/7) 105 A. (über </7)
Mosambi k .
Insecta 750 A. s/5 2/5
Coleóptera 364 A. 273 A. (*/«) 91 A. (»/«)
Lepidoptera 109 A. 38 A. ('/s) 71 A. (2/s)
Hymenoptera 107 Á. 70 A. (J/3) 37 A. (>/3)
Hemiptera 51 A. ' 19 A. (2/6) 32 A. (s/5)
Gabon.
Inseda 680 A. 480 A. (5/i) 200 A. (2/7)
Sans iba r .
Insecta 737 A. 415 A. («/,) 322 A. («/,) 390 A. (über
Coleóptera .458 A. 281 A. («/s) 177 A. (3/8) 269 A. (s/6)
Orthoptera 88 A. 53 A. Ä 35 A. (s/8) 46 A. (über l/2)
Hymenoptera 63 A. 28 A. (s/7) 35 A. (4/7) 24 A. (3,s)
Lepidoptera 40 A. 12 A. (kaum >/s) 28 A. (Uber 2/3) 11 A. (über »/«)
Hemiptera 74 A. 35 A. (kaum ‘/2) 39 A. (über V/i 34 A. (kaum V»)
Uebrigens würde man weit fehlgreifen, wollte man diese Zahlenverhältnisse
dei bereits bekannten, also zugleich in anderen Theilen Afrika’s vorkommenden zu
den neuen, resp. aut die betreffende Lokalität beschränkten Arten als dem wirklichen
Sachverhalt auch nur annähernd entsprechend ansehen. Dieselben hangen
zunächst von dem Zeitpunkte ab, zu welchem die Fauna eine Lokalität zur Kennt-
niss gekommen ist; denn der Procentsatz der bereits bekannten Arten wird begreiflicher
Weise um so grösser sein, je mehr Nachbarländer zuvor überhaupt, und besonders
wenn sie in umfassenderer Weise durchforscht worden sind. Aber auch
abgesehen hiervon kann das Zahlenverhältniss der weit verbreiteten zu den lokal
begrenzten Arten keineswegs als maassgebend für die VerbreitungsVerhältnisse der
Afrikanischen Insekten im Allgemeinen angesehen werden; vielmehr muss es sich
schon insofern als viel zu hoch erweisen, als erfahrungsgemäss die am weitesten
verbreiteten Arten zugleich die häufigsten, die lokalen dagegen durchschnittlich seltener
sind, mithin jene bei einer nur oberflächlichen Durchforschung des Landes
dem Sammler nothwendig zuerst und am leichtesten in die Hände fallen. Ihr numerisches
Ueberwiegen in einer Sammlung charakterisirt mehr die Art, wie diese
znsammengebracht worden ist, als die Fauna der betreffenden Lokalität; je eingehender
letztere ausgebentet ist, desto höher stellt sich das Zahlenverhältniss der
neuen und eigenthümlichen Arten. In dieser Beziehung macht sich z. B. zwischen
Mosambik und Sansibar einer- und dem Caffernlande andererseits ein sehr auffallender
Gegensatz bemerkbar. Nach Bo h ema n ’s*) Angabe hat Wa h lb e r g längs
des Gariep und Limpopo, sowie im Natal-Lande im Ganzen etwa 4740 Insekten-
Arten gesammelt, von welchen allein 2534**) auf die Ordnung der Coleopteren
fallen. Unter den von Bo hem an in den beiden ersten Bänden der „Insecta Caflf-
rariae“ beschriebenen 1064 Arten waren nur 282, also etwas über */4 bereits ander*)
Insecta Caffrariae. f. p. IY.
**) Diese Zahl ist durch spätere Entdeckungen Wa h l b e r g ’s noch ansehnlich erhöht worden.
Als Nachtrag zu den von ihm bearbeiteten Familien führt B o h ema n (Öfvers. Yetensk. Akad.
Förhandl. 1860. p. 3. u. p. 107 ff.) noch 198 fernere Arten auf.
weitig bekannt, die übrigen 782 neu. Noch sehr viel ansehnlicher ist aber augenscheinlich
der Proeentsatz der neuen Arten bei den von E h r e n b e r g in den Nil-
Ländern, Arabien und Syrien veranstalteten, an Reichhaltigkeit allerdings ihres
Gleichen suchenden Insektensammlungen, obwohl die in denselben enthaltenen weiter
verbreiteten Arten eine doppelte geographische Beziehung, nämlich neben derjenigen
zu den westlichen und südlichen Gebiefen Afrika’s auch zu der Mittelmeer-
Fauna aufzuweisen haben.
Erscheint demnach die Zahl der in Afrika weit verbreiteten Arten offenbar n u r
vor läuf ig ungleich bedeutender, als sie es den lokal beschränkten gegenüber in
Wirklichkeit ist, so bleiben für dieselben die grossen Entfernungen, in welchen sie
auftreten und welche sich oft bis auf 850 geogr. Meilen in der Länge (Senegal bis
Cap) sowohl wie in der Breite (Senegal bis Sennaar) erstrecken, immerhin im
hohen Grade auffallend und bemerkenswerth. Auch ist die Zahl derselben ansehnlich
genug, um der Afrikanischen Insektenfauna das Gepräge einer gewissen Gleichförmigkeit
zu verleihen, welches ihr in noch höherem Grade allerdings durch die
weit ausgedehnte Verbreitung der Gattungen und natürlichen Gruppen zu Theil wird.
Eine Gliederung der Fauna in mehr oder weniger scharf abgegrenzte geographische
Distrikte, wie sie vor Allem Amerika und Asien, bis zu einem gewissen Grade aber
auch Europa erkennen lassen, geht dem Afrikanischen Continent in gleicher Weise
wie dem Australischen fast vollständig ab. Was für ersteren seit längerer Zeit bekannt
war und sich mit fortschreitender Kenntniss in immer allgemeinerer Weise
herausgestellt hat, haben für letzteren die neuerdings an den entgegengesetztesten
Punkten veranstalteten Sammlungen in nahe übereinstimmender Weise ergeben:
während nur die Fauna von Cap York durch ihre Annäherung an diejenige Neu-
Guinea’s sich als eine mehrfach eigentümliche erweist, stellen sieh die am Swan-
River gesammelten Insekten sowohl mit denjenigen von Ost- wie von Siid-Austra-
lien als sehr übereinstimmend heraus. Unter diesen Umständen liegt es natürlich
nahe, die Homogenität der Fauna auf die Form- und Terrainbeschaffenheit beider
Länder, deren mehrfache Uebereinstimmung sofort in die Augen fallen muss, zurückzuführen.
Afrika sowohl wie Neu-Holland sind Massen-Continente mit leicht geschwungenen,
tiefer und scharfer Einschnitte völlig entbehrenden Küsten, mit einem
zu ihrem Quadrat-Inhalt gewissermassen im Missverhältniss stehenden, geringfügigen
Flussnetz, ohne auffallend hohe und continuirliehe, besonders aber nirgends
die Ländermassen durchsetzende Gebirgszüge, so dass der weit ausgedehnten Verbreitung
der Arten, falls man sie als auf spontaner Wanderung beruhend ansehen
wollte, unüberwindliche Hindernisse durchaus nicht entgegenständen. Für die
ebenso gleichmässige Vertheilung natürlicher Arten-Gruppen (in engerem sowohl wie
weiterem Sinne) geben nun jene Terrainverhältnisse eine gleich einleuchtende Erklärung
zur Zeit allerdings nicht ab; doch macht auch sie sich in so auffallender
Weise geltend, dass man sich der Annahme eines causalen Zusammenhanges kaum
entziehen kann. Neben zahlreichen indifferenten sind auch die meisten specifisch
afrikanischen oder in diesem Welttheile wenigstens vorzugsweise reich vertretenen,
durch Grösse und Schönheit der Arten hervorragenden Gattungen, wie Anthia,
Graphipterus, Accmthogenius, Teffl/us, Graspedophorus, Pachnoda, Steraspis, Sternocera,
Lycus, Pycnocerus, Sternotomis, Phryneta, Ceroplesis u. A. in ziemlicher Allgemeinheit
und Gleichmässigkeit bis zur Atlas-Kette und nach Abyssinien hinauf vertreten
oder wenigstens der Ost und Westküste gemeinsam, während die mehr lokalen
Gattungen sich theils als weniger artenreich, theils — etwa eine Anzahl Guineen