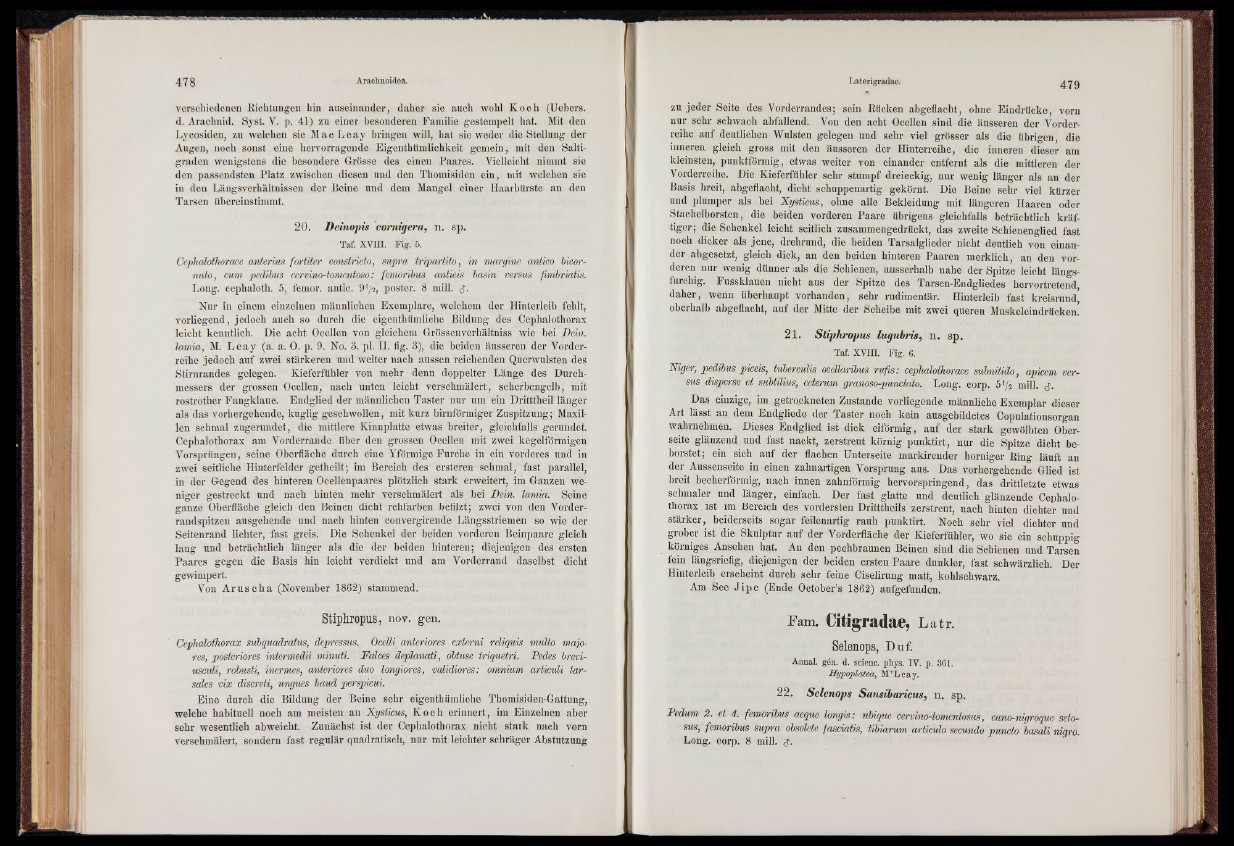
verschiedenen Richtungen hin auseinander, daher sie auch wohl K och (Uebers.
d. Arachnid. Syst. V. p. 41) zu einer besonderen Familie gestempelt hat. Mit den
Lycosiden, zu welchen sie Mac L e a y bringen will, hat sie weder die Stellung der
Augen, noch sonst eine hervorragende Eigentümlichkeit gemein, mit den Saltigraden
wenigstens die besondere Grösse des einen Paares. Vielleicht nimmt sie
den passendsten Platz zwischen diesen und den Thomisiden ein, mit welchen sie
in den Längsverhältnissen der Beine und dem Mangel einer Haarbürste an den
Tarsen übereinstimmt.
20. Deinopis comigera, n. sp.
Taf. XVHI. Fig, 5.
Cephcdothorace anterius fortiier constricto, supra tripartito, in margine antico bicor-
nuto, cum pedibus cervino-tomentoso: femoribus aniicis basin versus fmbriatis.
Long. cephaloth. 5, femor. antic. 9'/2, poster. 8 mill. ¿.
Nur in einem einzelnen männlichen Exemplare, welchem der Hinterleib fehlt,
vorliegend, jedoch auch so durch die eigenthümliche Bildung des Cephalothorax
leicht kenntlich. Die acht Ocellen von gleichem Grössenverhältniss wie bei Dein,
lamia, M. L e a y (a. a. 0. p. 9. No. 3. pl. II. fig. 3), die beiden äusseren der Vorderreihe
jedoch auf zwei stärkeren und weiter nach aussen reichenden Querwulsten des
Stirnrandes gelegen. Kieferfühler von mehr denn doppelter Länge des Durchmessers
der grossen Ocellen, nach unten leicht verschmälert, scherbengelb, mit
rostrother Fangklaue. Endglied der männlichen Taster nur um ein Dritttheil länger
als das vorhergehende, kuglig geschwollen, mit kurz bimförmiger Zuspitzung; Maxillen
schmal zugerundet, die mittlere Kinnplatte etwas breiter, gleichfalls gerundet.
Cephalothorax am Vorderrande über den grossen Ocellen mit zwei kegelförmigen
Vorsprüngen, seine Oberfläche durch eine Yförmige Furche in ein vorderes und in
zwei seitliche Hinterfelder getheilt; im Bereich des ersteren schmal, fast parallel,
in der Gegend des hinteren Ocellenpaares plötzlich stark erweitert, im Ganzen weniger
gestreckt und nach hinten mehr verschmälert als bei Dein, lamia. Seine
ganze Oberfläche gleich den Beinen dicht rehfarben befilzt; zwei von den Vorderrandspitzen
ausgehende und nach hinten convergirende Längsstriemen so wie der
Seitenrand lichter, fast greis. Die Schenkel der beiden vorderen Beinpaare gleich
lang und beträchtlich länger als die der beiden hinteren; diejenigen des ersten
Paares gegen die Basis hin leicht verdickt und am Vorderrand daselbst dicht
gewimpert.
Von A ru s c h a (November 1862) stammend.
Stiphropus, nov. gen.
Cephalothorax subquadratus, depressus. OceUi anteriores externi reliqms multo majo-
res, posteriores intermedii minuti. Falces deplanati, obtuse triquetri. Pedes brevi-
usctdi, robusti, inermes, anteriores duo longiores, validiores: omniim articuli ta/r-
sales mx discreti, wngues haud perspicui.
Eine durch die Bildung der Beine sehr eigenthümliche Thomisiden-Gattung,
welche habituell noch am meisten an Xysticus, K o ch erinnert, im Einzelnen aber
sehr wesentlich abweicht. Zunächst ist der Cephalothorax nicht stark nach vorn
verschmälert, sondern fast regulär quadratisch, nur mit leichter schräger Abstutzung
zu jeder Seite des Vorderrandes; sein Rücken abgeflacht, ohne Eindrücke, vorn
nur sehr schwach abfallend. Von den acht Ocellen sind die äusseren der Vorderreihe
auf deutlichen Wülsten gelegen und sehr viel grösser als die übrigen, die
inneren gleich gross mit den äusseren der Hinterreihe, die inneren dieser am
kleinsten, punktförmig, etwas weiter von einander entfernt als die mittleren der
Vorderreihe. Die Kieferfühler sehr stumpf dreieckig, nur wenig länger als an der
Basis breit, abgeflacht, dicht schuppenartig gekörnt. Die Beine sehr viel kürzer
und plumper als bei Xysticus, ohne alle Bekleidung mit längeren Haaren oder
Stachelborsten, die beiden vorderen Paare übrigens gleichfalls beträchtlich kräftiger;
die Schenkel leicht seitlich zusammengedrückt, das zweite Schienenglied fast
noch dicker als jene, drehrund, die beiden Tarsalglieder nicht deutlich von einander
abgesetzt, gleich dick, an den beiden hinteren Paaren merklich, an den vorderen
nur wenig dünner ials die Schienen, ausserhalb nahe der Spitze leicht längsfurchig.
Fussklauen nicht aus der Spitze des Tarsen-Endgliedes hervortretend,
daher, wenn überhaupt vorhanden, sehr rudimentär. Hinterleib fast kreisrund
oberhalb abgeflacht, auf der Mitte der Scheibe mit zwei queren Muskeleindrücken!
21. Stiphropus lugubris, n. sp.
Taf. XVm. Fig. 6.
Niger, pedibus piceis, tuberculis ocellaribus rufis: cephalothorace subnitido, apicem versus
disperse et subtüius, ceterum granoso-punctato. Long. corp. 5'/2 mill. j .
Das einzige, im getro.ckneten Zustande vorliegende männliche Exemplar dieser
Art lässt an dem Endgliede der Taster noch kein ausgebildetes Copulationsorgan
wahrnehmen. Dieses Endglied ist dick eiförmig, auf der stark gewölbten Oberseite
glänzend und fast nackt, zerstreut körnig punktirt, nur die Spitze dicht be-
borstet; ein sich auf der flachen Unterseite markirender horniger Ring läuft an
der Aussenseite in einen zahnartigen Vorsprung aus. Das vorhergehende Glied ist
breit becherförmig, nach innen zahnförmig hervorspringend, das drittletzte etwas
schmaler und länger, einfach. Der fast glatte und deutlich glänzende Cephalothorax
ist im Bereich des vordersten Dritttheils zerstreut, nach hinten dichter und
stärker, beiderseits sogar feilenartig rauh punktirt. Noch sehr viel dichter und
grober ist die Skulptur auf der Vofderfläche der Kieferfühler, wo sie ein schuppig
körniges Ansehen hat. An den pechbraunen Beinen sind die Schienen und Tarsen
fein längsriefig, diejenigen der beiden ersten Paare dunkler, fast schwärzlich. Der
Hinterleib erscheint durch sehr feine Ciselirung matt, kohlschwarz.
Am See J ip e (Ende October’s 1862) aufgefunden.
Fam. Citigradae, L a tr .
Selenops, Du f.
Annal, gén. d. scienc. phys. IV. p. 361.
Jiypoplaiea, M’L eay.
22. Selenops Sansibaricus, n. sp.
Pedum 2. et 4. femoribus aeque longis: ubique cervino-tomentosus, cano-nigroque seto-
sus, femoribus supra obsolete fasciatis, tibiarum articulo secundo pwncto basalinigro.
Long. corp. 8 mill. <y.