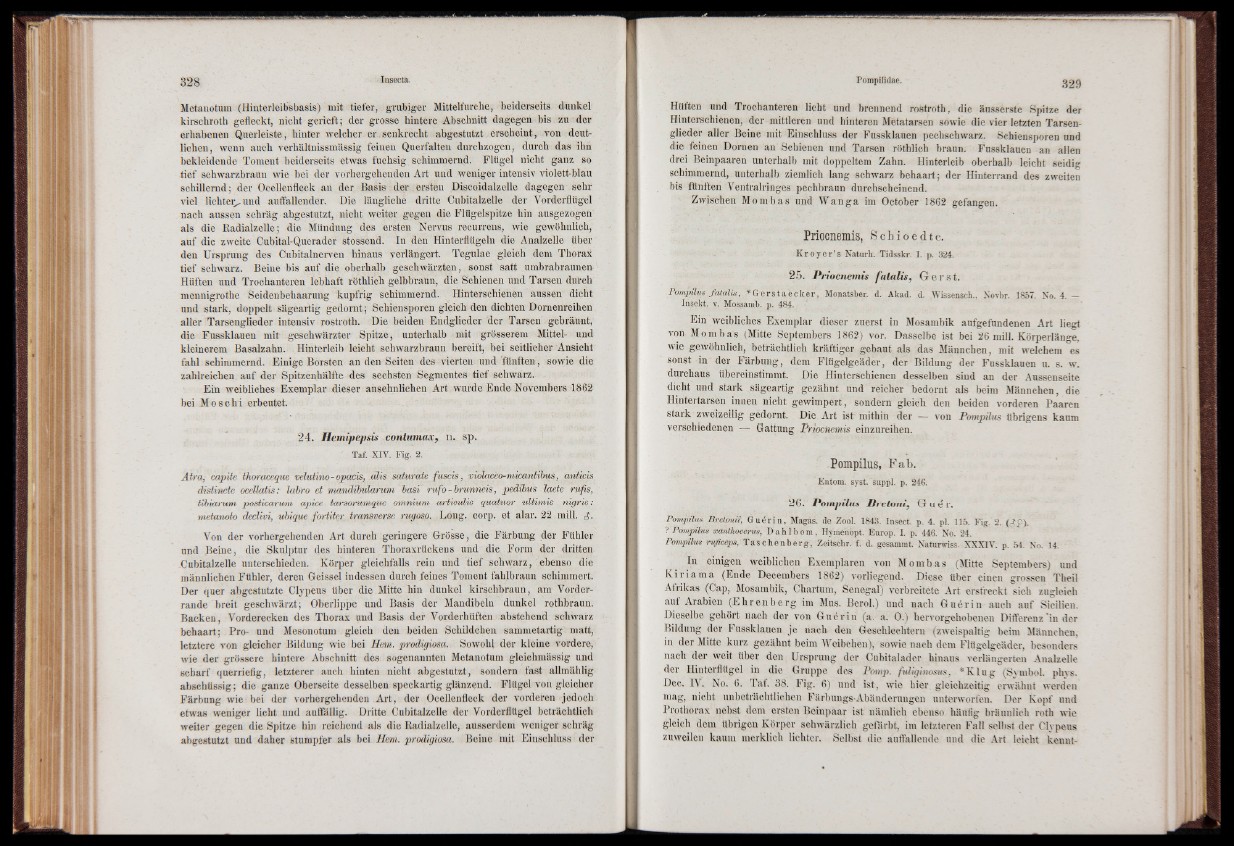
Metanotuin (Hinterleibsbasis) mit tiefer, grubiger Mittelfurche, beiderseits dunkel
kirschroth gefleckt, nicht gerieft; der grosse hintere Abschnitt dagegen bis zu der
erhabenen Querleiste, hinter welcher er.senkrecht abgestutzt erscheint, von deutlichen,
wenn auch verhältnissmässig feinen Querfalten durchzogen, durch das ihn
bekleidende Toment beiderseits etwas fuchsig schimmernd. Flügel nicht ganz so
tief schwarzbraun wie bei der vorhergehenden Art und weniger intensiv violett-blau
schillernd; der Oeellenfleck an der Basis der ersten Discoidalzelle dagegen sehr
viel lichter^ und auffallender. Die längliche dritte Cubitalzelle der Vorderflügel
nach aussen schräg abgestutzt, nicht weiter gegen die Flügelspitze hin ausgezogen
als die Radialzelle; die Mündung des ersten Nervus recurrens, wie gewöhnlich,
auf die zweite Cubital-Querader stossend. In den Hinterflügeln die Analzelle über
den Ursprung des Cubitalnerven hinaus verlängert. Tegulae gleich dem Thorax
tief schwarz. Beine bis auf die oberhalb geschwärzten, sonst satt umbrabraunen
Hüften und Trochanteren lebhaft röthlich gelbbraun, die Schienen und Tarsen durch
mennigrothe Seidenbehaarung kupfrig schimmernd. Hinterschienen aussen dicht
und stark, doppelt sägeartig gedornt; Schiensporen gleich den dichten Dornenreihen
aller Tarsenglieder intensiv rostroth. Die beiden Endglieder der Tarsen gebräunt,
die Fussklauen mit geschwärzter Spitze, unterhalb mit grösserem Mittel- und
kleinerem Basalzahn. Hinterleib leicht schwarzbraun bereift, bei seitlicher Ansicht
fahl schimmernd. Einige Borsten an den Seiten des vierten und fünften, sowie die
zahlreichen auf der Spitzenhälfte des sechsten Segmentes tief schwarz.
Ein weibliches Exemplar dieser ansehnlichen Art wurde Ende Novembers 1862
bei Mos c hi erbeutet.
24. Hemipepsis contumax, n. sp.
Taf. XIV. Fig. 2.
Atra, capite thoracegue velutino-opacis, alis saturate fuscis, violaceo-micantibus, anticis
distincte ocellatis: läbro et manäibtdarum basi rufo-brunneis, pedibus laete rufis,
tibiarum posticarum apice ta/rsorumque omnium firticuHs quatuor ultimis nigris:
metanoto dedivi, ubique fortiter transverse rugoso. Long. corp. et alar. 22 mill. $.
Von der vorhergehenden Art durch geringere Grösse, die Färbung der Fühler
und Beine, die Skulptur des hinteren Thoraxrückens und die Form der dritten
Cubitalzelle unterschieden. Körper gleichfalls rein und tief schwarz, ebenso die
männlichen Fühler, deren Geissel indessen durch feines Toment fahlbraun schimmert.
Der quer abgestutzte Clypeus über die Mitte hin dunkel kirschbraun, am Vorderrande
breit geschwärzt; Oberlippe und Basis der Mandibeln dunkel rothbraun.
Backen, Vorderecken des Thorax und Basis der Vorderhüften abstehend schwarz
behaart; Pro- und Mesonotum gleich den beiden Schildchen sammetartig matt,
letztere von gleicher Bildung wie bei Hem. prodigiosa. Sowohl der kleine vordere,
wie der grössere hintere Abschnitt des sogenannten Metanotum gleichmässig und
scharf querriefig, letzterer auch hinten nicht abgestutzt, sondern fast allmählig
abschüssig; die ganze Oberseite desselben speckartig glänzend. Flügel von gleicher
Färbung wie bei der vorhergehenden Art, der Oeellenfleck der vorderen jedoch
etwas weniger licht und auffällig. Dritte Cubitalzelle der Vorderflügel beträchtlich
weiter gegen die Spitze hin reichend als die Radialzelle, ausserdem weniger schräg
abgestutzt und daher stumpfer als bei Hem. prodigiosa. Beine mit Einschluss der
Hüften und Trochanteren licht und brennend rostroth, die äusserste Spitze der
Hinterschienen, der mittleren und hinteren Metatarsen sowie die vier letzten Tarsenglieder
aller Beine mit Einschluss der Fussklauen pechschwarz. Schiensporen und
die feinen Dornen an Schienen und Tarsen röthlich braun. Fussklauen an allen
drei Beinpaaren unterhalb mit doppeltem Zahn. Hinterleib oberhalb leicht seidig
schimmernd, unterhalb ziemlich lang schwarz behaart; der Hinterrand des zweiten
bis fünften Ventralringes pechbraun durchscheinend.
Zwischen Mombas und Wa n g a im October 1862 gefangen.
Priocnemis, S c b io e d t e .
K r o y e r ’s Naturh. Tidsskr. I. p. 324.
25. Priocnemis fatalis, G er st.
Pompilm fa ta lis, *G e r s t a e c k e r , Monatsber. d. Akad. d. Wissensch., Novbr. 1857. No. 4. —
Insekt, v. Mossamb. p. 484.
Ein weibliches Exemplar dieser zuerst in Mosambik aufgefundenen Art liegt
von Momba s (Mitte Septembers 1862) vor. Dasselbe ist bei 26 mill. Körperlänge,
wie gewöhnlich, beträchtlich kräftiger gebaut als das Männchen, mit welchem es
sonst in der Färbung, dem Flügelgeäder, der Bildung der Fussklauen u. s. w.
durchaus übereinstimmt. Die Hinterschienen desselben sind an der Aussenseite
dicht und stark sägeartig gezähnt und reicher bedomt als beim Männchen, die
Hintertarsen innen nicht gewimpert, sondern gleich, den beiden vorderen Paaren
stark zweizeilig gedornt. Die Art ist mithin der :— von Pompdus übrigens kaum
verschiedenen -s¥ Gattung Priocnemis einzureihen.
Pompilus, Fab.
Entom. syst, suppl. p. 246.
26. Pompilus Bretoni, Guér.
Pompilus Bretonii, G u é r i n , Magas. de Zool. 1843. Insect. p. 4. pl. 115. Fig. 2. ( J f ) .
? Pmnpilvs xamthocerus, D a h l b om , Hymenöpt. Europ. I. p. 446. No. 24.
Pompilus ruficeps, T a s c h e n b e r g , Zeitschr. f. d. gesammt. Naturwiss. XXXIV. p. 54. No. 14.
In einigen weiblichen Exemplaren von Momba s (Mitte Septembers) und
K i r i ama (Ende Decembers 1862) vorliegend. Diese über einen grossen Theil
Afrikas (Cap, Mosambik, Chartum, Senegal) verbreitete Art erstreckt sich zugleich
auf Aiabien (Eh r e n b e r g im Mus. Berol.) und nach Gu é r in auch auf Sicilien.
Dieselbe gehört nach der von Gué r in (a. a. 0.) hervorgehobenen Differenz "in der
Bildung der Fussklauen je nach den Geschlechtern (zweispaltig beim Männchen,
in der Mitte kurz gezähnt beim Weibchen), sowie nach dem Flügelgeäder, besonders
nach der weit über den Ursprung der Cubitalader hinaus verlängerten Analzelle
der Hinterflügel in die Gruppe des Pomp, fuliginosus, *Klug (Symbol, phys.
Dec. IV. No. 6. Tat. 38. Fig. b) und ist, wie hier gleichzeitig erwähnt werden
mag, nicht unbeträchtlichen Färbungs-Abänderungen unterworfen. Der Kopf und
Prothorax nebst dem ersten Beinpaar ist nämlich ebenso häufig bräunlich roth wie
gleich dem übrigen Körper schwärzlich gefärbt, im letzteren Fall selbst der Clvpeus
zuweilen kaum merklich lichter. Selbst die auffallende und die Art leicht kennt