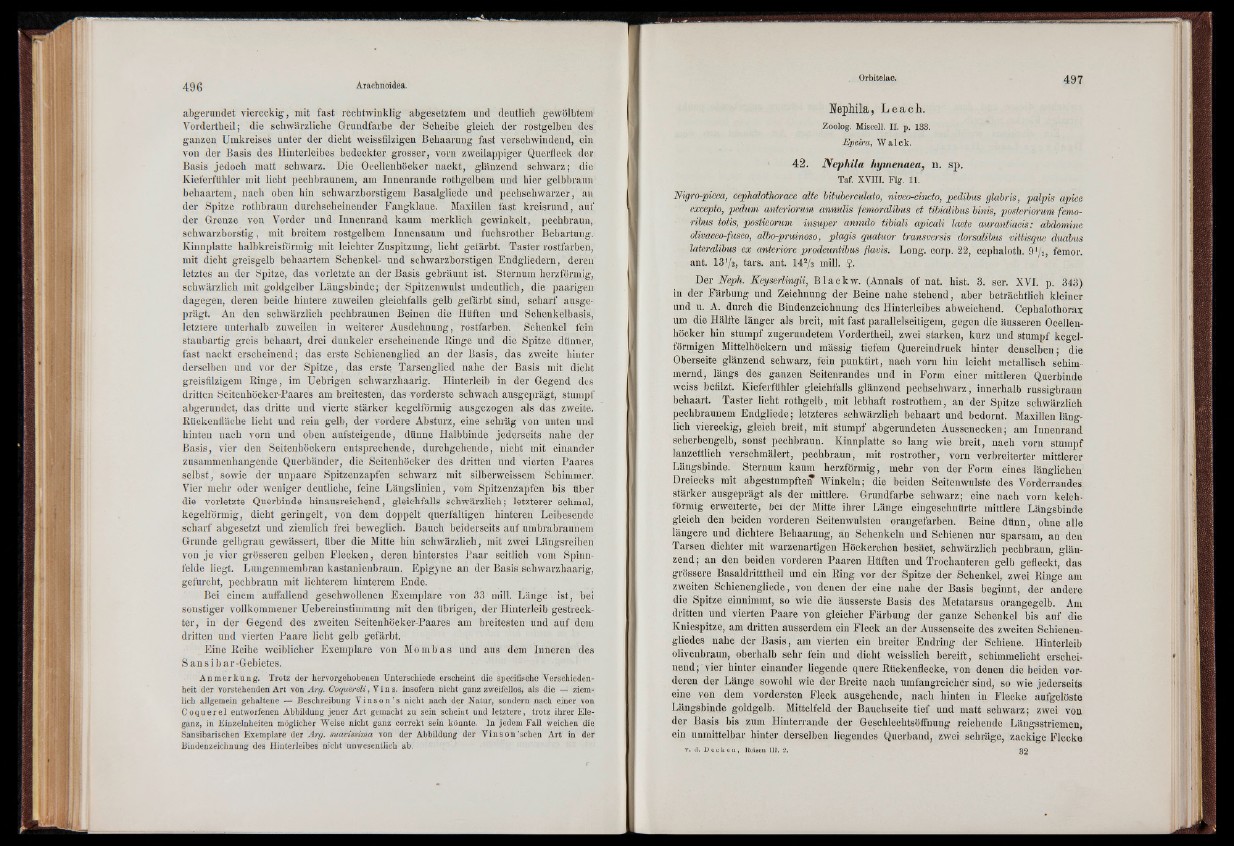
abgerundet viereckig, mit fast rechtwinklig abgesetztem und deutlich gewölbtem
Vordertheil; die schwärzliche Grundfarbe der Scheibe gleich der rostgelben des
ganzen Umkreises unter der dicht weissfilzigen Behaarung fast verschwindend, ein
von der Basis des Hinterleibes bedeckter grösser, vorn zweilappiger Querfleek der
Basis jedoch matt schwarz. Die Ocellenhöcker nackt, glänzend schwarz; die
Kieferfühler mit licht pechbraunem, am Innenrande rothgelbem und hier gelbbraun
behaartem, nach oben hin schwarzborstigem Basalgliede und pechschwarzer, an
der Spitze rothbraun durchscheinender Fangklaue. Maxillen fast kreisrund, auf
der Grenze von Vorder und Innenrand kaum merklich gewinkelt, pechbraun,
schwarzborstig, mit breitem rostgelbem Innensaum und fuchsrother Bebartung.
Kinnplatte halbkreisförmig mit leichter Zuspitzung, licht gefärbt. Taster rostfarben,
mit dicht greisgelb behaartem Schenkel- und schwarzborstigen Endgliedern, deren
letztes an der Spitze, das vorletzte an der Basis gebräunt ist. Sternum herzförmig,
schwärzlich mit goldgelber Längsbinde; der Spitzenwulst undeutlich, die paarigen
dagegen, deren beide hintere zuweilen gleichfalls gelb gefärbt sind, scharf ausgeprägt.
An den schwärzlich pechbraunen Beinen die Hüften und Schenkelbasis,
letztere unterhalb zuweilen in weiterer Ausdehnung, rostfarben. Schenkel fein
staubartig greis behaart, drei dunkeier erscheinende Ringe und die Spitze dünner,
fast nackt erscheinend; das erste Schienenglied an der Basis, das zweite hinter
derselben und vor der Spitze, das erste Tarsenglied nahe der Basis mit dicht
greisfilzigem Ringe, im Uebrigen schwarzhaarig. Hinterleib in der Gegend des
dritten Seitenhöcker-Paares am breitesten, das vorderste schwach ausgeprägt, stumpf
abgerundet, das dritte und vierte stärker kegelförmig ausgezogen als das zweite.
Rückenfläche licht und rein gelb, der vordere Absturz, eine schräg von unten und
hinten nach vorn und oben aufsteigende, dünne Halbbinde jederseits nahe der
Basis, vier den Seitenhöckern entsprechende, durchgehende, nicht mit einander
zusammenhängende Querbänder, die Seitenhöcker des dritten und vierten Paares
selbst, sowie der unpaare Spitzenzapfen schwarz mit silberweissem Schimmer.
Vier mehr oder weniger deutliche, feine Längslinien, vom Spitzenzapfen bis über
die vorletzte Querbinde hinausreichend, gleichfalls schwärzlich; letzterer schmal,
kegelförmig, dicht geringelt, von dem doppelt querfältigen hinteren Leibesende
scharf abgesetzt und ziemlich frei beweglich. Bauch beiderseits auf umbrabraunem
Grunde gelbgrau gewässert, über die Mitte hin schwärzlich, mit zwei Längsreihen
von je vier grösseren gelben Flecken, deren hinterstes Paar seitlich vom Spinnfelde
liegt. Lungenmembran kastanienbraun. Epigyne an der Basis schwarzhaarig,
gefurcht, pechbraun mit lichterem hinterem Ende.
Bei einem auffallend geschwollenen Exemplare von 33 mill. Länge ist, bei
sonstiger vollkommener Uebereinstimmung mit den übrigen, der Hinterleib gestreckter,
in der Gegend des zweiten Seitenhöcker-Paares am breitesten und auf dem
dritten und vierten Paare licht gelb gefärbt.
Eine Reihe weiblicher Exemplare von Mombas und aus dem Inneren des
S an s i b ar-Gebietes.
A nm e rk u n g . Trotz der hervorgehobenen Unterschiede erscheint die specifische Verschiedenheit
der vorstehenden Art von Arg. Coquetreli, V in s. insofern nicht ganz zweifellos, als die — ziemlich
allgemein gehaltene — Beschreibung V in s o n ’s nicht nach der Natur, sondern nach einer von
C o q u e r e l entworfenen Abbüdung jener Art gemacht zu sein scheint und letztere, trotz ihrer Eleganz,
in Einzelnheiten möglicher Weise nicht ganz correkt sein könnte, ln jedem Fall weichen die
Sansibarischen Exemplare der Arg. sucivissima von der Abbüdung der Vin s o n ’sehen Art in der
Bindenzeichnung des Hinterleibes nicht unwesentlich ab.
Nephila, L ea ch .
Zoolog. Miscell. n . p. 133.
Ejietra, W a lc k .
42. Nephila hymenaea, n. sp.
Taf. XVIII. Fig. 11.
Nigro-picea, cephüothorace alte bituberculato, niveo-emeto, pedibus glabris, paJpis apice
exeepto, pedum emteriorum annulis femoralibus et tibiedibus bims, posterionm femo-
ribus totis, posticorum insvper annulo tibiali apicali laete aurantiaeis: abdomine
olivaceo-fusco, cdbo-prwmoso, plagis quatuor transversis dorsalibus vittisque duabus
lateraUbus ex anteriore prodewntibus flavis. Long. corp. 22, cephaloth. 9 m, femor.
ant. 13'/s, tars. ant. 142/3 mill, $.
Der Neph. Keyserlingii, B la c k w. (Annals of nat. hist. 3. ser. XVI. p. 343)
in der Färbung und Zeichnung der Beine nahe stehend, aber beträchtlich kleiner
und u. A. durch die Bindenzeichnung des Hinterleibes abweichend. Cephalothorax
um die Hälfte länger als breit, mit fast parallelseitigem, gegen die äusseren Ocellenhöcker
hin stumpf zugerundetem Vordertheil, zwei starken, kurz und stumpf kegelförmigen
Mittelhöckern und mässig tiefem Quereindruck hinter denselben; die
Oberseite glänzend schwarz, fein punktirt, nach vorn hin leicht metallisch schimmernd,
längs des ganzen Seitenrandes und in Form einer mittleren Querbinde
weiss befilzt. Kieferfühler gleichfalls glänzend pechschwarz, innerhalb russigbraun
behaart. Taster licht rothgelb, mit lebhaft rostrothem, an der Spitze schwärzlich
pechbraunem Endgliede; letzteres schwärzlich behaart und bedornt. Maxillen länglich
viereckig, gleich breit, mit stumpf abgerundeten Aussenecken; am Innenrand
scherbengelb, sonst pechbraun. Kinnplatte so lang wie breit, nach vorn stumpf
lanzettlich verschmälert, pechbraun, mit rostrother, vorn verbreiterter mittlerer
Längsbinde. Sternum kaum herzförmig, mehr von der Form eines länglichen
Dreiecks mit abgestumpften Winkeln; die beiden Seitenwulste des Vorderrandes
stärker ausgeprägt als der mittlere. Grundfarbe schwarz; eine nach vorn kelch-
förmig erweiterte, bei der Mitte ihrer Länge eingeschnürte mittlere Längsbinde
gleich den beiden vorderen Seitenwulsten orangefarben. Beine dünn, ohne alle
längere und dichtere Behaarung, an Schenkeln und Schienen nur sparsam, an den
Tarsen dichter mit warzenartigen Höckerchen besäet, schwärzlich pechbraun, glänzend
; an den beiden vorderen Paaren Hüften und Trochanteren gelb gefleckt, das
grössere Basaldritttheil und ein Ring vor der Spitze der Schenkel, zwei Ringe am
zweiten Schienengliede, von denen der eine nahe der Basis beginnt, der andere
die Spitze einnimmt, so wie die äusserste Basis des Metatarsus orangegelb. Am
dritten und vierten Paare von gleicher Färbung der ganze Schenkel bis auf die
Kniespitze, am dritten ausserdem ein Fleck an der Aussenseite des zweiten Schienengliedes
nahe der Basis, am vierten ein breiter Endring der Schiene. Hinterleib
olivenbraun, oberhalb sehr fein und dicht weisslich bereift, schimmelicht erscheinend;
vier hinter einander liegende quere Rückenfleeke, von denen die beiden vorderen
der Länge sowohl wie der Breite nach umfangreicher sind, so wie jederseits
eine von dem vordersten Fleck ausgehende, nach hinten in Flecke aufgelöste
Längsbinde goldgelb. Mittelfeld der Bauchseite tief und matt schwarz; zwei von
der Basis bis zum Hinterrande der Geschlechtsöffnung reichende Längsstriemen,
ein unmittelbar hinter derselben liegendes Querband, zwei schräge, zackige Flecke
v. (1. D e c k e n , Kcisen III. 2, 32