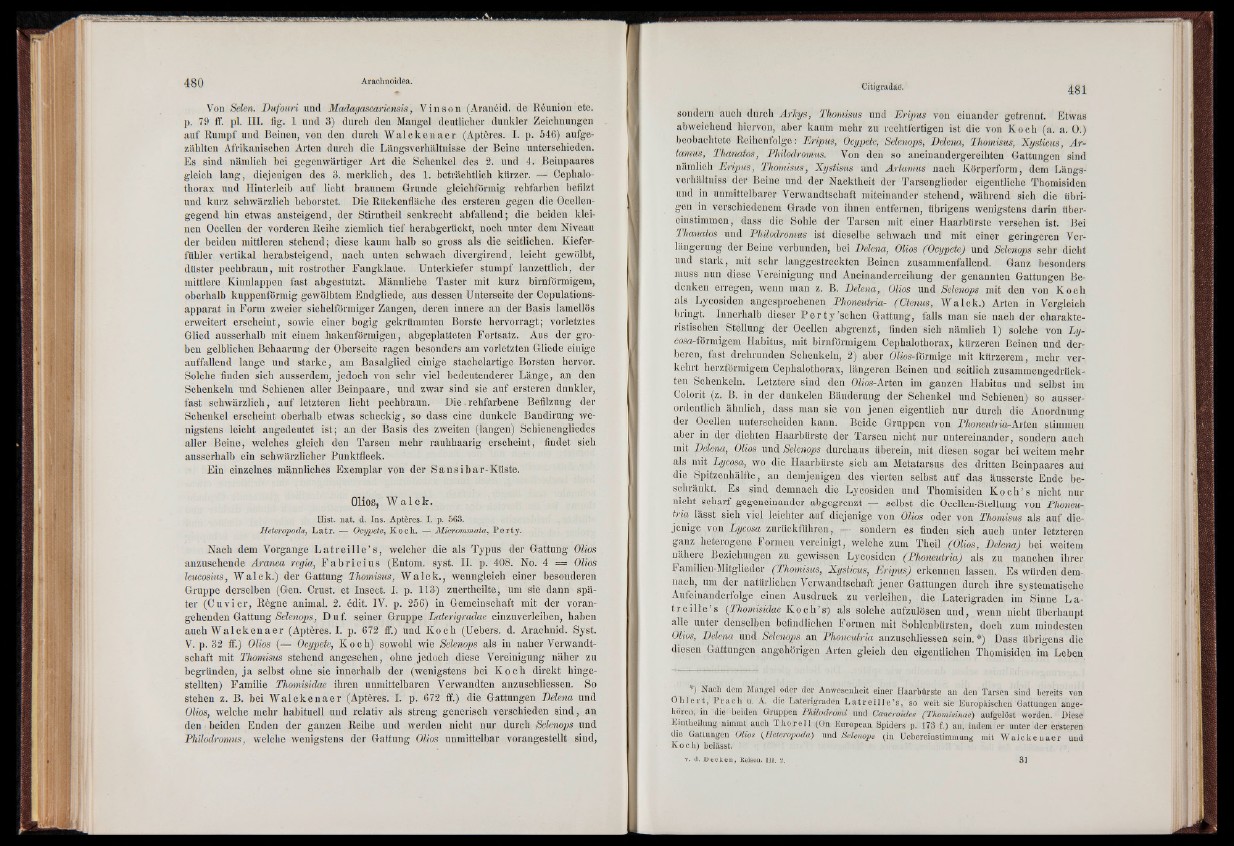
Von Selen. Bufouri und Madagascariensis, V in so n (Aranéid. de Réunion etc.
p. 79 ff. pl. III. fig. 1 und 3) durch den Mangel deutlicher dunkler Zeichnungen
auf Rumpf und Beinen, von den durch W a lc k e n a e r (Aptères. I. p. 546) aufgezählten
Afrikanischen Arten durch die Längsverhältnisse der Beine unterschieden.
Es sind nämlich bei gegenwärtiger Art die Schenkel des 2. und 4. Beinpaares
gleich lang, diejenigen des 3. merklich, des 1. beträchtlich kürzer. — Céphalothorax
und Hinterleib auf licht braunem Grunde gleichförmig rehfarben befilzt
und kurz schwärzlich beborstet. Die Rückenfläehe des ersteren gegen die Ocellen-
gegend hin etwas ansteigend, der Stirntheil senkrecht abfallend; die beiden kleinen
Ocellen der vorderen Reihe ziemlich tief herabgerückt, noch unter dem Niveau
der beiden mittleren stehend; diese kaum halb so gross als die seitlichen. Kieferfühler
vertikal herabsteigend, nach unten schwach divergirend, leicht gewölbt,
düster pechbraun, mit rostrother Fangklaue. Unterkiefer stumpf lanzettlich, der
mittlere Kinnlappen fast abgestutzt. Männliche Taster mit kurz bimförmigem,
oberhalb kuppenförmig gewölbtem Endgliede, aus dessen Unterseite der Copulations-
apparat in Form zweier sichelförmiger Zangen, deren innere an der Basis lamellös
erweitert erscheint, sowie einer bogig gekrümmten Borste hervorragt; vorletztes
Glied ausserhalb mit einem hakenförmigen, abgeplatteten Fortsatz. Aus der groben
gelblichen Behaarung der Oberseite ragen besonders am vorletzten Gliede einige
auffallend lange und starke, am Basalglied einige stachelartige Borsten hervor.
Solche finden sich ausserdem, jedoch von sehr viel bedeutenderer Länge, an den
Schenkeln und Schienen aller Beinpaare, und zwar sind sie auf ersteren dunkler,
fast schwärzlich, auf letzteren lieht pechbraun. Die. rehfarbene Befilzung der
Schenkel erscheint oberhalb etwas scheckig, so dass eine dunkele Bandirung wenigstens
leicht angedeutet ist; an der Basis des zweiten (langen) Schienengliedes
aller Beine, welches gleich den Tarsen mehr rauhhaarig erscheint, findet sich
ausserhalb ein schwärzlicher Punktfleck.
Ein einzelnes männliches Exemplar von der S an sib a r-K ü ste .
Olios, Wa lc k .
Hist. nat. d. Ins. Aptères. I. p. 563.
Hetcropoda, L a tr . — Ocypete, K o ch . — Micrommata, P e r ty .
Nach dem Vorgänge L a t r e i l l e ’s, welcher die als Typus der Gattung Olios
anzusehende Aranea regia, F a b r i c i u s (Entom. syst. II. p. 408. No. 4 == Olios
leucosius, W a lc k .) der Gattung Thomisus, W a lc k ., wenngleich einer besonderen
Gruppe derselben (Gen. Crust. et Insect. I. p. 113) zuertheilte, um sie dann später
(C u v ie r, Règne animal. 2. édit. IV. p. 256) in Gemeinschaft mit der vorangehenden
Gattung Sélenops, D u f. seiner Gruppe Laterigradae einzuverleiben, haben
auch W a lc k e n a e r (Aptères. I. p. 672 ff.) und K o ch (Uebers. d. Arachnid. Syst.
V. p. 32 ff.) Olios ( = Ocypete, K o ch ) sowohl wie Sélenops als in naher Verwandtschaft
mit Thomisus stehend angesehen, ohne jedoch diese Vereinigung näher zu
begründen, ja selbst ohne sie innerhalb der (wenigstens bei K o c h direkt hingestellten)
Familie Thomisidae ihren unmittelbaren Verwandten anzuschliessen. So
stehen z. B. bei W a lc k e n a e r (Aptères. I. p. 672 ff.) die Gattungen Belena und
Olios, welche mehr habituell und relativ als streng generisch verschieden sind, an
den beiden Enden der ganzen Reihe und werden nicht nur durch Sélenops und
Philodromus, welche wenigstens der Gattung Olios unmittelbar vorangestellt sind,
sondern auch durch Arlcys, Thomisus und Eripus von einander getrennt. Etwas
abweichend hiervon, aber kaum mehr zu rechtfertigen ist die von Koch (a. a. 0.)
beobachtete Reihenfolge: Eripus, Ocypete, Selenops, Belena, Thomisus, Xysticus, Ar-
tamus, Thmatos, Philodromus. Von den so aneinandergereihten Gattungen sind
nämlich Eripus, Thomisus, Xystisus und Artamus nach Körperform, dem Längs-
verhältniss der Beine und der Nacktheit der Tarsenglieder eigentliche Thomisiden
und in unmittelbarer Verwandtschaft miteinander stehend, während sich die übrigen
in verschiedenem Grade von ihnen entfernen, übrigens wenigstens darin übereinstimmend
dass die Sohle der Tarsen mit einer Haarbürste versehen ist. Bei
Thematos und Philod/romus ist dieselbe schwach und mit einer geringeren Verlängerung
der Beine verbunden, bei Belena, Olios (Ocypete) und Selenops sehr dicht
und stark, mit sehr langgestreckten Beinen zusammenfallend. Ganz besonders
muss nun diese Vereinigung und Aneinanderreihung der genannten Gattungen Bedenken
erregen, wenn man z. B. Belena, Olios und Selenops mit den von Koch
als Lycosiden angesprochenen Phoneutria- (Gterms, W a lck .) Arten in Vergleich
bringt. Innerhalb dieser P e r t y ’sehen Gattung, falls man sie nach der charakteristischen
Stellung der Ocellen abgrenzt, finden sich nämlich 1) solche von Ly-
cosa-förmigem Habitus, mit bimförmigem Cephalothorax, kürzeren Beinen und derberen,
last drehrunden Schenkeln, 2) aber OKos-förmige mit kürzerem, mehr verkehrt
herzförmigem Cephalothorax, längeren Beinen und seitlich zusammengedrückten
Schenkeln. Letztere sind den OKos-Arten im ganzen Habitus und selbst im
Colorit (z. B. in der dunkelen Bänderung der Schenkel und Schienen) so ausserordentlich
ähnlich, dass man sie von jenen eigentlich nur durch die Anordnung
der Ocellen unterscheiden kann. Beide Gruppen von Phoneutria-ArtQu stimmen
aber in der dichten Haarbürste der Tarsen nicht nur untereinander, sondern auch
mit Belena, Olios und Selenops durchaus überein, mit diesen sogar bei weitem mehr
als mit Lycosa, wo die Haarbürste sich am Metatarsus des dritten Beinpaares aut
die Spitzenhälfte, an demjenigen des vierten selbst auf das äusserste Ende beschränkt.
Es sind demnach die Lycosiden und Thomisiden K o e h ’s nicht nur
nicht scharf gegeneinander abgegrenzt — selbst die Ocellen-Stellung von Phonem
tria lässt sich viel leichter auf diejenige von Olios oder von Thomisus als auf diejenige
von Lycosa zurückführen., sondern es finden sich auch unter letzteren
ganz heterogene Formen vereinigt, welche zum Theil (Olios, Belena) bei weitem
nähere Beziehungen zu gewissen Lycosiden (Phoneutria) als zu manchen ihrer
Familien-Mitglieder (Thomisus, Xysticus, Eripus) erkennen lassen. Es würden demnach,
um der natürlichen Verwandtschaft jener Gattungen durch ihre systematische
Aufeinanderfolge einen Ausdruck zu verleihen, die Laterigraden im Sinne La-
t r e ilte s (Thomisidae K o c h ’s) als solche aufzulösen und, wenn nicht überhaupt
alle unter denselben befindlichen Formen mit Sohlenbürsten, doch zum mindesten
Olios, Belena und Selenops an Phoneutria anzuschliessen sein. *) Dass übrigens die
diesen Gattungen angehörigen Arten gleich den eigentlichen Thomisiden im Leben
*) Nach dem Mangel oder der Anwesenheit einer Haarbürste an den Tarsen sind bereits von
O h l e r t , P r a c h u. A. die Laterigraden L a t r e i l l e ’s, so weit sie Europäischen Gattungen angeboren,
in die -beiden Gruppen Philodromi und Cancroides (Thomisiruie) aufgelöst worden. Diese
Eintheilung nimmt auch T h o r e i l (On European Spiders p. 173 f.) an, indem er unter der ersteren
die Gattungen Olios (Heteropoda) und Selenops (in Uebereinstimmung mit W a l c k e n a e r und
Koch) belässt.
v . (1. D e c k e n , Reisen. II I. 2. 31