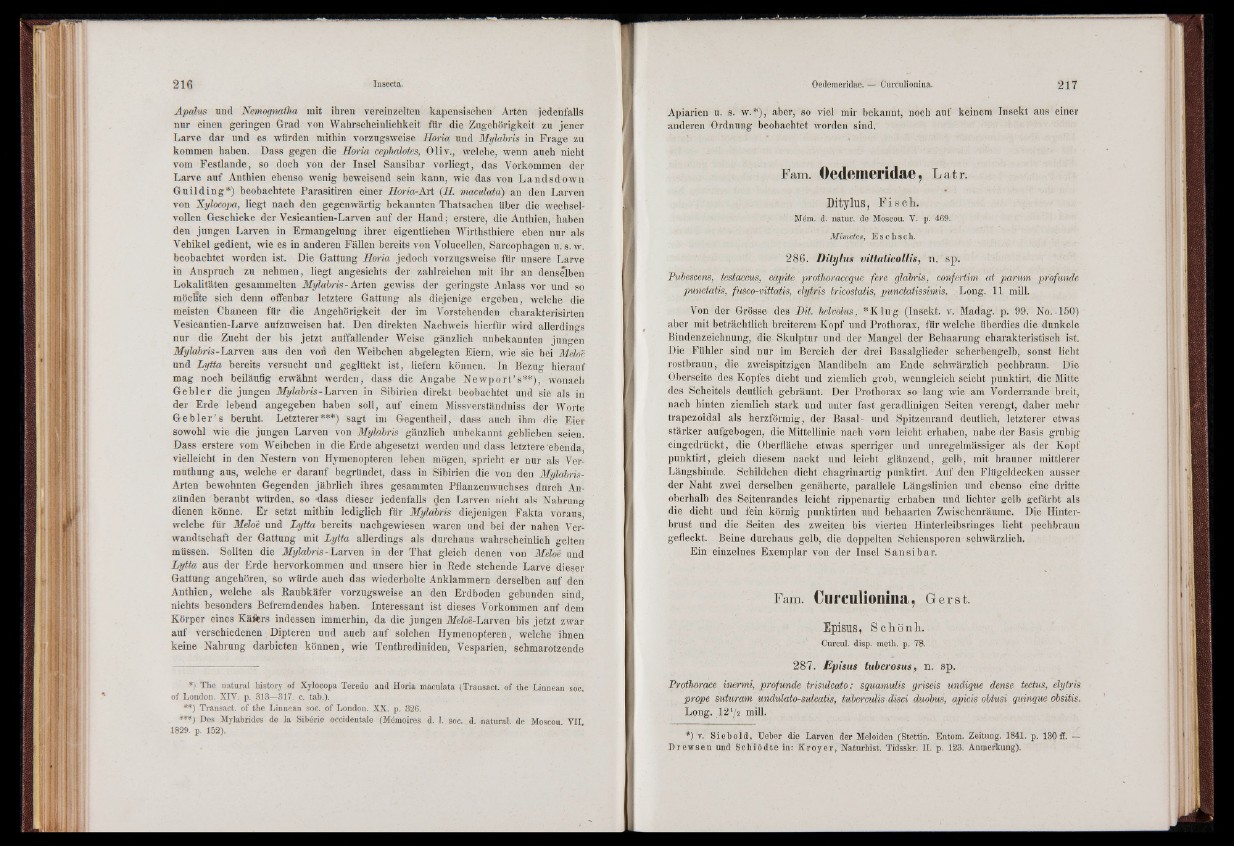
Apalus und Nemognatha mit ihren vereinzelten kapensischen Arten jedenfalls
nur einen geringen Grad von Wahrscheinlichkeit für die Zugehörigkeit zu jener
Larve dar und es würden mithin vorzugsweise Horia und Mylabris in Frage zu
kommen haben. Dass gegen die Horia cephalotes, Oliv., welche, wenn auch nicht
vom Festlande, so doch yon der Insel Sansibar vorliegt, das Vorkommen der
Larve auf Anthien ebenso wenig beweisend sein kann, wie das von Landsdown
Guilding*) beobachtete Parasitären einer Horm-Art (H. maculata) an den Larven
von Xylocopa, liegt nach den gegenwärtig bekannten Thatsachen über die wechselvollen
Geschicke der Vesieantien-Larven auf der Hand; erstere, die Anthien, haben
den jungen Larven in Ermangelung ihrer eigentlichen Wirthsthiere eben nur als
Vehikel gedient, wie es in anderen Fällen bereits von Volucellen, Sarcophagen u. s. w.
beobachtet worden ist. Die Gattung Horia jedoch vorzugsweise für unsere Larve
in Anspruch zu nehmen, liegt angesichts der zahlreichen mit ihr an denselben
Lokalitäten gesammelten Mylabris-Arten gewiss der geringste Anlass vor und so
möchte sich denn offenbar letztere Gattung als diejenige ergeben, welche die
meisten Chancen für die Angehörigkeit der im Vorstehenden charakterisirten
Vesicantien-Larve aufzuweisen hat. Den direkten Nachweis hierfür wird allerdings
nur die Zucht der bis jetzt auffallender Weise gänzlich unbekannten jungen
Mylabris-Larven aus den von den Weibchen abgelegten Eiern, wie sie bei Meloe
und Lytta bereits versucht und geglückt ist, liefern können. In Bezug hierauf
mag noch beiläufig erwähnt werden, dass die Angabe Newp o r t ’s**), wonach
Gebier die jungen Mylabris-Larven in Sibirien direkt beobachtet und sie als in
der Erde lebend angegeben haben soll, auf einem Missverständniss der Worte
Ge b i e r ’s beruht. Letzterer***) sagt im Gegentheil, dass auch ihm die Eier
sowohl wie die jungen Larven von Mylabris gänzlich unbekannt geblieben seien.
Dass erstere vom Weibchen in die Erde abgesetzt werden und dass letztere ebenda,
vielleicht in den Nestern von Hymenopteren leben mögen, spricht er nur als Ver-
muthung aus, welche er darauf begründet, dass in Sibirien die von den Mylahris-
Arten bewohnten Gegenden jährlich ihres gesammten Pflanzenwuchses durch Anzünden
beraubt würden, so -dass dieser jedenfalls den Larven nicht als Nahrung
dienen könne. Er setzt mithin lediglich für Mylabris diejenigen Fakta voraus,
welche für Meloe und Lytta bereits naehgewiesen waren und bei der nahen Verwandtschaft
der Gattung mit Lytta allerdings als durchaus wahrscheinlich gelten
müssen. Sollten die Mylabris - Larven in der That gleich denen von Meloe und
Lytta aus der Erde hervorkommen und unsere hier in Rede stehende Larve dieser
Gattung angehören, so würde auch das wiederholte Anklammern derselben auf den
Anthien, welche als Raubkäfer vorzugsweise an den Erdboden gebunden sind,
nichts besonders Befremdendes haben. Interessant ist dieses Vorkommen auf dem
Körper eines Käfers indessen immerhin, da die jungen Meloe-Larven bis jetzt zwar
auf verschiedenen Dipteren und auch auf solchen Hymenopteren, welche ihnen
keine Nahrung darbieten können, wie Tenthrediniden, Vesparien, schmarotzende
*) The natural history of Xylocopa Teredo and Horia maculata (Transact, of the Linnean soc.
of London. XIV. p. 313—317. c. tab.).
**} Transact, of the Linnean soc. of London. XX. p. 326.
***) Des Mylabrides de la Sibérie occidentale (Mémoires d. 1. soc. d. natural, de Moscou. VII.
1829. p. 152).
Apiarien u. s. w.*), aber, so viel mir bekannt, noch auf keinem Insekt aus einer
anderen Ordnung beobachtet worden sind.
Fam. Oedemeridae, L a t r.
Ditylus, F i s e k
M&n. d. natur. de Moscou. V. p. 469.
Mimetes, E s c h s ch.
286. Ditylus vittaticollis, n. sp.
Pubescens, testaceus, ca/pite prothoraceque fere glabris, confertim at partim profunde
punctatis, fusco-vittatis, elytris tricostatis, pu/nctatissimis, Long. 11 mill.
Von der Grösse des Lit. helvbl/as, * Klug (Insekt, v. Madag. p. 99. No. 150)
aber mit beträchtlich breiterem Kopf und Prothorax, für welche überdies die dunkele
Bindenzeichnung, die Skulptur und der Mangel der Behaarung charakteristisch ist.
Die Fühler sind nur im Bereich der drei Basalglieder scherbengelb, sonst licht
rostbraun, die zweispitzigen Mandibeln am Ende schwärzlich pechbraun. Die
Oberseite des Kopfes dicht und ziemlich grob, wenngleich seicht punktirt, die Mitte
des Scheitels deutlich gebräunt. Der Prothorax so lang wie am Vorderrande breit,
nach hinten ziemlich stark und unter fast geradlinigen Seiten verengt, daher mehr
trapezoidal als herzförmig, der Basal- und Spitzenrand deutlich, letzterer etwas
stärker aufgebogen, die Mittellinie nach vorn leicht erhaben, nahe der Basis grubig
eingedrückt, die Oberfläche etwas sperriger und unregelmässiger als der Kopf
punktirt, gleich diesem nackt und leicht glänzend, gelb, mit brauner mittlerer
Längsbinde. Schildchen dicht chagrinartig punktirt. Auf den Flügeldecken ausser
der Naht zwei derselben genäherte, parallele Längslinien und ebenso eine dritte
oberhalb des Seitenrandes leicht rippenartig erhaben und lichter gelb gefärbt als
die dicht und fein körnig punktirten und behaarten Zwischenräume. Die Hinterbrust
und die Seiten des zweiten bis vierten Hinterleibsringes licht pechbraun
gefleckt. Beine durchaus gelb, die doppelten Schiensporen schwärzlich.
Ein einzelnes Exemplar von der Insel Sansibar.
Fam. Curculionina, Ge i s t .
Episus, Schönk
Curcul. disp. meth. p. 78.
287. Episus tuberosus, n. sp.
ProtJiorace inermi, profunde trisulcato : squamulis griseis undique dense tectus, elytris
prope suturam undulato-sulcatis, tubercidis disci duobus, apicis obtusi quinque obsitis.
Long. 12Vi mill.
*) v. S i e b o ld , Deber die Larven der Meloiden (Stettin. Entom. Zeitung. 1841. p. 130 ff. —
Dr ews e n und Sc h i ö d t e i n : Kr ö y e r , Naturhist. Tidsskr. II. p. 123. Anmerkung).