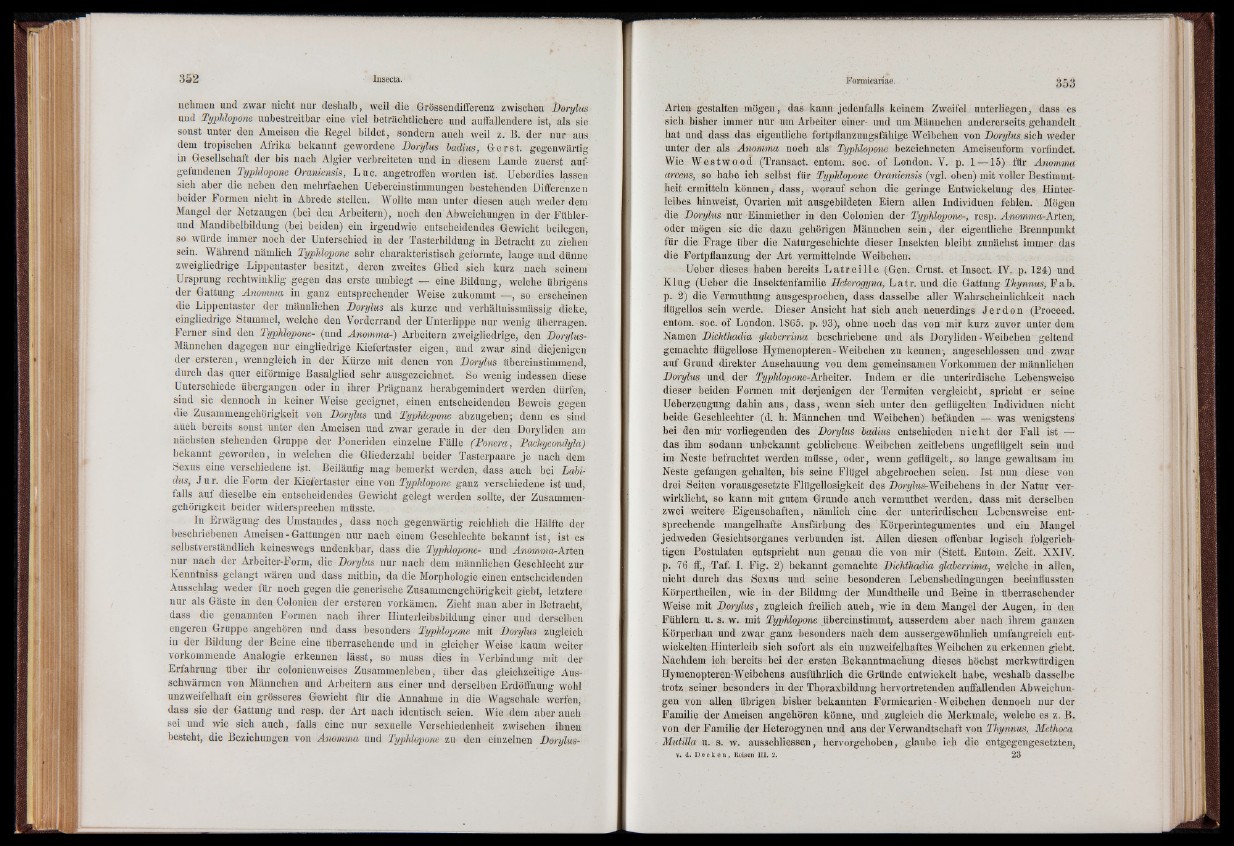
nehmen und zwar nicht nur deshalb, weil die Grössendifferenz zwischen Dorylus
und Typhlopone unbestreitbar eine viel beträchtlichere und auffallendere ist, als sie
sonst unter den Ameisen die Kegel bildet, sondern auch weil z. B. der nur aus:
dem tropischen Afrika bekannt gewordene Dorylus badius, G e r st. gegenwärtig
in Gesellschaft der bis nach Algier verbreiteten und in diesem Lande zuerst auf
gefundenen Typhlopone Orani&nsis, Luc. angetroffen worden ist. Ueberdies lassen
sich aber die neben den mehrfachen Uebereinstimmungen bestehenden Differenzen
beider Formen nicht in Abrede stellen. Wollte man unter diesen auch weder dem
Mangel der Netzaugen (bei den Arbeitern), noch den Abweichungen in der Fühlerund
Mandibelbildung (bei beiden) ein irgendwie entscheidendes Gewicht beilegen,
so würde immer noch der Unterschied in der Tasterbildung in Betracht zu ziehen
sein. Während nämlich Typhlopone sehr charakteristisch geformte, lange und dünne
zweigliedrige Lippentaster besitzt, deren zweites Glied sich kurz nach seinem'
Ursprung rechtwinklig gegen das erste umbiegt — eine Bildung, welche übrigens
der Gattung Anomma in ganz entsprechender Weise zukommt ¡¡f, so erscheinen
die Lippentaster der männlichen Dorylus als kurze und verhältnissmässig dicke,
eingliedrige Stummel, welche den Vorderrand der Unterlippe nur wenig überragen.
Ferner sind den Typhlopone- (und Anomma-') Arbeitern zweigliedrige, den Dorylus-
Männchen dagegen nur eingliedrige Kiefertaster eigen, und zwar sind diejenigen
der ersteren, wenngleich in der Kürze mit denen von Dorylus übereinstimmend,
durch das quer eiförmige Basalglied sehr ausgezeichnet. So wenig indessen diese
Unterschiede übergangen oder in ihrer Prägnanz herabgemindert werden dürfen,
sind sie dennoch in keiner Weise geeignet, einen entscheidenden Beweis gegen
die Zusammengehörigkeit von Dorylus und Typhlopone abzugeben; denn es sind
auch bereits sonst unter den Ameisen und zwar gerade in der den. Doryliden am
nächsten stehenden Gruppe der Poneriden einzelne Fälle (Ponera, Pachycondyla)
bekannt geworden, in welchen die Gliederzahl beider Tasterpaare je nach dem
Sexus eine verschiedene ist. Beiläufig mag bemerkt werden, dass auch bei Labi-
dus, Jur . die Form der Kiefertaster eine von Typhlopone ganz verschiedene ist und,
falls auf dieselbe ein entscheidendes Gewicht gelegt werden sollte, der Zusammengehörigkeit
beider widersprechen müsste.
In Erwägung des Umstandes, dass noch gegenwärtig reichlich die Hälfte der
beschriebenen Ameisen-Gattungen nur nach einem Geschlechte bekannt ist, ist es
selbstverständlich keineswegs undenkbar, dass die Typhlopone- und Anomma-Arten
nur nach der Arbeiter-Form, die Dorylus nur nach dem männlichen Geschlecht zur
Kenntniss gelangt wären und dass mithin, da die Morphologie einen entscheidenden
Ausschlag weder für noch gegen die generische Zusammengehörigkeit giebt, letztere
nur als Gäste in den Colonien der ersteren vorkämen. Zieht man aber in Betracht,
dass die genannten Formen nach ihrer Hinterleibsbildung einer und derselben
engeren Gruppe angehören und dass besonders Typhlopone mit Dorylus zugleich
in der Bildung der Beine eine überraschende und in gleicher Weise kaum weiter
vorkommende Analogie erkennen lässt, so muss dies in Verbindung mit der
Erfahrung über ihr colonienweises Zusammenleben, über das gleichzeitige Ausschwärmen
von Männchen und Arbeitern aus einer und derselben Erdöffnung wohl
unzweifelhaft ein grösseres Gewicht für die Annahme in die Wagschale werfen,
dass sie der Gattung und resp. der Art nach identisch seien. Wie dem aber auch
sei und wie sich auch, falls eine nur sexuelle Verschiedenheit zwischen ihnen
besteht, die Beziehungen von Anomma und Typhlopone zu den einzelnen Dorylus-
Arten gestalten mögen, das kann jedenfalls keinem Zweifel unterliegen, dass es
sich bisher immer nur um Arbeiter einer- und um Männchen andererseits gehandelt
hat und dass das eigentliche fortpflanzungsfähige Weibchen von Dorylus sich weder
unter der als Anomrna noch als Typhlopone bezeichneten Ameisenform vorfindet.
Wie We s two o d (Transaet. entom. soc. of London. V. p. 1—15) für Anomma
areens, so habe ich selbst für Typhlopone Oranimsis (ygl. oben) mit voller Bestimmtheit
ermitteln können, dass, worauf schon die geringe Entwickelung des Hinterleibes
hinweist, Ovarien mit ausgebildeten Eiern allen Individuen fehlen. Mögen
die Dorylus wir Einmiether in den Colonien der Typhlopone-, resp. Anomma-Axtan,
oder mögen sie die dazu gehörigen Männchen sein, der eigentliche Brennpunkt
für die Frage tiber die Naturgeschichte dieser Insekten bleibt zunächst immer das
die Fortpflanzung der Art vermittelnde Weibchen.
Ueber dieses haben bereits L a t r e i l l e (Gen. Crust, et Insect. IV. p. 124) und
Klug (Ueber die Insektenfamilie Ileterogyna, Latr. und die Gattung Thynnus, Fab.
p. 2) die Vermuthung ausgesprochen, dass dasselbe aller Wahrscheinlichkeit nach
flügellos sein werde. Dieser Ansicht hat sich auch neuerdings J e r d o n (Proceed.
entom. soc. of London. 1S65. p. 93), ohne noch das von mir kurz zuvor unter dem
Namen Dichthadia glaberrima beschriebene und als Doryliden-Weibchen geltend
gemachte flügellose Hyfnenopteren-Weibchen zu kennen-, angeschlossen und zwar
auf Grund direkter Anschauung von dem gemeinsamen Vorkommen der männlichen
Dorylus und der Typhlcpone-Arbeitex. Indem er die unterirdische Lebensweise
dieser beiden Formen mit derjenigen der Termiten vergleicht, spricht er seine
Ueberzeugung dahin aus, dass, wenn sich unter den geflügelten Individuen nicht
beide Geschlechter (d. h. Männchen und Weibchen) befänden »pi was wenigstens
bei den mir vorliegenden des Dorylus badius entschieden nicht der Fall ist —
das ihm sodann unbekannt gebliebene Weibchen zeitlebens ungeflügelt sein und
im Neste befruchtet werden müsse,- oder, wenn geflügelt,, so lange gewaltsam im
Neste gefangen gehalten, bis seine Flügel abgebrochen seien. Ist nun diese von
drei Seiten vorausgesetzte Flügellosigkeit des Dorylus-Weibabem in der Natur verwirklicht,
so kann mit gutem Grunde auch vermuthet werden, dass mit derselben
zwei weitere Eigenschaften, nämlich eine der unterirdischen Lebensweise entsprechende
mangelhafte Ausfärbung des Körperintegumentes und ein Mangel
jedweden Gesichtsorganes verbunden ist. Allen diesen offenbar logisch folgerichtigen
Postulaten entspricht nun genau die von mir (Stett Entom. Zeit. XXIV-
p. 76 ff,, -Taf. I. Fig. 2.) bekannt gemachte Dichthadia glaberrima, welche in allen,
nicht durcff das Sexus und seine besonderen Lebensbedingungen beeinflussten
Körpertheilen, wie in der Bildung der Mundtheile und Beine in überraschender
Weise mit Dorylus, zugleich freilich auch, wie in dem Mangel der Augen,, in den
Fühlern u. s. w. mit Typhlopone übereinstimmt, ausserdem aber nach ihrem ganzen
Körperbau und zwar ganz besonders nach dem aussergewöhnlich umfangreich entwickelten
Hinterleib sich sofort als ein unzweifelhaftes Weibchen zu erkennen giebt.
Nachdem ich: bereits ;bei der ersten Bekanntmachung dieses höchst merkwürdigen
Hymenopteren-Weibchens ausführlich die Gründe entwickelt habe, weshalb dasselbe
trotz seiner besonders in der Thoraxbildung hervortretenden auffallenden Abweichungen
von allen übrigen bisher bekannten Formicarien-Weibchen dennoch nur der
Familie der Ameisen angehören könne, und zugleich die Merkmale, welche es z. B.
von der Familie der Heterogynen und aus der Verwandtschaft von Thynnus, Metlioca
Mutilla u. s. w. ausschliessen, hervorgehoben, glaube ich die entgegengesetzten,
v* d. I>-e c k 6 n , Reisen III. 2. ; _ ' 23