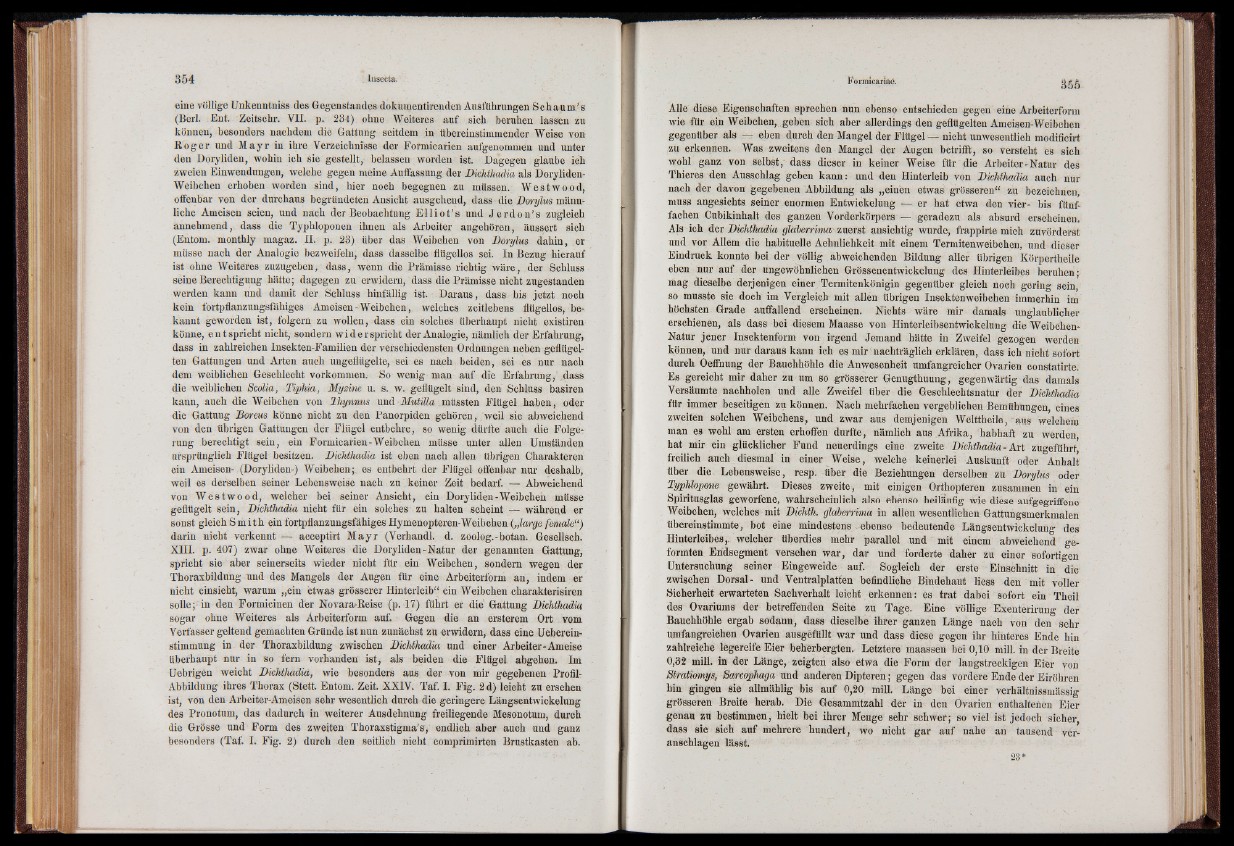
eine völlige Unkenntnis® des Gegenstandes dokumentirenden Ausführungen S ch a u m' S
(Berl. Ent. Zeitsehr. VII. p. 234). phne Weiteres auf sich beruhen lassen zu
können, besonders nachdem die Gattung seitdem in übereinstimmender Weise von
Roge r und Ma y r in ihre Verzeichnisse der Formicarien aufgenommen und unter
den Doryliden, wohin ich sie gestellt, belassen worden ist. Dagegen glaube ich
zweien Einwendungen, welche gegen meine Auffassung der Dichthadia als Doryliden-
Weibchen erhoben worden sind, hier noch begegnen zu müssen. We s twood,
offenbar von der durchaus begründeten Ansicht ausgehend, dass die Dwylus männliche
Ameisen seien, und nach der Beobachtung E l l i o t ’s und J e r d o n ’s zugleich
annehmend, dass die Typhloponen ihnen als Arbeiter angehören, äussert sich
(Entom. monthly magaz. II. p. 23) Uber das Weibchen von Dorylm dahin, er
müsse nach der Analogie bezweifeln, dass dasselbe flügellos sei. In Bezug hierauf
ist ohne Weiteres zuzugeben, dass, wenn die Prämisse richtig wäre, der Schluss
seine Berechtigung hätte; dagegen zu erwidern, dass die Prämisse nicht zugestanden
werden kann und damit der Schluss hinfällig ist. Daraus, dass bis jetzt noch
kein fortpflanzungsfähiges Ameisen-Weibchen, welches zeitlebens flügellos, bekannt
geworden ist, folgern zu wollen, dass ein solches überhaupt nicht existiren
könne, entspricht nicht, sondern widerspricht der Analogie, nämlich der Erfahrung,
dass in zahlreichen Insekten-Familien der verschiedensten Ordnungen neben geflügelten
Gattungen und Arten auch ungeflligelte, sei es nach beiden, sei es nur nach
dem weiblichen Geschlecht Vorkommen. So wenig man auf die Erfahrung,',dass
die weiblichen Scolia, Tiphia, Mysine u. s. w. geflügelt sind, den Schluss basiren
kann, auch die Weibchen von Ihynnus und Mutilla müssten Flügel haben, oder
die Gattung Boreus könne nicht zu den Panorpiden gehören, ; weil sie abweichend
von den übrigen Gattungen der Flügel entbehre, so wenig dürfte auch die Folgerung
berechtigt sein, ein Formicarien-Weibchen müsse unter allen Umständen
ursprünglich Flügel besitzen. Dichthadia ist eben nach allen übrigen Charakteren
ein Ameisen- (Doryliden-) Weibchen;. es entbehrt der Flügel offenbar nur deshalb,
weil es derselben seiner Lebensweise nach zu keiner Zeit bedarf. — Abweichend
von We s two o d , welcher bei seiner Ansicht, ein Doryliden-Weibchen müsse
geflügelt sein, Dichthadia nicht für ein solches zu halten scheint — während er
sonst gleich Smi th ein fortpflanzungsfähiges Hymenopteren-Weibchen („large femdle“)
darin nicht verkennt — aeceptirt Ma y r (Verhandl. d. zoolog.-botan. Gesellsch.
XIII. p. 407) zwar ohne Weiteres die Doryliden-Natur der genannten Gattung,
spricht sie aber seinerseits wieder nicht für ein Weibchen, sondern wegen der
Thoraxbildung und des Mangels der Augen für eine Arbeiterform an, indem er
nicht einsieht, warum „ein etwas grösserer Hinterleib" ein Weibchen charakterisiren
solle; in den Formicinen der Novara-Reise (p. 17) führt er die Gattung Dichthadia
sogar ohne Weiteres als Arbeiterform auf. Gegen die an ersterem Ort vom
Verfasser geltend gemachten Gründe ist nun zunächst zu erwidern, dass eine Ueberein-
stimmung in der Thoraxbildung zwischen Dichthadia und einer Arbeiter-Ameise
überhaupt nur in so fern vorhanden ist, als beiden die Flügel abgehen. Im
Uebrigen weicht Dichthadia, wie besonders aus der von mir gegebenen Profil-
Abbildung ihres Thorax (Stett. Entom. Zeit. XXIV. Taf. I. Fig. 2d) leicht zu ersehen
ist, von den Arbeiter-Ameisen sehr wesentlich durch die geringere Längsentwickelung
des Pronotum, das dadurch in weiterer Ausdehnung freiliegende Mesonotum, durch
die Grösse und Form des zweiten Thoraxstigma’s, endlich aber auch und ganz
besonders (Taf. I. Fig. 2) durch den seitlich nicht comprimirten Brustkasten ab.
Alle diese Eigenschaften sprechen nun ebenso entschieden gegen eine Arbeiterform
wie für ein Weibchen, geben sich aber allerdings den geflügelten Ameisen-Weibchen
gegenüber als — eben durch den Mangel der Flügel — nicht unwesentlich modificirt
zu erkennen. Was zweitens den Mangel der Augen betrifft, so versteht es sich
wohl ganz von selbst," dass dieser in keiner Weise für die Arbeiter-Natur des
Thieres den Ausschlag geben kann: und den Hinterleib von Dichthadia auch nur
nach der davon gegebenen Abbildung als „einen etwas grösseren“ zu bezeichnen,
muss angesichts seiner enormen Entwickelung — er hat etwa den vier- bis fünffachen
Cubikinhalt des ganzen Vorderkörpers — geradezu als absurd erscheinen.
Als ich der Dichthadia glaberrima zuerst ansichtig wurde, frappirte mich zuvörderst
und vor Allem die habituelle Aehnlichkeit mit einem Termitenweibchen, und dieser
Eindruck konnte bei der völlig abweichenden Bildung aller übrigen Körpertheile
eben nur auf der ungewöhnlichen Grössenentwickelung des Hinterleibes beruhen;
mag dieselbe derjenigen einer Termitenkönigin gegenüber gleich noch gering sein
so musste sie doch im Vergleich mit allen übrigen Insektenwerbchen immerhin im
höchsten Grade auffallend erseheinen. Nichts wäre mir damals unglaublicher
erschienen, als dass bei diesem Maasse von Hinterleibsentwickelung die Weibchen-
Natur jener Insektenform von irgend Jemand hätte in Zweifel gezogen werden
können, und nur daraus kann ich es mi r : nachträglich erklären, dass ich nicht sofort
durch Oeffnung der Bauchhöhle die Anwesenheit umfangreicher Ovarien eonstatirte.
Es gereicht mir daher zu um so grösserer Genugthuung, gegenwärtig das damals
Versäumte nachholen und alle Zweifel über die Geschlechtsnatur der Dichthadia
für immer beseitigen zu können. Nach mehrfachen vergeblichen Bemühungen, eines
zweiten solchen Weibchens, und zwar aus demjenigen Welttheile, aus welchem
man es wohl am ersten erhoffen durfte, nämlich aus Afrika, habhaft zu werden
hat mir ein glücklicher Fund neuerdings eine zweite Dichthadia- Art zügeführt,
freilich auch diesmal in einer Weise, welche keinerlei Auskunft oder Anhalt
über die Lebensweise, resp. über die Beziehungen derselben zu Dorylus oder
Typhlopone gewährt. Dieses zweite, mit einigen Orthopteren zusammen in ein
Spiritusglas geworfene, wahrscheinlich also ebenso beiläufig wie diese aufgegriffene
Weibchen, welches mit Dichth. glaberrima in allen wesentlichen Gattungsmerkmalen
übereinstimmte, bot eine mindestens -ebenso bedeutende Längsentwickelung des
Hinterleibes,, welcher überdies mehr parallel und mit einem abweichend geformten
Endsegment versehen war, dar und forderte daher zu einer sofortigen
Untersuchung seiner Eingeweide auf. Sogleich der erste Einschnitt in die
zwischen Dorsal- und Ventralplätten befindliche Bindehaut liess den mit voller
Sicherheit erwarteten Sachverhalt leicht erkennen: es trat dabei sofort ein Theil
des Ovariums der betreffenden Seite zu Tage. Eine völlige Exenterirung der
Bauchhöhle ergab sodann, dass dieselbe ihrer ganzen Länge nach von den sehr
umfangreichen Ovarien ausgefüllt war und dass diese gegen ihr hinteres Ende bin
zahlreiche legereife Eier beherbergten. Letztere maassen bei 0,10 mill. in der Breite
0,32 mill. in der Länge, zeigten also etwa die Form der langstreckigen Eier von
Stratiomys, Sarcophaga und anderen Dipteren; gegen das vordere Ende der Eiröhren
hin gingen sie allmählig bis auf 0,20 mill. Länge bei einer verhältnissmässig
grösseren Breite herab. Die Gesammtzahl der in den Ovarien enthaltenen Eier
genau zu bestimmen, hielt bei ihrer Menge sehr schwer; so viel ist jedoch sicher,
dass sie sich auf mehrere hundert, wo nicht gar auf nahe an tausend veranschlagen
lässt.