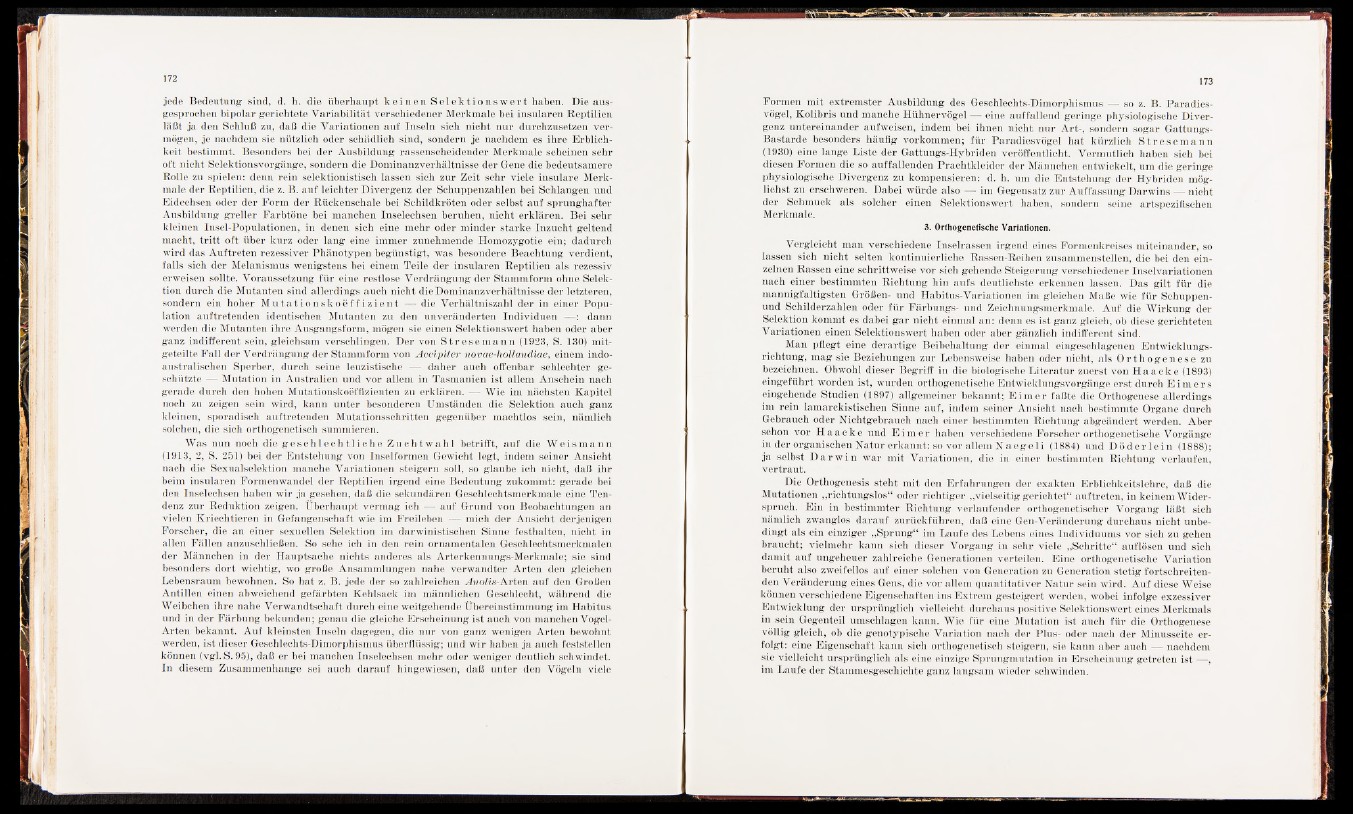
jede Bedeutung sind, d. h. die ü b e rh au p t k e i n e n S e l e k t i o n s w e r t haben. Die au sgesprochen
bipolar g e rich te te V a r ia b ilitä t verschiedener Merkmale bei in su la ren Reptilien
lä ß t ja den Schluß zu, daß die V a ria tio n en a u f In se ln sich n ich t n u r durchzusetzen v e r mögen,
je nachdem sie nützlich oder schädlich sind, sonde rn je nachdem es ih re E rb lic h k
e it bestimmt. Besonders bei d e r A usbildung rassensche idender Merkmale scheinen sehr
oft nich t Selektionsvorgänge, sonde rn die Dominanzverhältnisse d e r Gene die bedeutsamere
Rolle zu spielen: denn re in selektionistisch lassen sich zu r Zeit seh r viele in su la re Merkmale
d e r Reptilien, die z. B. a u f le ich te r Divergenz d e r Schuppenzahlen bei Schlangen und
Eidechsen oder der Fo rm d e r Rückenschale bei S childkröten oder selbst a u f sp ru n g h a fte r
Ausbildung g re lle r F a rb tö n e bei manchen Inselechsen beruhen, n ic h t e rk lä re n . Bei sehr
kleinen Insel-Populationen, in denen sich eine meh r oder m in d e r s ta rk e In zu ch t geltend
macht, t r i t t oft üb e r k u rz oder lan g eine immer zunehmende Homozygotie ein; dad u rch
w ird das A u ftre ten rezessiver P h än o ty p en begün stig t, was besondere Be achtung verd ien t,
fa lls sich der Melanismus wenigstens bei einem Teile d e r in su la ren R e p tilien als rezessiv
erweisen sollte. Voraussetzung fü r eine restlose V e rd rä n g u n g d e r S tammform ohne Selektio
n durch die Mutan ten sind a lle rd in g s au ch n ich t die Dominanzverhältnisse der letzteren,
sondern ein hoher M u t a t i o n s k o e f f i z i e n t — die V e rh ä ltn isz ah l der in ein e r P o p u lation
au ftre ten d e n identischen M u tan ten zu den u n v e rän d e rten In d iv id u e n — : dan n
werden die Mutan ten ih re Ausgangsform, mögen sie einen S elektionswe rt haben oder ab e r
ganz indiffe ren t sein, gleichsam verschlingen. Der von S t r e s e m a n n (1923, S. 130) m itgeteilte
F a ll d e r V e rd rä n g u n g der S tammform von Accipiter novae-hollandiae, einem indoa
u s tra lisch en Sperber, durch seine leuzistische —- d ah e r auch offenbar schlechter geschützte
***- Muta tion in A u s tra lien und v o r allem in T asmanien is t allem Anschein nach
g e rad e durch den hohen Muta tionskoeffizienten zu e rk lä re n . — Wie im n ächsten K ap ite l
noch zu zeigen sein wird, k an n u n te r besonderen Umständen die Selektion au ch ganz
kleinen, sporadisch au ftre ten d e n M u ta tio n ssch ritten gegenüber machtlos sein, nämlich
solchen, die sich orthogenetisch summieren.
Was n u n noch die g e s c h l e c h t l i c h e Z u c h t w a h l betrifft, a u f die W e i s m a n n
(1913, 2, S. 251) bei d e r E n ts teh u n g von In selformen Gewicht legt, indem se iner Ansicht
nach die Sexualselektion manche V a ria tio n en ste ig e rn soll, so g laube ich nicht, daß ih r
beim in su la ren Formenwandel d e r R e p tilien irg en d eine Bedeutung zukommt: g e rad e bei
den Inselechsen haben w ir ja gesehen, daß die sek u n d ä ren Geschlechtsmerkmale eine Tendenz
zu r Reduktion zeigen. Ü b e rh au p t v e rm ag ich — a u f Grund von Beobachtungen an
vielen K rie ch tie ren in Gefangenschaft wie im Fre ileb en — mich d e r A nsicht d erjenigen
F orscher, die a n ein e r sexuellen Selektion im darwinistischen Sinne festh a lten , n ich t in
allen F ä llen anzuschließen. So sehe ich in den re in ornam en ta len Geschlechtsmerkmalen
d e r Männchen in d e r H au p tsa ch e nich ts anderes als Arterkennungs-Merkmale; sie sind
besonders d o rt wichtig, wo g roße Ansammlungen nahe v e rw an d te r A rte n den gleichen
Lebensraum bewohnen. So h a t z. B. jede d e r so zahlreichen Anolis-Arten a u f den Großen
An tillen einen abweichend g e fä rb ten Kehlsack im männlichen Geschlecht, während die
Weibchen ih re nah e Ve rw an d tsch a ft d u rch eine weitgehende Übereinstimmung im H ab itu s
und in der F ä rb u n g bekunden; genau die gleiche E rsch e in u n g is t auch von manchen Vogel-
A rten bekannt. A u f kleinsten Inseln dagegen, die n u r von ganz wenigen A rten bewohnt
werden, ist dieser Geschlechts-Dimorphismus überflüssig; und w ir haben ja auch feststellen
können (vgl. S. 95), daß er bei manchen Inselechsen meh r oder weniger deutlich schwindet.
In diesem Zusammenhänge sei auch d a ra u f hingewiesen, daß u n te r den Vögeln viele
F ormen m it ex trem ste r Ausbildung des Geschlechts-Dimorphismus — so z. B. P a ra d ie s vögel,
K o lib ris u n d manche Hühnervögel — eine auffa llen d g e rin g e physiologische D iv e rgenz
u n te re in a n d e r aufweisen, indem bei ihnen n ich t n u r Art-, sonde rn soga r Gattungs-
B a sta rd e besonders häufig Vorkommen; fü r P a rad ie sv ö g e l h a t kürzlich S t r e s e m a n n
(1930) eine lan g e L iste d e r G a ttungs-Hybriden veröffentlicht. Ve rm u tlich hab en sich bei
diesen Fo rm en die so au ffa llenden P ra c h tk le id e r der Männchen entwickelt, um die geringe
physiologische Divergenz zu kompensieren: d. h. um die E n ts teh u n g d e r Hyb rid en möglich
st zu erschweren. Dabei w ürde also — im Gegensatz zu r A u ffassung Da rw in s n ich t
d e r Schmuck als solcher einen Selektionswe rt haben, sondern seine artspezifischen
Merkmale.
3. Orthogenetische Variationen.
Vergleicht man verschiedene In se lra ssen irgend eines Formenkreises mite in an d e r, so
lassen sich n ic h t selten k o n tin u ie rlich e Rassen-Reihen zusammenstellen, die bei den e in zelnen
Rassen eine schrittweise v o r sich gehende S te ig e ru n g verschiedener In se lv a ria tio n en
nach ein e r bestimmten R ich tu n g h in au fs deutlichste e rkennen lassen. Das g ilt fü r die
m an n ig fa ltig s ten Größen- u n d H ab itu s-V a ria tio n en im gleichen Maße wie fü r Schuppen -
u n d Schilderzahlen oder fü r F ä rb u n g s- u n d Zeichnungsmerkmale. Auf die W irk u n g der
Selektion kommt es dabei g a r n ic h t einmal an: den n es is t ganz gleich, ob diese g e richteten
V a ria tio n en einen Selektionswe rt haben oder ab e r gänzlich indifferent sind.
Man pflegt eine d e ra rtig e B e ibehaltung d e r einmal eingeschlagenen E ntw ick lu n g srich
tu n g , m ag sie Beziehungen zu r Lebensweise h aben oder nicht, a ls O r t h o g e n e s e zu
bezeichnen. Obwohl dieser Begriff in die biologische L ite r a tu r zu e rst von H a a c k e (1893)
e in g e fü h rt worden ist, wurden orthogenetische E ntw icklungsvorgänge e rs t d urch E i m e r s
eingehende S tu d ien (1897) allgemeiner bekannt; E i m e r fa ß te die Orthogenese alle rd in g s
im re in lama rck istisch en Sinne au f, indem se iner A nsicht nach bestimmte Organe durch
Gebrauch oder N ichtgebrauch nach ein e r b e stimmten R ich tu n g ab g e än d e rt werden. Aber
schon v o r H a a c k e und E i m e r haben verschiedene Fo rsch e r orthogenetische Vorgänge
in der organischen N a tu r e rk an n t: so v o r allem N a e g e 1 i (1884) u n d D ö d e r l e i n (1888);
ja selbst D a r w i n w a r m it V a ria tio n en , die in einer bestimmten R ich tu n g verlau fen ,
v e rtra u t.
Die Orthogenesis s te h t m it den E rfa h ru n g e n d e r exakten E rblich k e itsleh re , d aß die
Muta tionen „ richtungslos“ oder r ic h tig e r „v ielseitig g e ric h te t“ au ftre ten , in keinem W id e rspruch.
E in in b e stimmter R ich tu n g v e rlau fe n d e r orthogenetisch e r Vorgang lä ß t sich
nämlich zwanglos d a ra u f zu rü ck fü h ren , daß eine Gen-Veränderung du rch au s n ich t un b e d
in g t a ls ein einziger „S p ru n g “ im L au fe des Lebens eines In d iv id u um s v o r sich zu gehen
b rau ch t; vie lm eh r k a n n sich dieser Vo rg an g in sehr viele „S c h ritte “ auflösen u n d sich
d am it a u f u ngeheuer zahlreiche Generationen verte ilen . E in e orthogenetische V a ria tio n
b e ru h t also zweifellos a u f einer solchen von Generation zu Generation ste tig fo rtsch re iten den
V e rän d e ru n g eines Gens, die vor allem q u a n tita tiv e r N a tu r sein wird. A u f diese Weise
können verschiedene E igenschaften ins E x trem g e ste ig e rt werden, wobei infolge exzessiver
E ntw ick lu n g d e r u rsp rü n g lich vielleicht d u rch au s positive S elektionswe rt eines Merkmals
in sein Gegenteil Umschlägen kan n . Wie fü r eine Muta tion is t au ch fü r die Orthogenese
völlig gleich, ob die genotypische V a ria tio n nach der Plus- oder n a ch der Minusseite e r folgt:
eine E ig en sch a ft k a n n sich orthogenetisch ste ige rn, sie k a n n a b e r au ch — nachdem
sie vielleicht u rsp rü n g lich als eine einzige S p ru n gm u ta tio n in E rsch e in u n g g e tre ten is t —-+
im L au fe d e r Stammesgeschichte ganz langsam wieder schwinden.