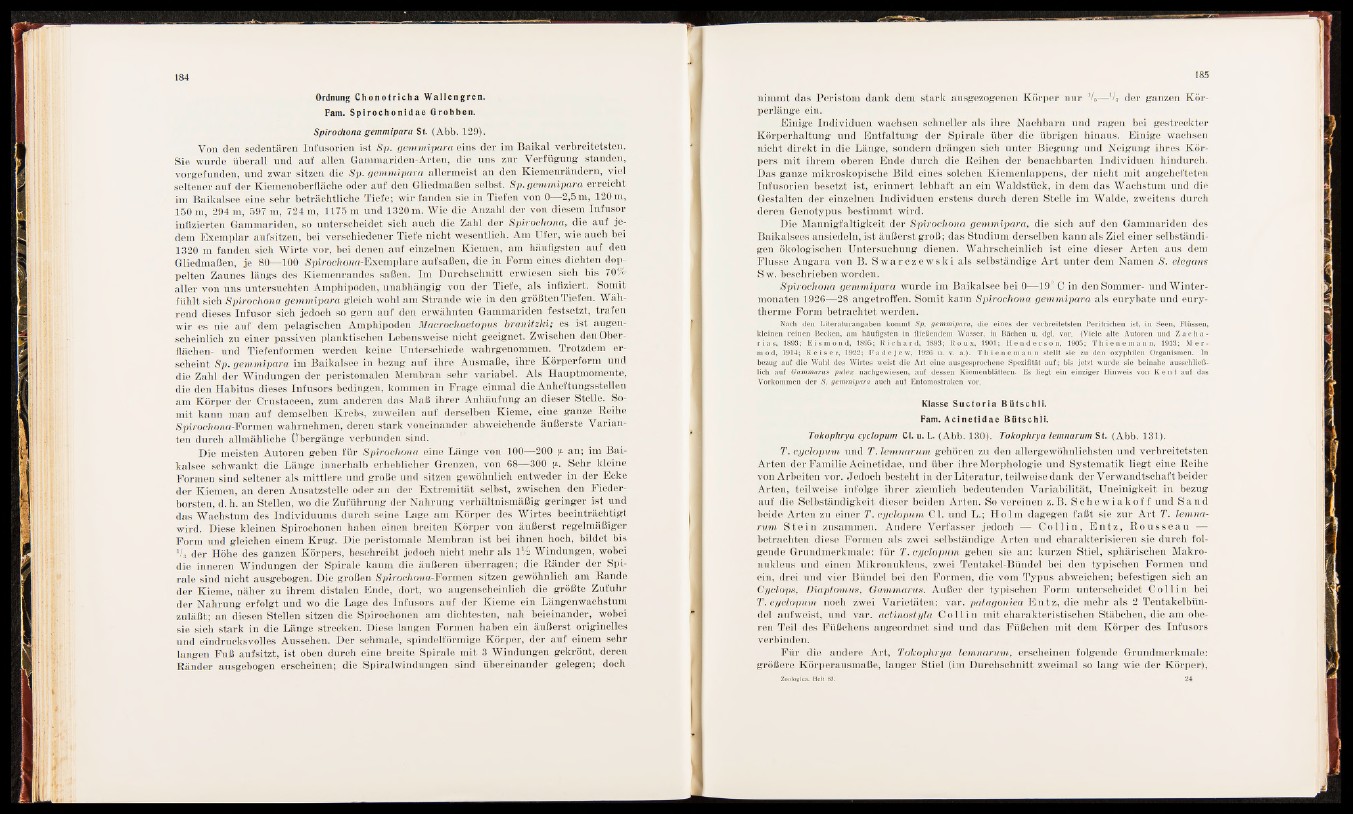
Ordnung Chono tr ich a Wallengren.
Fam. S p ir o ch o n id a e Grobben.
Spirochona gemmipara St. (Abb. 129).
Von den sed en tä ren In fu so rien is t Sp. gemmipara eins d e r im B a ik a l v e rb re ite tsten .
Sie w urde ü b e ra ll u n d a u f allen Gamm a rid en -A rten , die u n s zu r V e rfü g u n g standen,
vorgefunden, und zwar sitzen die Sp. gemmipara a lle rm e ist a n den K iem en rän d e rn , viel
se ltener a u f d e r Kiemenoberfläche oder a u f den Gliedmaßen selbst. Sp. gemmipara e rre ic h t
im Ba ika lsee eine sehr b e trä ch tlich e Tiefe; w ir fanden sie in Tie fen von 0—2,5 m, 120 m,
150 m, 294 m, 597 m, 724 m, 1175 m u n d 1320 m. Wie die Anzahl d e r von diesem In fu so r
infizierten Gammariden, so u n te rsch e id e t sich auch die Z ahl d e r Spirochona, die a u f je dem
E x em p la r a u f sitzen, bei v erschiedener Tiefe n ic h t wesentlich. Am Ufe r, wie auch bei
1320 m fanden sich W irte vor, bei denen a u f einzelnen Kiemen, am häufigsten a u f den
Gliedmaßen, je 80—100 Spirochona-E x em p la re aufsaßen, die in F o rm eines dichten doppelten
Zaunes län g s des Kiemenrandes saßen. Im D u rch sch n itt erwiesen sich bis 70%'
a lle r von u n s u n te rsu ch ten Amphipoden, u n ab h än g ig von d e r Tiefe, a ls infiziert. Somit
fü h lt sich Spirochona gemmipara gleich wohl am S tra n d e wie in den g rö ß ten Tiefen. W ä h ren
d dieses In fu so r sich jedoch so g e rn a u f den e rw äh n ten Gammariden festsetzt, tra fe n
wir es nie a u f dem pelagischen Amphipoden Macrochaetopus branitzki; es is t au genscheinlich
zu ein e r p assiven plan k tisch en Lebensweise n ich t geeignet. Zwischen den Oberflächen
u n d T ie fenformen werden keine Un terschiede wahrgenommen. Trotzdem e rscheint
Sp. gemmipara im Ba ika lsee in bezug a u f ih re Ausmaße, ih re K ö rp e rfo rm u n d
die Zahl d e r W in dungen d e r pe ristom a len Membran seh r v a riab e l. Als Hauptmomente,
die den H ab itu s dieses In fu so rs bedingen, kommen in F ra g e einmal die Anheftungsstellen
am K ö rp e r der Crustaceen, zum an d e ren das Maß ih re r A n h äu fu n g an dieser Stelle. Som
it k a n n man a u f demselben Krebs, zuweilen a u f derselben Kieme, eine ganze Reihe
Spirochona-Fo rm en wahrnehmen, deren s ta rk v o n einander abweichende ä u ß e rste V a r ia n te
n d u rch a llmähliche Übergänge v e rb u n d en sind.
Die meisten A u to ren geben fü r Spirochona eine L änge von 100—200 ^ an ; im B a ikalsee
schwankt die L änge in n e rh a lb e rheblicher Grenzen, von 68—300 ja. S ehr kleine
Fo rm en sind se ltener als m ittle re u n d gro ß e und sitzen gewöhnlich entweder in d e r Ecke
de r Kiemen, a n d eren Ansatzstelle oder a n d e r E x trem itä t selbst, zwischen den F ie d e rborsten,
d.h. an Stellen, wo die Z u fü h ru n g d e r N ah ru n g v e rh ä ltn ism äß ig g e rin g e r is t u n d
das Wach stum des In d iv id u um s d urch seine Lage am K ö rp e r des W irte s b e e in trä ch tig t
wird. Diese k leinen Spirochonen haben einen b re iten K ö rp e r von ä u ß e rs t regelmäßiger
F o rm u n d gleichen einem K ru g . Die p e ristomale Membran is t bei ih n en hoch, bild e t bis
V3 der Höhe des ganzen K ö rp e rs, beschre ibt jedoch n ich t meh r als V h Windungen, wobei
die in n e ren Windungen d e r S p ira le k aum die äu ß e ren ü b e rra g en ; die R ä n d e r d e r S p ira
le sind n ich t ausgebogen. Die großen Spirochona-FormeTi sitzen gewöhnlich am R ande
d e r Kieme, n äh e r zu ih rem d ista len E nde, dort, wo augenscheinlich die g rö ß te Z u fu h r
d e r N a h ru n g erfolgt u n d wo die Lage des In fu so rs a u f d e r Kieme ein L ängenwachstum
zu läß t; a n diesen Stellen sitzen die Spirochonen am dichtesten, n ah b eieinander, wobei
sie sich s ta rk in die Länge strecken. Diese lan g en Fo rm en haben ein ä u ß e rs t originelles
u n d eindrucksvolles Aussehen. D e r schmale, spinde lförmige K ö rp e r, d e r a u f einem sehr
langen F u ß a u f sitzt, is t oben d urch eine b re ite S p ira le m it 3 W in dungen gekrönt, deren
R ä n d e r ausgebogen erscheinen; die S p ira lw in d u n g e n sind ü b e re in an d e r gelegen; doch
n im m t das P e ristom dan k dem s ta rk ausgezogenen K ö rp e r n u r V5—V7 d e r ganzen K ö rp
e rlän g e ein.
E in ig e In d iv id u e n wachsen schneller a ls ih re N a ch b a rn u n d ra g e n bei g e stre ck te r
K ö rp e rh a ltu n g u n d E n tfa ltu n g d e r S p ira le üb e r die ü b rig en hinaus. E in ig e wachsen
n ich t d ire k t in die Länge, sonde rn d rän g en sich u n te r Biegung u n d Neigung ih re s K ö rp
e rs m it ihrem oberen E nd e d u rch die Re ihen der ben a ch b a rten In d iv id u e n hind u rch .
Das ganze mikroskopische B ild eines solchen Kiemenlappens, d e r n ich t m it angehefteten
In fu so rien besetzt ist, e r in n e rt leb h a ft a n ein Waldstück, in dem das Wachstum und die
Gestalten d e r einzelnen In d iv id u e n ersten s d u rch deren Stelle im Walde, zweitens durch
deren Genotypus bestimmt wird.
Die M a n n ig fa ltig k e it der Spirochona gemmipara, die sich a u f den Gammariden des
Baikalsees ansiedeln, is t ä u ß e rs t gro ß ; das Stu d ium derselben k a n n als Ziel ein e r se lb stän d igen
ökologischen U n te rsu ch u n g dienen. Wahrscheinlich is t eine dieser A rten aus dem
Flusse A n g a ra von B. S w a r c z e w s k i als se lbständige A r t u n te r dem Namen S. elegans
S w. beschrieben worden.
Spirochona gemmipara wurde im Ba ika lsee bei.0—19° C in den Sommer- u n d W in te rmonaten
1926—28 angetroffen. Somit kan n Spirochona gemmipara als eu ry b a te u n d eury-
th e rm e F o rm b e tra ch te t werden.
Nach den Literaturangaben kommt Sp. gemmipara, die eines der verbreitetsten Peritrichen ist, in Seen, Flüssen,
kleinen reinen Becken, am häufigsten in fließendem Wasser, in Bächen u. dgl. vor. (Viele alte Autoren und Z a c h a r
i a s , 1893; E i sm o n d , 1895; R i c h a r d , 1893; R o u x , 1901; H e n d e r s o n , 1905; T h i e n e m a n n , 1913; Me r -
mod, 1914; K e i s e r , 1922; F a d e j e w , 1926 u. v. a.). T h i e n e m a n n stellt sie zu den oxyphilen Organismen. In
bezug auf die Wahl des Wirtes weist die Art eine ausgesprochene Spezifität auf; bis jetzt wurde sie beinahe ausschließlich
auf Gammarus pulex nachgewiesen, auf dessen Kiemenblättern. Es liegt ein einziger Hinweis von K e n t auf das
Vorkommen der 8. gemmipara auch auf Entomostraken vor.
Klasse Su c to r ia Bütschli.
Fam. Ac in e t id a e Bütschli.
Tokophrya cyclopum CI. u. L. (Abb. 130). Tokophrya lemnarum St. (Abb. 131).
T. cyclopum u n d T. lemnarum gehören zu den allergewöhnlichsten u n d v e rb re ite ts ten
A rte n d e r F am ilie Acinetidae, u n d üb e r ih re Morphologie u n d S y stem a tik lieg t eine Reihe
von A rb e iten vor. Jedoch b e steh t in d e r L ite ra tu r, teilweise dan k d e r V e rw an d tsch a ft beider
A rten , teilweise infolge ih re r ziemlich bedeutenden V a ria b ilitä t, U n e in ig k e it in bezug
a u f die Selbstän d ig k e it dieser beiden A rten . So vereinen z.B . S c h e w i a k o f f und S a n d
beide A rte n zu ein e r T. cyclopum CI. und L.; H o lm dagegen fa ß t sie zur A r t T. lemnarum
S t e i n zusammen. Andere V e rfa sse r jedoch — C o l l i n , E n t z , R o u s s e a u
be tra ch ten diese Fo rm en a ls zwei se lbständige A rten u n d c h a rak te risie ren sie d u rch folgende
Grundmerkmale: fü r T. cyclopum geben sie an: k urzen Stiel, sp h ä risch en Makronukleus
u n d einen Mikronukleus, zwei T entakel-Bündel bei den typisch en Fo rm en und
ein, d re i und v ie r Bündel bei den Formen, die vom T y pus abweichen; befestigen sich an
Cyclops, Diaptomus, Gammarus. A u ß e r der typisch en F o rm u n te rsch e id e t C o l l i n bei
T. cyclopum noch zwei V a rie tä ten : v a r. patagonica E n t z , die meh r als 2 T en tak e lb ü n del
a u f weist, und v a r. actinostyla C o l l i n m it ch a rak te ristisch e n Stäbchen, die am obere
n Teil des F üßchens an g eo rd n e t sind u n d das Fü ß ch en m it dem K ö rp e r des In fu so rs
verbinden.
F ü r die an d e re A rt, Tokophrya lemnarum, erscheinen folgende Grundmerkmale:
g rö ß e re Körpe rau smaß e , lan g e r Stie l (im D u rch sch n itt zweimal so lan g wie d e r Körper),
Zoologica. Heft 83. 2 4