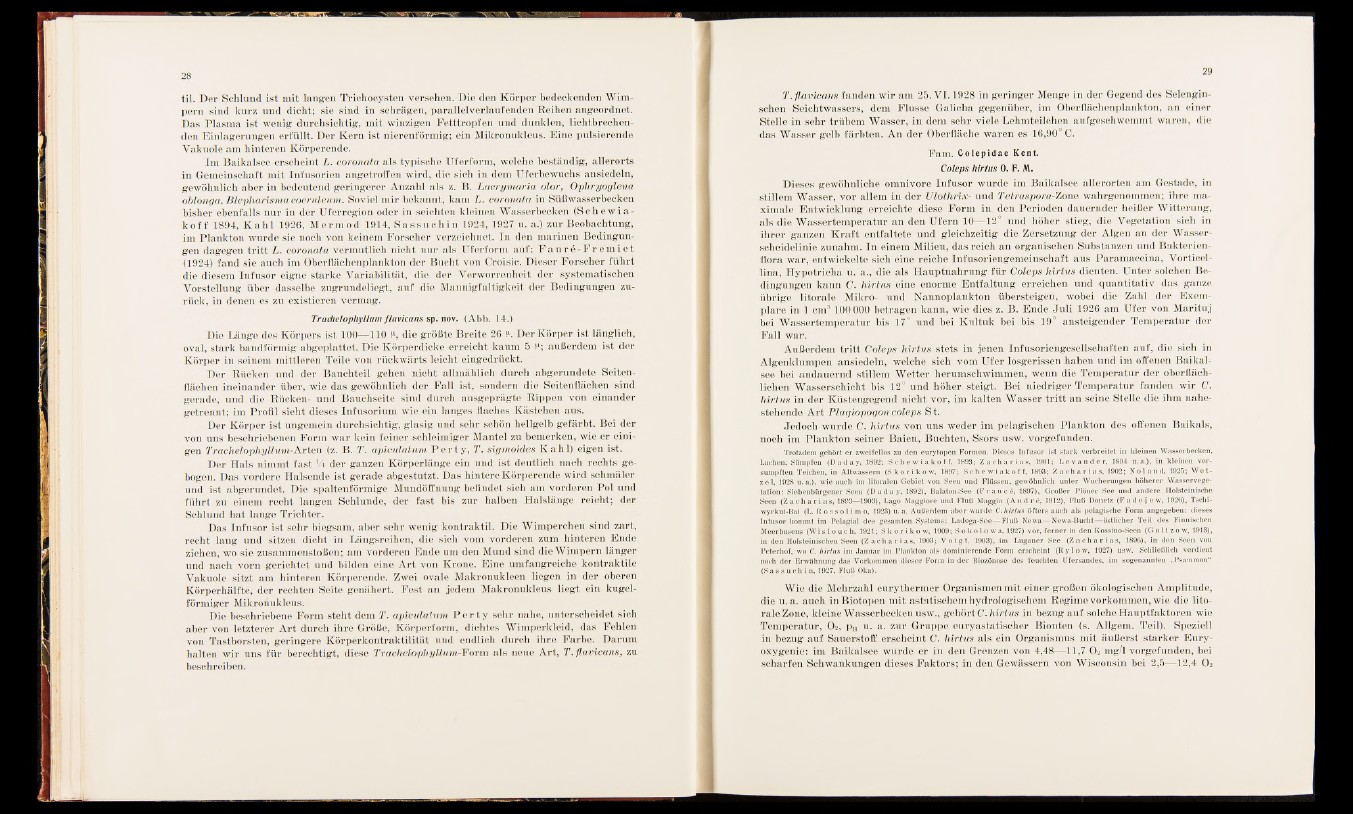
til. D e r Schlund is t m it langen T richocysten versehen. Die den K ö rp e r bedeckenden Wimp
e rn sind k u rz u n d dich t; sie sind in schrägen, p a ra lle lv e rla u fen d en Re ihen angeordnet.
Das P la sm a is t wenig d u rchsichtig, m it winzigen P e tttro p fe n u n d dunklen, lichtbre chenden
E in lag e ru n g en e rfü llt. D e r K e rn is t nierenförmig; ein Mikronukleus. E in e pulsie ren d e
Vakuole am h in te re n K ö rp e r ende.
Im Ba ika lsee e rsche int L. coronata als typische Ufe rfo rm, welche b eständig, a lle ro rts
in Gemeinschaft m it In fu so rien angetroffen wird , die sich in dem Uferbewuchs ansiedeln,
gewöhnlich ab e r in bedeutend g e rin g e re r Anzahl a ls z. B. Lacrymaria olor, Ophryoglena
oblonga, Blepharisma coeruleum. Soviel m ir bekannt, kam L. coronata in Süßwasserbecken
bishe r ebenfalls n u r in d e r U fe rreg io n oder in seichten kleinen Wasserbecken ( S c h e w i a -
k o f f 1894, K a h l 1926, M e r m o d 1914, S a s s u c h i n 1924, 1927 u. a.) zu r Beobachtung,
im P lan k to n wurde sie noch von keinem F o rsch e r verzeichnet. In den m a rin en Bed in g u n gen
dagegen t r i t t L. coronata v e rm u tlich n ic h t n u r a ls U fe rfo rm au f: F a u r e - F r e m i e t
(1924) fan d sie auch im Oberflächenplankton d e r Bucht von Croisic. Dieser F o rs ch e r fü h r t
die diesem In fu so r eigne s ta rk e V a ria b ilitä t, die d e r V e rw o rren h e it d e r systematischen
Vorstellung üb e r dasselbe zugrundeliegt, a u f die M an n ig fa ltig k e it d e r Bedingungen zurü
ck , in denen es zu ex istie ren vermag.
Tradielophyllum ftavicans sp. nov. (Abb. 14.)
Die Länge des K ö rp e rs is t 100—110 H, die g rö ß te B re ite 26 K Der K ö rp e r is t länglich,
oval, s ta rk ban d fö rm ig ab g ep la tte t. Die K ö rp e rd ick e e rre ic h t k aum 5 auß e rd em is t der
K ö rp e r in seinem m ittle ren Teile von rü c kw ä rts leich t e ingedrückt.
D e r Rücken und d e r Bau ch te il gehen n ic h t allmäh lich d u rch ab g e ru n d e te Seitenflächen
in e in an d e r über, wie das gewöhnlich d e r F a ll ist, sonde rn die Seitenflächen sind
g erade, u n d die Rücken- u n d Bauchseite sind durch au sg ep rä g te R ip p en von einander
g e tre n n t; im Pro fil sieht dieses In fu so rium wie ein langes flaches Kästch en aus.
D e r K ö rp e r is t ungemein d urchsichtig, gla sig u n d seh r schön hellgelb g e fä rb t. Be i der
von uns beschriebenen F o rm w a r ke in fe in e r schleimiger Mantel zu bemerken, wie e r e in igen
Trachelophyllum-Arten (z. B. T. apiculatum P e r t y , T. sigmoides K a h l ) eigen ist.
De r Ha ls n im m t fa s t 2Ä d e r ganzen K ö rp e rlä n g e ein u n d is t deutlich n a ch re ch ts gebogen.
Das v o rd e re Halsende is t g e rade abgestutzt. Das h in te re K ö rp e ren d e w ird schmäler
un d is t ab g erundet. Die spa ltenförmige Mundöffnung befindet sich am vord e ren P o l und
fü h r t zu einem re c h t langen Schlunde, d e r fa s t bis zu r halben Halslän g e re ich t; der
Schlund h a t lan g e T rich te r.
Das In fu so r is t sehr biegsam, ab e r seh r wenig k o n tra k til. Die W imperchen sind za rt,
re c h t lan g u n d sitzen d ich t in L än gsreihen, die sich vom vord e ren zum h in te re n E nd e
ziehen, wo sie zusammenstoßen; am vord e ren E nd e um den Mund sind die W im p e rn län g e r
und nach v o rn g e ric h te t und bilden eine A r t von Krone. E in e umfan g re ich e k o n tra k tile
Vakuole sitz t am h in te ren K ö rp e r ende. Zwei ovale Makronukleen liegen in d e r oberen
K ö rp e rh ä lfte , d e r re ch ten Seite gen äh e rt. F e st a n jedem Makronukleus lieg t ein k ugelförm
ig e r Mikronukleus.
Die beschriebene F o rm s te h t dem T. apiculatum P e r t y sehr nahe, u n te rsch e id e t sich
ab e r von le tz te re r A r t d urch ih re Größe, K ö rp e rfo rm , dichtes Wimperkleid, das F ehlen
von T a stborsten, g e rin g e re K ö rp e rk o n tra k tilitä t und endlich durch ih re F a rb e . D a rum
h a lten w ir uns fü r berechtigt, diese Trachelophyllum-Form als neue A rt, T. ftavicans, zu
beschreiben.
T. ftavicans fan d en w ir am 25. V I. 1928 in g e rin g e r Menge in d e r Gegend des Selengin-
schen Seichtwassers, dem F lusse Galicha gegenüber, im Oberflächenplankton, a n einer
Stelle in seh r trü b em Wasser, in dem seh r viele Lehmteilchen aufgeschwemmt waren, die
das Wasser gelb fä rb ten . An d e r Oberfläche w a ren es 16,90° C.
Farn. Colepidae Kent.
Coleps hirtus 0. F. M.
Dieses gewöhnliche omnivore In fu so r w u rd e im Ba ika lsee a lle ro rten am Gestade, in
stillem Wasser, v o r allem in d e r Ulothrix- und Tetraspora-Zone wahrgenommen; ih re m a x
im a le E n tw ick lu n g e rre ic h te diese F o rm in. den Perio d en d a u e rn d e r h e iß e r W itte ru n g ,
als die W a s se rtem p e ra tu r an den U fe rn Ub-^120 u n d höher stieg, die Vegetation sich in
ih re r ganzen K r a f t en tfa lte te u n d gleichzeitig die Zersetzung d e r Algen an d e r W a s se rscheidelinie
zunahm. In einem Milieu, das reich an o rganischen Substanz en u n d B a k te rie n flora
wa r, entwickelte sich eine reiche In fu so rien g eme in sch a ft au s P a ram a e c in a , Vorticel-
lin a , H y p o trich a u. a., die a ls H a u p tn a h ru n g fü r Coleps hirtus dienten. U n te r solchen Bedingungen
k a n n C. hirtus eine enorme E n tfa ltu n g erre ich en u n d q u a n tita tiv das ganze
ü b rig e lito ra le Mikro- u n d Nan n o p lan k to n übersteigen, wobei die Zahl der E xemp
la re in 1 cm3 100 000 b e trag en k an n , wie dies z. B. E nd e J u l i 1926 am U fe r von M a ritu j
bei W a s se rtem p e ra tu r bis 17° u n d bei K u ltu k bei bis 19° anste ig en d e r T em p e ra tu r der
F a ll war.
Außerdem t r i t t Coleps hirtus ste ts in jen en In fusorienge sellschaften au f, die sich in
Algenklumpen ansiedeln, welche sich vom U fe r losgerissen h aben u n d im offenen B a ik a lsee
bei an d a u e rn d stillem W e tte r herumschwimmen, wenn die T em p e ra tu r d e r oberflächlichen
Wasserschicht bis 12° u n d höher ste igt. Bei n ied rig e r T em p e ra tu r fan d en w ir C.
hirtus in der Küstengegend n ic h t vor, im k a lte n W a sse r t r i t t an seine Stelle die ihm nah e stehende
A r t Plagiopogon coleps S t.
Jedoch w urde C. hirtus von u n s weder im pelagischen P la n k to n des offenen Ba ika ls,
noch im P lan k to n se iner Ba ien, Buchten, Ssors usw. vorgefunden.
Trotzdem g eh ö rt e r zweifellos zu d e n eury to p en Formen. Dieses In fu so r is t s ta rk v e rb re ite t in k le in en Wasserbecken,
Lachen, S ümpfen (D a d a y , 1892; S c h e w i a k o f f , 1893; Z a c h a r i a s , 1901; L e v a n d e r , 1894 u .a .) , in k le in en v e rsum
p ften Teichen, in Altwasse rn ( S k o r i k o w , 1897; S c h e w i a k o f f , .1893; Z a c h a r i a s , 1902; N o 1 a n d , 1925; W e t -
z e l , 1928 u .a .) , w ie auch im lito ra len Gebie t von S een u n d Flüssen, gewöhnlich u n te r Wucherungen h ö h e re r Wa sservegeta
tio n : S ie b en b ü rg e n e r Seen (D a d a y , 1892), Balaton-See ( F r a n e é , 1897), Gro ß er P lö n e r S ee u nd a n d e re Holsteinische
Seen ( Z a c h a r i a s , 1893—1903), Lago Maggiore u nd F lu ß Maggia ( A n d r é , 1912), F lu ß Donetz ( F a d e j e w , 1926), Tschi-
wyrkui-Bai (L. R o s s o l im o , 1923) u .a . Au ß e rd em a b e r w u rd e C.h irtu s öfters auch als pelagische Form angegeben: d ieses
In fu so r kommt im Pelagial d e s gesamten Systems: Ladoga-See— F lu ß Newa— Newa-Bucht— östlicher T eil d e s Finnischen
Meerbusens (Wi s 1 o u c h, 1921 ; S le o r i k o w, 1909 ; S o k o 1 o w a, 1927) v or, f e rn e ï in d en Kossino-Seen (G o 1 1 z o w, 1913),
in d e n Holsteinischen Seen ( Z a c h a r i a s , 1903; V o i g t , 1903), im L u g an e r S ee ( Z a c h a r i a s , 1896), in d e n Seen von
Peterh o f, wo C. hirtus im J a n u a r im Plan k to n als d om in ie ren d e Form e rsch e in t (R y l o w , 1927) usw. Schließlich v e rd ie n t
noch d e r E rw ähnung d a s Vorkommen d ie s e r Form in d e r Biozönose d e s fe u ch ten Ufersandes, im sogenannten „Psammon“
( S a s s u c h i n , 1927, F lu ß Oka).
Wie die Mehrzahl e u ry th e rm e r Organismen m it ein e r g roßen ökologischen Amplitude,
die u. a. auch in B iotopen m it a statischem hydrologischem Regime Vorkommen, wie die lito ra
le Zone, kleine Wasserbecken usw., g e h ö r te , hirtus in bezug a u f solche H a u p tfa k to re n wie
T em p e ra tu r, O2, pH u. a. zur Gruppe eu ry a sta tisch e r Bionten (s. Allgem. Teil). Speziell
in bezug a u f Sauerstoff ersch e in t C. hirtus als ein Organismus m it ä u ß e rs t s ta rk e r E u ry -
oxygenie: im Ba ika lsee w urde er in den Grenzen von 4,48—11,7 O2 mg/l vorgefunden, bei
sch a rfen Schwankungen dieses F a k to rs; in den Gewässern von Wisconsin bei 2,5—12,4 O2