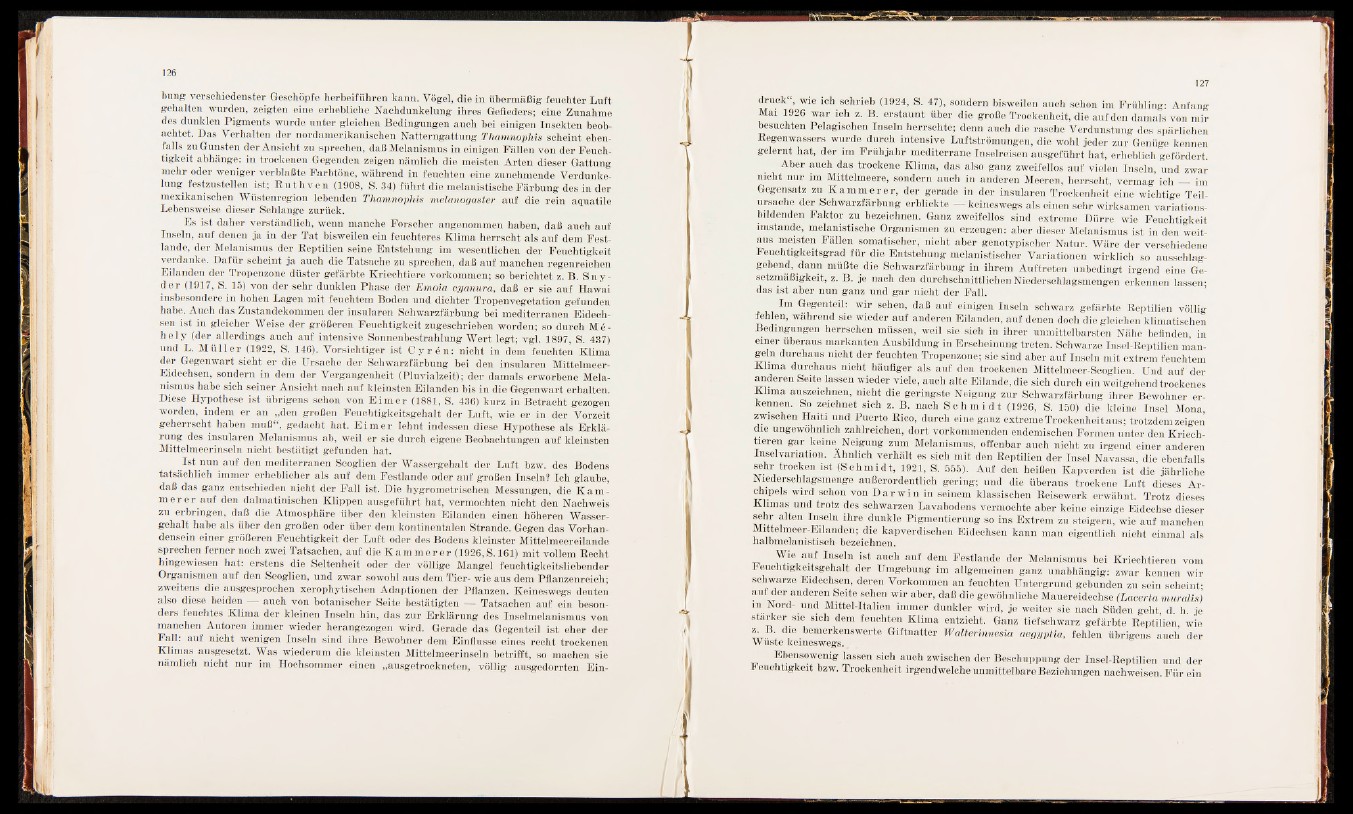
bun g v erschiedenster Geschöpfe h e rb e ifü h ren k an n . Vögel, die in ü b e rm äß ig feu ch te r L u ft
g eh a lten wurden, zeigten eine erhebliche Nachdunke lung ih re s Gefieders; eine Zunahme
des dunklen P igm en ts w urde u n te r gleichen Bedingungen au ch bei e inigen In sek ten beobachtet.
Das V e rh a lten d e r no rd am e rik an isch en N a tte rn g a ttu n g Thamnophis scheint ebenfa
lls zu Gunsten d e r An sich t zu sprechen, daß Melanismus in einigen F ä llen von d e r F euchtig
k e it abhänge: in trockenen Gegenden zeigen nämlich die meisten A rte n dieser Ga ttu n g
m eh r oder weniger v e rb laß te F a rb tö n e , wäh ren d in feuchten eine zunehmende Verd u n k e lu
n g festzustellen ist; K u t h v e n (1908, S. 34) fü h r t die melanistische F ä rb u n g des in der
mexikanischen W üstenregion lebenden Thamnophis melanogaster a u f die re in aq u a tile
Lebensweise dieser Schlange zurück.
E s is t d ah e r v e rstän d lich , wenn manche F o rsch e r angenommen haben, daß au ch a u f
Inseln, a u f denen ja in d e r T a t bisweilen ein feuchteres K lim a h e rrs c h t als a u f dem F e stlande,
d e r Melanismus d e r R e p tilien seine E n ts teh u n g im wesentlichen d e r F eu ch tig k e it
verd an k e . D a fü r scheint ja auch die T atsache zu sprechen, d aß a u f m anchen regenreichen
E ilan d e n der Tropenzone d ü ste r g e fä rb te K rie ch tie re Vorkommen; so b e rich te t z. B. S n y -
d e r (1917, S. 15) von d e r se h r du n k len P h a se d e r Emoia cyanura, daß e r sie a u f H aw a i
insbesondere in hohen Lagen m it feuchtem Boden u n d d ich te r T ro penvege ta tion gefunden
habe. Auch das Zustandekommen d e r in su la ren Schw a rz fä rb u n g bei m ed ite rran en E ide chsen
is t in gleicher Weise der g rö ß e re n F eu c h tig k e it zugeschrieben worden; so d u rch M e -
h e l y (der a lle rd in g s auch a u f in ten siv e Sonnen b e strah lu n g W e r t legt; vgl. 1897, S. 4 3 7 )
u n d L. M ü l l e r (1922, S. 146). Vorsich tig e r is t C y r e n : n ic h t in dem feuchten K lim a
der Gegenwart sieht e r die U rsa ch e d e r Sehw a rz fä rb u n g bei den in su la re n Mittelmeer-
Eidechsen, sonde rn in dem d e r V e rg an g en h e it (Pluvialze it); d e r d amals erworbene Melanismus
habe sieh se iner A n s ic h t n a ch a u f kle in sten E ilan d e n bis in die Gegenwart e rhalten.
Diese Hypothese is t üb rig en s schon von E i m e r (1881, S. 436) k u rz in B e tra c h t gezogen
worden, indem e r a n „den g roßen F eu ch tig k e itsg eh a lt d e r L u ft, wie e r in der Vorzeit
g eh e rrsch t haben m u ß “, g edacht h a t. E i m e r leh n t indessen diese Hypothese a ls E rk lä ru
n g des in su la re n Melanismus ab, weil e r sie durch eigene Beobachtungen a u f kleinsten
Mittelmeerinse ln n ic h t b e s tä tig t gefunden h a t.
I s t n u n a u f den m ed ite rran en Scoglien d e r W a sse rg eh a lt d e r L u ft bzw. des Bodens
ta tsä ch lich im m e r e rheblicher als a u f dem F e stlan d e oder a u f g ro ß en Inseln? Ic h glaube,
d aß das ganz entschieden n ic h t d e r F a ll ist. Die h y g rometrischen Messungen, die K ä m m
e r e r a u f den dalmatinischen K lip p en au sg e fü h rt h a t, vermochten n ich t den Nachweis
zu erbrin g en , daß die Atmo sp h ä re üb e r den kle in sten E ilan d e n einen h öheren W a sse rg
eh a lt hab e als ü b e r den g roßen oder üb e r dem k o n tin en ta len S tra n d e . Gegen das V o rh an densein
ein e r g rö ß e re n F eu ch tig k e it d e r L u ft oder des Bodens k le in ste r Mittelmeereilande
sprechen fe rn e r noch zwei Tatsachen, a u f die K ä m m e r e r (1926,S.161) m it vollem Re cht
hingewiesen h a t: erstens die Selten h e it oder d e r völlige Mangel feu chtigkeitsliebender
Organismen a u f den Scoglien, u n d zwar sowohl aus dem Tie r- wie au s dem Pflanzenreich;
zweitens die ausgesprochen xerop h y tisch en A d aptionen d e r Pflanzen. Keineswegs deuten
also diese beiden — au ch von b o tanischer Seite b e s tä tig ten - ^ T a ts a c h e n a u f ein besonders
feuchtes K lim a der kleinen In se ln h in , das zu r E rk lä ru n g des Inselmelanismus von
manchen A u to ren im m e r wieder herangezogen wird. Gerade das Gegenteil is t eher der
F a ll: a u f n ich t wenigen In se ln sin d ih re Bewohner dem Einflüsse eines re c h t trockenen
K lim a s ausgesetzt. W a s wiederum die kleinsten Mittelmeerinse ln betrifft, so machen sie
nämlich n ich t n u r im Hochsommer einen „ausgetrockneten, völlig au sg ed o rrten E in d
ru c k “, wie ich schrieb (1924, S. 47), sonde rn bisweilen auch schon im F rü h lin g : A n fan g
Mai 1926 w a r ich z. B. e rs ta u n t ü b e r die g roße Trockenheit, die a u f den d amals von m ir
besuchten Pelagischen In se ln h e rrsch te ; denn auch die ra sch e V e rd u n stu n g des sp ä rlich en
Regenwassers wurde d u rch inten siv e L uftströmungen, die wohl jed e r zu r Genüge kennen
g e le rn t h a t, der im F rü h ja h r m ed ite rran e In se lre isen au sg e fü h rt h a t, erheblich gefö rd e rt.
Ab e r au ch das trockene Klima, das also ganz zweifellos a u f vielen Inseln, u n d zwar
n ich t n u r im Mittelmeere, sonde rn au ch in an d e ren Meeren, h e rrsch t, v e rm ag i c h im
Gegensatz zu K ä m m e r e r , d e r g erade in d e r in su la ren T rockenhe it eine wichtige Teilu
rsa ch e d e r Sehw a rz fä rb u n g erblickte — keineswegs als einen sehr wirk samen v a ria tio n s bildenden
F a k to r zu bezeichnen. Ganz zweifellos sind extreme D ü r re wie F eu ch tig k e it
imstande, melanistische Organismen zu erzeugen: ab e r dieser Melanismus is t in den w e itau
s meisten F ä lle n somatischer, n ic h t ab e r g en o ty p isch e r N a tu r. W ä re d e r verschiedene
F eu ch tig k e itsg rad f ü r die E n ts teh u n g melanistischer V a ria tio n en wirklich so ausschlaggebend,
d an n m ü ß te die Schw a rz fä rb u n g in ih rem A u ftre te n u n b ed in g t irg en d eine Gese
tzmäßigkeit, z. B. je nach den d u rch sch n ittlich en Niederschlagsmengen e rkennen lassen;
das is t ab e r n u n ganz u n d g a r n ich t d e r Fa ll.
Im Gegenteil: w ir sehen, d aß a u f einigen In se ln schwarz g e fä rb te Rep tilien völlig
fehlen, wäh ren d sie wieder a u f an d e ren E ilanden, a u f denen doch die gleichen k limatischen
Bedingungen h e rrsch en müssen, weil S e sich in ih re r u nm itte lb a rs ten Nähe befinden in
ein e r ü b e rau s m a rk a n te n A u sbildung in E rsch e in u n g tre ten . Schwarze Insel-Reptilien m an geln
d u rch au s n ich t d e r feuchten Tropenzone; sie sind ab e r a u f In se ln m it ex trem feuchtem
K lim a d u rch au s n ich t häufiger als a u f den trockenen Mittelmeer-Scoglien. Un d a u f der
an d e ren Seite lassen wieder viele, aueh a lte E ilande , die sich d urch ein weitgehend trockenes
K lim a auszeichnen, n ic h t die g e rin g ste Neigung zu r Sehw a rz fä rb u n g ih re r Bewohner e rkennen.
So zeichnet sich z. B. n a ch S c h m i d t (1926, S. 150) die kleine In se l Mona,
zwischen H a iti u n d P u e rto Rico, d u rch eine ganz extreme T rockenhe it aus; trotzdem zeigen
die ungewöhnlich zahlreichen, d o rt vorkommenden endemischen F o rm en u n te r den K rie c h tie
re n g a r keine Neigung zum Melanismus, offenbar auch n ich t zu irg en d ein e r an d e ren
In se lv a ria tio n . Ähnlich v e rh ä lt es sich m it den R e p tilien d e r In se l Navassa, die ebenfalls
seh r trocken is t ( S c h m i d t , 1921, S. 555). A u f den h eißen K ap v e rd en is t die jäh rlic h e
Niederschlagsmenge au ß e ro rd en tlich g e rin g ; u n d die ü b e rau s trockene L u ft dieses A r chipels
w ird schon von D a r w i n in seinem klassischen Reisewerk erwähnt. Trotz dieses
K lim a s u n d tro tz des schwarzen Lavabodens vermochte ab e r kein e einzige Eidechse dieser
sehr a lten In se ln ih re dunkle P igm en tie ru n g so ins E x trem zu ste ige rn, wie a u f manchen
Mittelmeer-Eilanden; die kapve rd isch en Eidechsen k a n n man eigentlich n ich t einmal als
halbmelanistisch bezeichnen.
Wie a u f In se ln is t auch a u f dem F e stlan d e d e r Melanismus bei K rie ch tie re n vom
F eu ch tig k e itsg eh a lt d e r Umgebung im allgemeinen ganz u n abhängig: zwar k ennen w ir
schwarze Eidechsen, deren Vorkommen an feuchten U n te rg ru n d gebunden zu sein scheint;
a u f d e r an d e ren Seite sehen w ir ab e r, daß die gewöhnliche Mauereidechse (Lacerta muralis)
in Nord- u n d M itte l-Ita lien immer du n k le r wird, je weiter sie n a ch Süden geht, d. h. je
s ta rk e r sie sich dem feuchten K lim a entzieht. Ganz tie f schwarz g e fä rb te R eptilien, wie ¡1118 d i e . b e m e r k e n s w e r t e G iftn a tte r Walterinnesia aegyptia, fehlen übrigens au ch der
Wüste keineswegs.
Ebensowenig lassen sich au ch zwischen d e r Beschuppung d e r In sel-Reptilien u n d der
F eu ch tig k e it bzw. T rockenhe it irgendwelche u nm itte lb a re Beziehungen nachweisen. F ü r ein