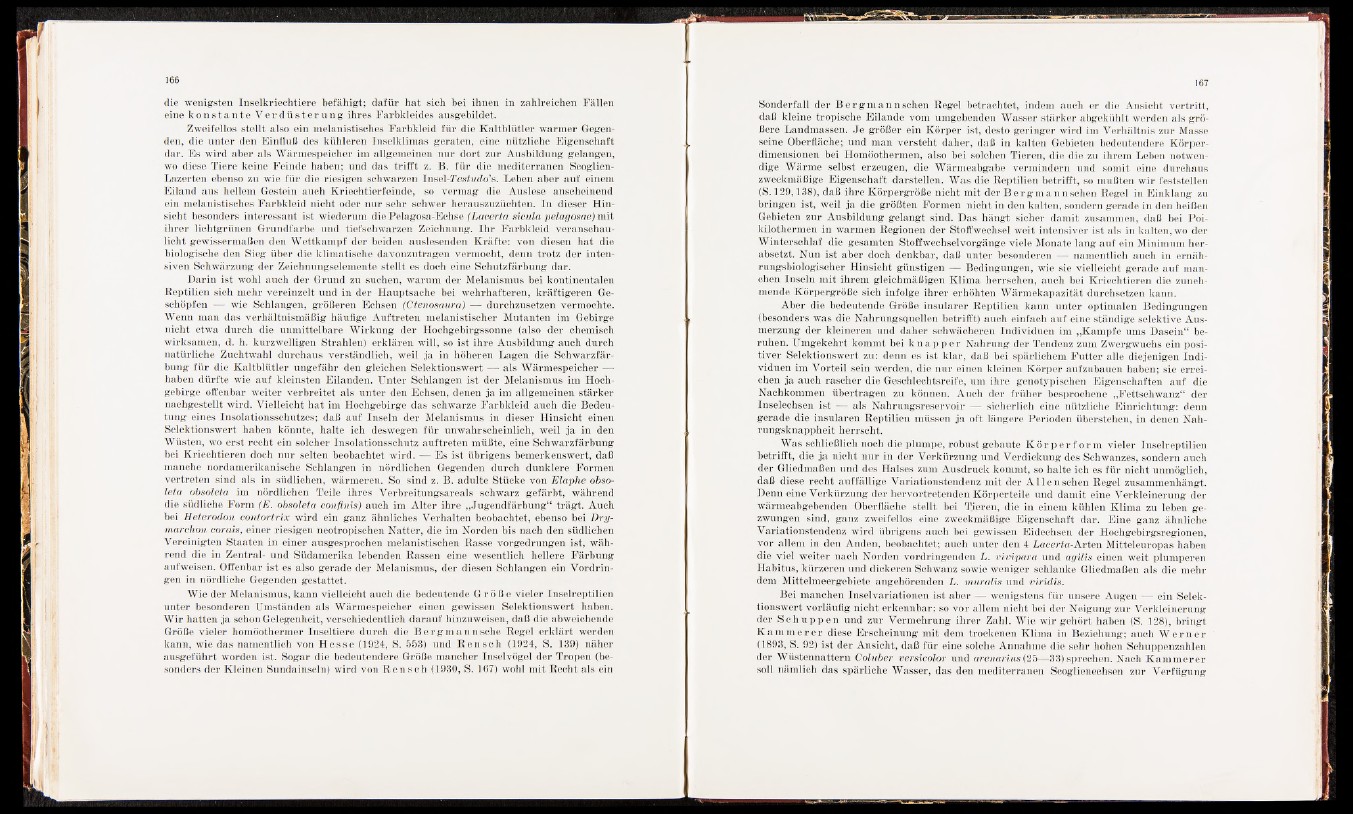
die wenigsten In se lk rie ch tie re befäh ig t; d a fü r h a t sich bei ihn en in zahlreichen F ä llen
eine k o n s t a n t e V e r d ü s t e r u n g ih re s F a rh k le id e s ausgebildet.
Zweifellos ste llt also ein melanistisches F a rb k le id fü r die K a ltb lü tle r w a rm e r Gegenden,
die u n te r den Einfluß des k ü h le ren In selklimas g e ra ten , eine nützliche E ig en sch a ft
d a r. E s wird ab e r als Wärmespe icher im allgemeinen n u r d o rt zu r Ausbildung gelangen,
wo diese T ie re keine F e in d e haben; u n d das trifft z. B. fü r die m ed ite rran en Scoglien-
L azerten ebenso zu wie fü r die rie sig en schwarzen Insel-Testudo’s. Leben ab e r a u f einem
E ilan d aus hellem Gestein auch Krie ch tie rfe in d e , so v e rm ag die Auslese anscheinend
ein melanistisches F a rb k le id n ich t oder n u r sehr schwer herauszuzüchten. In dieser H in sicht
besonders in te re ss an t is t wiederum die Pelagosa-Echse (Lacerta sicula pelagosae) m it
ih r e r lich tg rü n e n G ru n d fa rb e u n d tiefschwarzen Zeichnung. I h r F a rb k le id v e ran sc h au lich
t gewissermaßen den W e ttk am p f der beiden auslesenden K rä fte : von diesen h a t die
biologische den Sieg üb e r die k limatische d avonzutragen vermocht, denn tro tz d e r in ten siven
Schwärzung d e r Zeichnungselemente ste llt es doch eine S ch u tz fä rb u n g d a r.
D a rin is t wohl auch d e r Grund zu suchen, w a rum d e r Melanismus bei kontin en ta len
R e p tilien sich meh r vereinzelt u n d in der Hau p tsa ch e bei weh rh a fte ren , k rä ftig e re n Geschöpfen
-pfe wie Schlangen, grö ß e ren Echsen (Ctenosaura) — durchzusetzen vermochte.
Wenn man das v e rh ä ltn ism äß ig häufige A u ftre ten melanistischer Mutan ten im Gebirge
nich t etwa d urch die u nm itte lb a re W irk u n g d e r Hochgebirgssonne (also d e r chemisch
wirksamen, d. h. kurzwelligen S trahlen) e rk lä re n will, so is t ih re Ausbildung auch durch
n a tü rlic h e Zuchtwahl d u rch au s verstän d lich , weil ja in höheren L agen die S chw a rz fä rbung
fü r die K a ltb lü tle r u n g e fäh r den gleichen Selektionswe rt als Wä rmespe icher —-
haben d ü rfte wie a u f kleinsten E ilanden. U n te r Schlangen is t d e r Melanismus im Hochgebirge
offenbar weiter v e rb re ite t a ls u n te r den Echsen, denen ja im allgemeinen stä rk e r
n achgestellt wird. Vielleicht h a t im Hochgebirge das schwarze F a rb k le id auch die Bedeutu
n g eines Insolationsschutzes; daß a u f In se ln d e r Melanismus in dieser H in sic h t einen
Selektionswe rt haben könnte, h a lte ich deswegen fü r unwahrsche inlich, weil ja in den
Wüsten, wo e rst re c h t ein solcher Insolationsschutz a u f tre te n müßte, eine Schwarz fä rb u n g
bei K rie ch tie re n doch n u r selten beobachtet wird . — E s is t übrigens bemerkenswert, daß
manche n o rdamerikanische Schlangen in n ördlichen Gegenden durch dun k le re Fo rm en
v e rtre te n sind als in südlichen, wärmeren. So sind z. B. ad u lte Stücke von Elaphe obsoleta
obsoleta im nördlichen Teile ih re s V e rb re itu n g s a re a ls schwarz g e fä rb t, während
die südliche F o rm (E. obsoleta confinis) auch im A lte r ih re „ Ju g e n d fä rb u n g “ trä g t. Auch
bei Heterodon contortrix w ird ein ganz ähnliches V e rh a lten beobachtet, ebenso hei Dry-
marchon corais, einer riesigen neotropischen N a tte r, die im Norden bis nach den südlichen
Ve re in ig ten S ta a ten in ein e r ausgesprochen melanistischen Rasse vorged ru n g en ist, w äh ren
d die in Z entral- u n d S ü d am e rik a lebenden Rassen eine wesentlich hellere F ä rb u n g
aufweisen. Offenbar is t es also g e rad e d e r Melanismus, d e r diesen Schlangen ein V o rd rin gen
in nördliche Gegenden gestatte t.
Wie der Melanismus, k a n n vie lle ich t au ch die bedeutende G r ö ß e v ie le r In se lrep tilie n
u n te r besonderen Umständen als Wä rmespe icher einen gewissen Selektionswe rt haben.
W ir h a tte n ja schon Gelegenheit, verschiedentlich d a ra u f hinzuweisen, daß die abweichende
Größe v ie le r homöothermer In se ltie re d u rch die B e r g m a n n sehe Regel e rk lä rt werden
kan n , wie das n amentlich von H e s s e (1924, S. 553) und R e n s c h (1924, S. 139) n äh e r
au sg e fü h rt worden ist. S ogar die bedeutendere Größe mancher Inselvögel d e r T ropen (besonders
d e r Kleinen Sundainseln) wird von R e n s c h (1930, S. 167) wohl m it Re cht a ls ein
S o nderfall der B e r gma n n s c h e n Regel b e tra ch te t, indem auch e r die An sich t v e r tritt,
daß kleine tropische E ilan d e vom umgebenden Wasser s tä rk e r ab g ek ü h lt werden a ls g rö ß
e re Landmassen. J e g rö ß e r ein K ö rp e r ist, desto g e rin g e r w ird im V e rh ä ltn is zu r Masse
seine Oberfläche; u n d man v e rs te h t daher, daß in k a lten Gebieten bedeutendere K ö rp e rdimensionen
bei Homöothermen, also bei solchen Tie ren, die die zu ih rem Leben notwendige
W ä rm e selbst erzeugen, die Wärmeabgabe v e rm in d e rn u n d somit eine du rch au s
zweckmäßige E igenschaft d a rstellen. W a s die Rep tilien betrifft, so m u ß ten w ir feststellen
(S. 129,138), daß ih re K ö rp e rg rö ß e nich t m it d e r B e r g ma n n s c h e n Regel in E in k la n g zu
brin g en ist, weil ja die g rö ß ten F ormen n ich t in den kalten, sondern g e rad e in den heißen
Gebieten zu r A u sbildung g e lan g t sind. Das h ä n g t sicher d am it zusammen, daß bei Poi-
kiloth e rmen in warmen Regionen d e r Stoffwechsel weit in ten siv e r is t als in kalten, wo der
W in te rsch la f die gesamten Stoff Wechsel Vorgänge viele Monate lan g a u f ein Minimum h e r absetzt.
Nun is t ab e r doch denkbar, daß u n te r besonderen — n amentlich au ch in e rn ä h rungsbiologischer
H in sic h t günstig en — Bedingungen, wie sie vielleicht g e rad e a u f m an chen
In se ln m it ih rem gleichmäßigen K lim a herrschen, auch hei K rie ch tie re n die zunehmende
K ö rp e rg rö ß e sich infolge ih re r erhöhten W ä rm e k a p a z itä t durchsetzen kann.
Aber die bedeutende Größe in su la re r R e p tilien k a n n u n te r o p timalen Bedingungen
(besonders was die Nahrungsquellen betrifft) auch einfach a u f eine stän d ig e selektive Ausmerzung
d e r k le in e ren u n d d ah e r schwächeren In d iv id u e n im „Kampfe ums Dasein“ beru
h en . Umg ek eh rt kommt bei k n a p p e r N ah ru n g der Tendenz zum Zwergwuchs ein positiv
e r Selektionswe rt zu: denn es is t k la r, daß bei spä rlich em F u tte r alle d iejenigen In d iv
id u en im V o rte il sein werden, die n u r einen kleinen K ö rp e r aufzubauen haben; sie e rre ichen
ja auch ra sch e r die Geschlechtsreife, um ih re genotypischen E igenschaften a u f die
Nachkommen ü b e rtrag e n zu können. Au ch der f rü h e r besprochene „Fettschwanz“ der
Inselechsen is t — als N ah ru n g sre s e rv o ir — sicherlich eine nützliche E in rich tu n g : denn
g e rad e die in su la ren R e p tilien müssen ja oft längere P erioden überstehen, in denen N ah ru
n g sk n ap p h e it herrsch t.
W as schließlich noch die plumpe, ro b u st g ebaute K ö r p e r f o r m vie le r In se lrep tilien
betrifft, die ja n ich t n u r in d e r V e rk ü rz u n g u n d V e rdickung des Schwanzes, sondern auch
der Gliedmaßen u n d des Halses zum Ausd ru ck kommt, so h a lte ich es fü r n ich t unmöglich,
daß diese re c h t au ffä llig e Varia tio n sten d en z m it d e r A l l e n sehen Regel zusammenhängt.
Denn eine V e rk ü rzu n g d e r h e rv o rtre ten d en K ö rp e rte ile und d am it eine V e rk le in e ru n g der
wärmeabgebenden Oberfläche ste llt bei Tje ren, die in einem k ü h len K lim a zu leben gezwungen
sind, ganz zweifellos eine zweckmäßige E ig en sch a ft d a r. E in e ganz ähnliche
V a riationstendenz wird übrigens auch hei gewissen Eidechsen der Hochgebirgsregionen,
vo r allem in den Anden, beobachtet; auch u n te r den 4 Lacerta-A rte n Mitteleuropas haben
die viel weiter n a ch Norden vordrin g en d en L. vivipara u n d agilis einen weit p lumperen
Hab itu s, k ü rz e ren u n d dickeren Schwanz sowie weniger schlanke Gliedmaßen als die mehr
dem Mittelmeergehiete angehörenden L. muralis u n d viridis.
Bei manchen In se lv a ria tio n en is t ab e r — wenigstens fü r unse re Augen — ein Selektio
n swe rt vorläufig nich t e rk en n b a r: so v o r allem nich t bei d e r Neigung zu r Verk le in e ru n g
der S c h u p p e n und zur Verm eh ru n g ih re r Zahl. Wie w ir g eh ö rt haben (S. 128), b rin g t
K ä m m e r e r diese E rs ch e in u n g m it dem trockenen K lim a in Beziehung; auch W e r n e r
(1893, S. 92) is t d e r Ansicht, daß fü r eine solche Annahme die seh r hohen Schuppenzahlen
der W ü s ten n a tte rn Coluber versicolor und arenarius{25—33) sprechen. Nach Kämme r e r
soll nämlich das spä rlich e Wasser, das den m ed ite rran en Scoglienechsen zu r Verfü g u n g