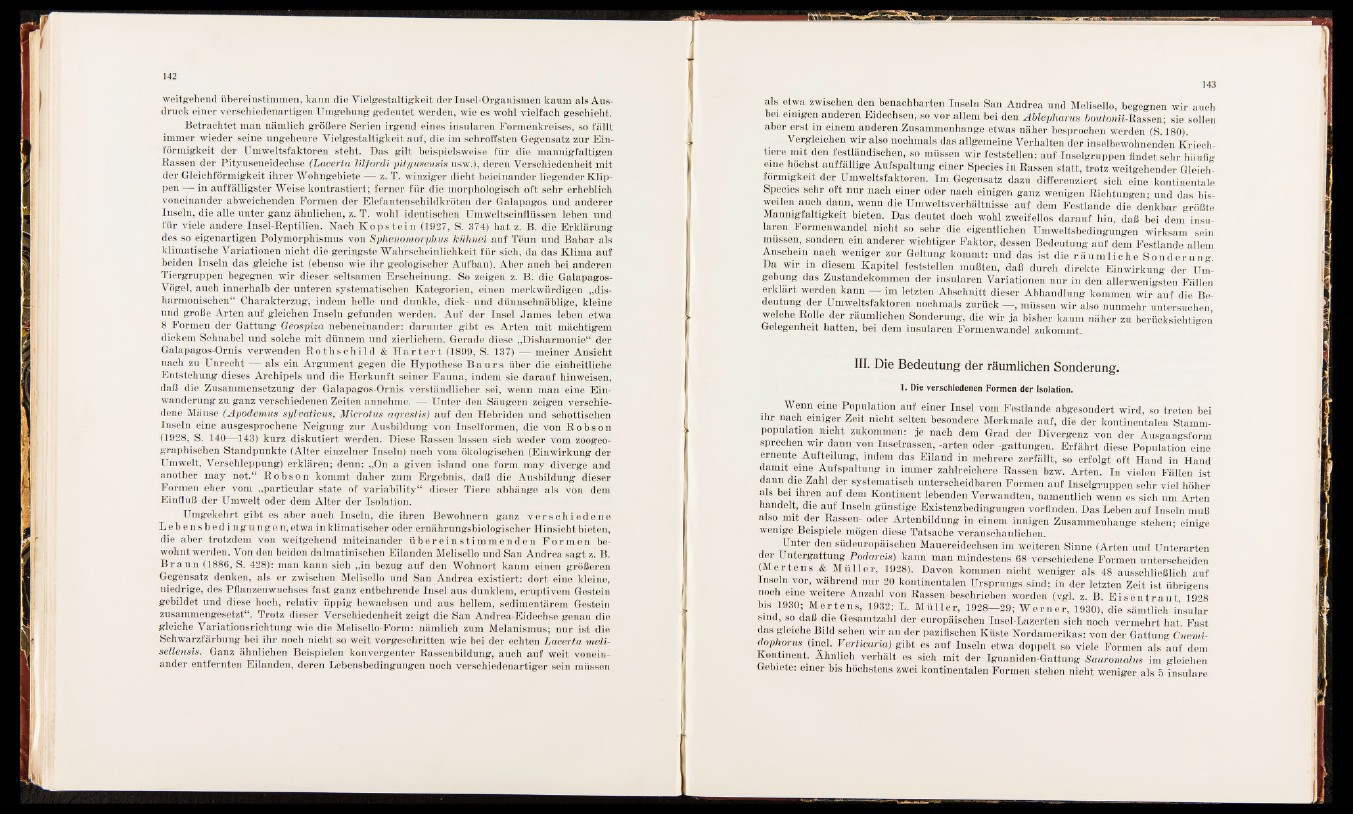
weitgehend übereinstimmen, k a n n die Vielge sta ltig k e it d e r Insel-Organismen k anm als Ausd
ruck einer v e rsch ied e n a rtig en Umgebung g edeutet werden, wie es wohl v ie lfa ch geschieht.
B e tra ch te t man nämlich g rö ß e re Serien irg en d eines in su la ren Formenkreises, so fä llt
immer wieder seine u ngeheure Vie lg e sta ltig k e it au f, die im schroffsten Gegensatz zu r E in förmig
k e it der Um weltsfaktoren steh t. Das g ilt beispielsweise f ü r die m an n ig fa ltig e n
Rassen der Pityuseneidechse (Lacerta lilfordi püyusensis usw.), deren Verschiedenheit m it
d e r Gleichförmigkeit ih r e r W ohngebiete B - z. T. winziger dich t b e ieinander liegender K lip p
en —■ in au ffä llig s te r Weise k o n tra s tie rt; fe rn e r fü r die morphologisch oft s e h r erheblich
v o n einander abweichenden Fo rm en d e r E le fan ten sch ild k rö ten d e r Galapagos u n d a n d e re r
Inseln, die a lle u n te r ganz ähnlichen, z. T. wohl identischen Umweltseinflüssen leben u n d
f ü r viele an d e re Insel-Reptilien. Nach K o p s t e i n (1927, S. 374) h a t z. B. die E rk lä ru n g
des so eig en a rtig en Polymorphismus von Sphenomorphus kühnei a u f Teun u n d B a b a r als
klima tisch e V a ria tio n en n ic h t die gerin g ste Wah rsch e in lich k e it fü r sich, da das K lim a a u f
beiden In se ln das gleiche is t (ebenso wie ih r geologischer Aufbau). Ab e r au ch bei an d e ren
T ie rg ru p p en begegnen w ir dieser seltsamen E rscheinung. So zeigen z. B. die Galapagos-
Vögel, auch in n e rh a lb d e r u n te re n systematischen K a tegorien, einen m e rkw ü rd ig en „dish
a rmonischen“ C ha rakterzug, indem helle u n d dunkle, dick- u n d dünnschnäblige, kleine
u n d g roße A rte n a u f gleichen In se ln g efunden werden. A u f der In se l Jam e s leben etwa
8 F ormen d e r G a ttu n g Geospiza nebeneinande r: d a ru n te r g ib t es A rte n m it mächtigem
dickem Schnabel u n d solche m it dünnem u n d zierlichem. Gerade diese „Disharmonie“ der
Galapagos-Ornis verwenden R o t h s c h i l d & H a r t e r t (1899, S. 137)H m e in e r A nsicht
n a ch zu U n re ch t — a ls ein A rg um en t gegen die Hypothese B a u r s ü b e r die einheitliche
E n ts teh u n g dieses Arch ip e ls u n d die H e rk u n ft se iner F a u n a , indem sie d a ra u f hinweisen,
daß die Zusammensetzung d e r Galapagos-Ornis v e rstän d lich e r sei, wenn man eine E in w
an derung zu ganz verschiedenen Zeiten annehme. —■ U n te r den S äu g e rn zeigen verschiedene
Mäuse (Apodemus sylvaticus, Microtus aqrestis) a u f den Heb rid en u n d schottischen
In se ln eine ausgesprochene Neigung zu r A u sbildung von Inselformen, die von R o b s o n
(1928, S. 140—143) k u rz d isk u tie rt werden. Diese Rassen lassen sich weder vom zoogeo-
g rap h isch en S tan d p u n k te (Alter einzelner Inseln) noch vom ökologischen (E inw irk u n g der
Umwelt, Verschleppung) e rk lä re n ; denn: „On a giv en Island one fo rm m ay d iverge and
an o th e r m ay n o t.“ R o b s o n kommt d ah e r zum E rgebnis, d aß die Ausbildung dieser
Fo rm en eher vom „ p a rtic u la r sta te of v a r ia b ility “ dieser T ie re ah hänge als von dem
Einfluß d e r Umwelt oder dem A lte r d e r Isolation.
Um gekehrt g ib t es ab e r auch Inseln, die ih re n Bewohnern ganz v e r s c h i e d e n e
L e b e n s h e d i n g u n g e n , etwa in k lim a tisch e r oder e rnährungsbiologischer H in sic h t bieten,
die ab e r trotzdem von weitgehend m ite in an d e r ü b e r e i n s t i m m e n d e n F o r m e n bewohnt
werden. Von den beiden dalmatinischen E ilan d e n Melisello und S an A n d re a s a g t z. B.
B r a u n (1886, S. 428): man k a n n sich „in bezug a u f den W o h n o rt kaum einen grö ß e ren
Gegensatz denken, als er zwischen Melisello u n d S an A n d re a ex istie rt: d o rt eine kleine,
n iedrige, des Pflanzenwuchses fa s t ganz entbehrende Inse l aus dunklem, e ru p tiv em Gestein
g ebildet u n d diese hoch, re la tiv ü p p ig bewachsen und au s hellem, sedimentä rem Gestein
zusammengesetzt“ . Trotz dieser Verschiedenheit zeigt die S an Andrea-Eidechse gen au die
gleiche V a ria tio n sric h tu n g wie die Melisello-Form: nämlich zum Melanismus; n u r is t die
Sehwa rz fä rb u n g bei ih r noch n ic h t so weit v o rg e sch ritten wie bei d e r echten Lacerta meli-
sellensis. Ganz ähnlichen Beispielen k o n v e rg en te r Ra ssenbildung, auch a u f weit voneinan
d e r en tfe rn ten E ilanden, deren Lebensbedingungen noch v e rsch ied e n a rtig e r sein müssen
als etwa zwischen den ben a ch b a rten In se ln S an A n d re a u n d Melisello, begegnen w ir auch
bei einigen an d e ren Eidechsen, so v o r allem bei den Ablepharus feoaiowü-Rassen; sie sollen
ab e r e rst in einem an d e ren Zusammenhänge etwas n äh e r besprochen werden (S. 180).
Vergleichen w ir also nochmals das allgemeine V e rh a lten d e r inselbewohnenden K rie c h tie
re m it den festländischen, so müssen w ir feststellen: a u f In se lg ru p p en findet seh r häufig
eine höchst au ffä llig e A u fsp a ltu n g ein e r Species in Ra ssen s ta tt, tro tz weitgehender Gleichfö
rm ig k e it d e r Umweltsfaktoren. Im Gegensatz dazu d ifferenziert sich eine k o ntinentale
Species se h r oft n u r nach ein e r oder na ch einigen ganz wenigen R ichtungen; u n d das bisweilen
au ch dan n , wenn die Umweltsverhältnisse a u f dem F e stlan d e die den k b a r g rö ß te
M a n n ig fa ltig k e it bieten. Das d eu te t doch wohl zweifellos d a ra u f hin, daß bei dem in su la
re n F ormenwandel n ic h t so seh r die eigentlichen Umweltsbedingungen wirk sam sein
müssen, sonde rn ein a n d e re r wichtiger F a k to r, dessen Bedeutung a u f dem Festlan d e allem
Anschein na ch weniger zu r Geltung kommt: u n d das is t die r ä u m l i c h e S o n d e r u n g
D a w ir in diesem K ap ite l feststellen mußten, daß d u rch d irek te E inw irk u n g der Umgebung
das Zustandekommen d e r in su la re n V a ria tio n en n u r in den a llerwenigsten F ä llen
e rk lä rt werden k a n n — im letzten A b sch n itt dieser A b h andlung kommen w ir a u f die Bed
eu tu n g d e r Umweltsfaktoren nochmals zurück -H j müssen w ir also n u nm eh r u n tersuchen
welche Rolle d e r räum lic h en Sonderung, die w ir ja bishe r k aum n ä h e r zu berücksichtigen
Gelegenheit h a tten , bei dem in su la re n Formenwandel zukommt.
III. Die Bedeutung der räumlichen Sonderung.
1. Die verschiedenen Formen der Isolation.
Wenn eine P o p u la tio n a u f ein e r In se l vom F e stlan d e abgesondert wird, so tre te n bei
ih r nach e in ig e r Zeit n ic h t se lten besondere Merkmale au f, die d e r k o n tin en ta len Stammp
o p u la tio n n ic h t zukommen: je nach dem Grad d e r Divergenz von d e r Ausgangsform
sprechen w ir dan n von In selrassen, -a rten oder -gattungen. E r f ä h r t diese P o p u la tio n eine
e rn eu te Aufteilung, indem das E ilan d in m eh re re z e rfä llt, so e rfolgt o ft H a n d in H an d
d am it eine A u fsp a ltu n g in immer z ahlreichere Rassen bzw. A rten . In vielen F ä lle n ist
d an n die Z ahl d e r sy stematisch unte rsch e id b a ren F o rm e n a u f In se lg ru p p en seh r v ie l höher
a ls bei ih re n a u f dem K o n tin en t lebenden Verwandten, namen tlich wenn es sich um A rten
handelt, die a u f In se ln gü n stig e E xistenzbedingungen vorfinden. Das Leben a u f In se ln muß
also m it d e r Rassen- oder A rten b ild u n g in einem in n ig en Zusammenhänge stehen; einige
wenige Beispiele mögen diese T atsache veranschaulichen.
U n te r den südeuropäischen Mauereidechsen im weiteren Sinne (Arten und U n te ra rte n
d e r U n te rg a ttu n g Podarcis) k a n n m an mindestens 68 verschiedene F o rm e n u n terscheiden
(Me r t e n s & Mü l l e r , 1928). Davon kommen n ich t weniger als 48 ausschließlich a u f
In se ln vor, während n u r 20 k o n tin en ta len U rsp ru n g s sind; in d e r letzten Z e it is t übrigens
noch eine weitere Anzahl von Ra ssen beschrieben worden (vgl. z. B E i s e n t r a u t 1928
bis 1930; Me r t e n s , 1932; L. Mü l l e r , 1928— 29; We r n e r , 1930)^ die sämtlich in su la r
sind, so daß die Gesamtzahl d e r europäischen Insel-Laz erten sich noch v e rm e h rt h a t. F a s t
das gleiche Bild sehen w ir a n d e r pazifischen K ü s te Nordamerika s: von d e r G a ttu n g Cnemi-
dophorus (incl. Verticaria) g ib t es a u f In se ln etwa doppelt so viele Fo rm en als a u f dem
K o n tin en t. Ähnlich v e rh ä lt es sieh m it d e r Ig u an id en -G a ttu n g Sauromalus im gleichen
Gebiete: ein e r bis höchstens zwei k o n tin en ta len F o rm en stehen n ic h t weniger als 5 in su la re