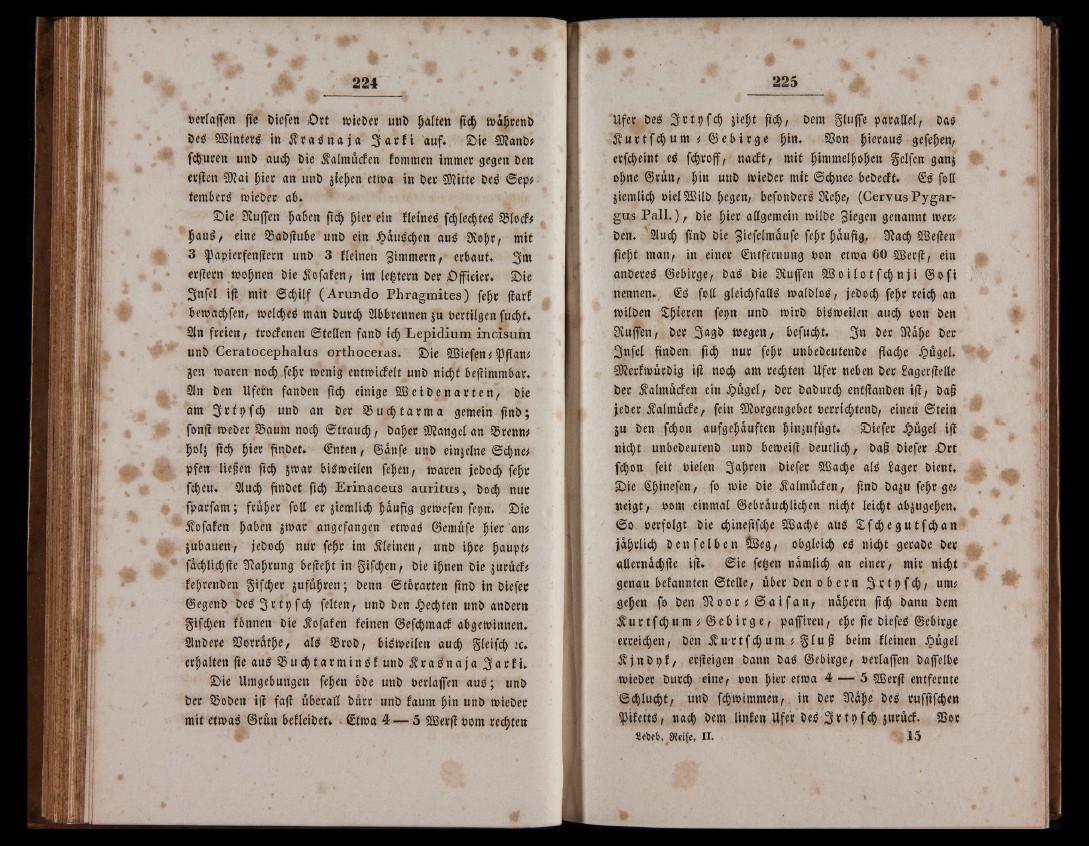
beríafíen fie liefen Ört wieöer unö falten fid) wabrenö
öeS SBtníerS in $raSna ja S a r f i auf* Öie Sföanö#
fcburen uní» auch Die $almíicken kommen immer gegen Den
erffen SOíai fjier an uní> jie^en etwa in öer SDíitte öeS @ep#-
temberS wieöer ab*
Öie Diuffen ^aSen ftd) ein kleines fcblecbíeS 35íock# ,
pauS, eine 3>aöftube unö ein #áuSd)en aus 9íof>c, mié
3 spapierfenfiern unö 3 kleinen 3immertt; erbaut*
* erflern wohnen öie $ofaken; im legtern öer öfficier. Öie
2¡nfel ift mit @d)ilf (Arundo Phragmites) fefjr fiark
bewacbfen; welches man öurdj 2lbbremten ¿u bertilgen fuebf*
Sin freien / trockenen ©teilen fanö teb Lepidium incisum
I unö Ceratocephalus orthoceras. öie SBiefen # $fian#
jen »aren nod) fefjr »enig entwickelt unö nicht befiimmbar*
Sin Öen Ufern fanöen ftd) einige SBeiöenarten^ öie
am 3rkt)fcb unö an öer 25uebtarnta gemein ftnö;
fonfl weöer S5aunt noch ©traueb; öaher Mangel an 25renn#
polj ftdb $ier ftnöet* €nten, ©anfe unö einzelne ©ebne#
I pfén liefen ftcb jwar bisweilen fe^en, waren jeöocb fefjr
febeu* 3lucb ftnöet ftd) Erinaceus auritus, öoeb nur
fparfam; früher foU er jtemlicb b«»ft3 geWefen fepn* Öie
$ofaken paben jwar angefangen etwas ©entufe fjier an#
A jubauen; jeöocb nur fehr im kleinen, unö ihre haupt#
II facblicbfie Nahrung befieht in gifeben, öie ihnen Öie juruef#
fehrenöen gifeber juführen; öenn ©tbraríen ftnö in öiefer
©egenö ÖeS grtpfcb feiten/ unö Öen Rechten unö anöern
gifdjen können öie fofaken feinen ©efebmaef abgewinnen*
Slnöere 23orrafhe; alé 23roö; bisweilen auch gleifd; tc*
erhalten fie aus 25ucbtarminSf unö ÄraSnaja 3arfi*
öie Umgebuftgen fehen oöe unö berlaffen auS; unö
öer 25oöen ifi fafi úbeeaít öurr unö kaum hin unö wieöer
mit «wa| ©tun bekleiöet* - <£twa 4— 5 Sßerfi born regten
Ufer öeS Sitpfcb Sieht ftcb/ I>em gluffe parallel; Das
$urtfcbum # ©ebirge hin* $on hiefau¿ gefehe«;
erfdbeint eS febrojf; nackt; mit btoimelhoben Seifen ganj
ofjne ©rutt; hin unö wieöer mit ©ebnee beöecft. €S foU
jiemlicb biel SEBilö h^en; befonöerS üftehe; (Cervus Pygar-
gus P a ll.), öie hier allgemein wilöe 3iegen genannt wer#
öen* v2lucb ftnö öie 3iefelmaufe fehr háuftg* 3?acb SfBeflen
fteht man; in einer Entfernung bon etwa 60 SBerfi; ein
anöereS ©ebirge; öaS öie Üluffen SSoilot feb nji ©ofi
nennen*;. ES foU gleichfalls walöloS; jeöocb fehr reich an
witöen Spieren fepn unö wirö bisweilen auch bon öen
Siuffen; öer ^ngfc wegen; befuebt. 3¡n öer SRahe öer
Snfel fünöen, ftcb nur fehr unbeöeufenöe fkacbe Jg>ügel*
$DJerkwuröig i(i noch am rechten Ufer neben öer SagerJMe
öer Kalmücken ein.^>ugel; öer öaöurch entfianöen ift; öa§
jeöer Kalmücke; fein Sftorgengebet berrichtenö; einen ©tein
ju öen fehon aufgehauften hinjufögt* Öiefer Jjugel ifi
nid)t unbeöeutenö unö beweifi öeutlicb; öa§ öiefer ört
febon feit bielen gahren öiefer SßSacbe als Säger öienf*
öie Shinefen, fo wie öie Kalmücken, ftnö öaju fehr ge#
neigt> bom einmal ©ebraueblicben nicht leicht abjugehen*
©o berfolgt. öie cbineftfd)e Slßactje aus Sfchegutfchan
jährlich öenfelben feeg; obgleich eS nicht geraöe öer
aHernachjie ifi. ©ie fegen nämlich an einer; mir nicht
genau bekannten ©teKe; über öen obern Sí íbfth/ u*u*
gehen fo öen Sftoor # ©aifan; nähern ftd) öann öem
^urtfehum # ©ebirge; pajfiren; ehe fie öiefeS ©ebirge
btteicben; öen ^urtfehum # glufj beim fleinen ^»ugel
itjnöpf; erfkeigen öann öaS ©ebirge; berlajfen öajfelbe
wieöer öutch eine; bon hier etwa 4 — 5 5Serfk entfernte
©chiuchi; unö 'febwimmén; in öer Skahe öeS rufftfehen
spifettS; nach linken Ufer öeS 3 x t p f<h $uruck. Sßor
bebet», Steife, II. 15